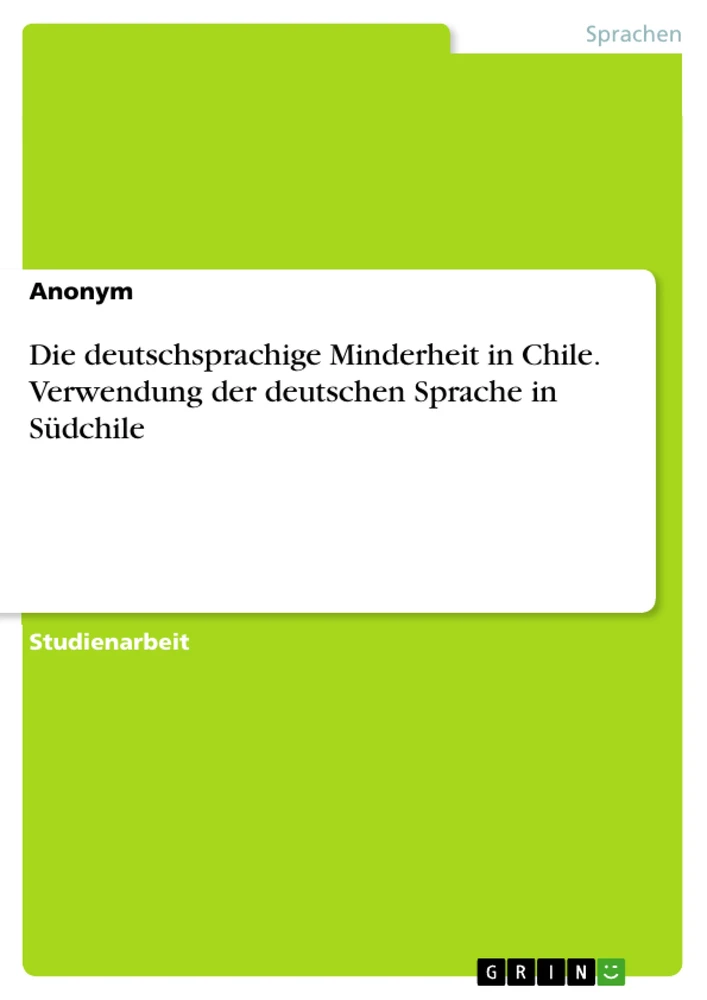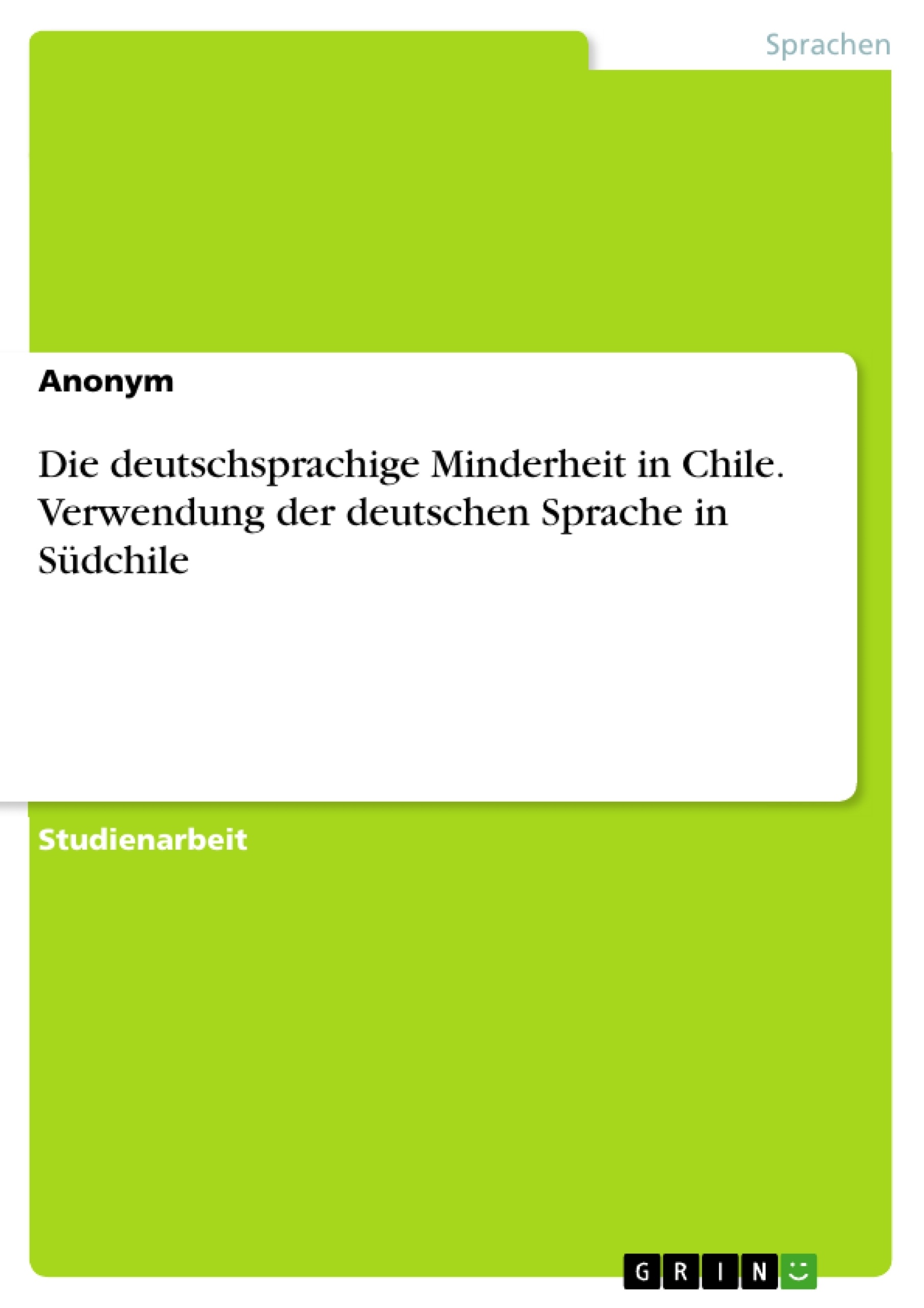In einigen Dörfern Südchiles trifft man auf deutsche Straßennamen oder kann im Supermarkt Gebäck mit der Aufschrift „Kuchen“ kaufen. Auch Jahrzehnte nach der deutschen Besiedlung Chiles scheint das Deutsche hier präsent zu sein. Findet die deutsche Sprache tatsächlich noch Verwendung im Alltag der Deutsch-Chilenen oder hinterließ sie bloß ihre Spuren aus einer längst vergangenen Zeit?
In der vorliegenden Arbeit wird die aktuelle Verwendung der deutschen Sprache bei der deutschsprachigen Minderheit in Südchile untersucht. Dabei werden sowohl historische Grundbedingungen als auch die Entwicklung der deutschen Sprache und des deutsch-spanischen Sprachkontaktes dargelegt. Hinsichtlich des Schwerpunktes zur Verwendung der deutschen Sprache soll die Frage beantwortet werden, in welchen Situationen, mit welchen Interaktionspartnern und in welcher Form das Deutsche verwendet wird. Hierzu werden einige bereits vorliegende soziolinguistische Untersuchungen herangezogen. Im Laufe der Arbeit wird außerdem analysiert, ob in der deutsch-chilenischen Sprachgemeinschaft ein Sprachwechsel zum Spanischen erfolgen wird oder ob dieser bereits vollzogen wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geschichte der deutschen Einwanderung in Südchile
- 2.1 Die Entwicklung der Kolonie am Llanquihue-See
- 2.2 „Launadeutsch“ und „Chilotendeutsch“
- 3. Die Sprachentwicklung der deutschen Minderheit in Südchile
- 4. Die aktuelle Situation der deutschen Sprache in Südchile
- 4.1 Sprecherzahlen und geografische Verbreitung
- 4.2 Verwendung der deutschen Sprache
- 4.2.1 Die beeinflussenden Faktoren „Alter“ und „Konfession“
- 4.2.2 Deutsche Institutionen
- 4.2.3 Gebrauchssituationen
- 4.2.4 Form der Sprache
- 4.2.5 Sprachwechsel
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die aktuelle Verwendung der deutschen Sprache innerhalb der deutschsprachigen Minderheit in Südchile. Sie beleuchtet die historischen Hintergründe der deutschen Einwanderung und die Entwicklung der deutschen Sprache im Kontext des deutsch-spanischen Sprachkontakts. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der konkreten Gebrauchssituationen der deutschen Sprache: in welchen Kontexten, mit welchen Gesprächspartnern und in welcher Form wird Deutsch verwendet? Schließlich wird die Frage nach einem möglichen oder bereits vollzogenen Sprachwechsel zum Spanischen untersucht.
- Die Geschichte der deutschen Einwanderung nach Südchile und die Entstehung der Siedlungen.
- Die Entwicklung des „Launadeutsch“ und anderer deutsch-chilenischer Sprachvarianten.
- Die soziolinguistische Situation der deutschen Sprache in Südchile im Hinblick auf Sprecherzahlen und geographische Verbreitung.
- Die Analyse der Verwendung der deutschen Sprache in verschiedenen Kontexten und mit unterschiedlichen Interaktionspartnern.
- Die Untersuchung des Sprachwechsels von Deutsch zu Spanisch innerhalb der deutsch-chilenischen Sprachgemeinschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Verwendung der deutschen Sprache in Südchile ein und stellt die Forschungsfrage nach der aktuellen Relevanz des Deutschen im Alltag der Deutsch-Chilenen. Sie beschreibt den geografischen Fokus der Untersuchung (Südchile, von Temuco bis Puerto Montt) und definiert den Begriff „Deutsch-Chilenen“. Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der sowohl historische Aspekte als auch soziolinguistische Untersuchungen berücksichtigt, und kündigt die Analyse eines möglichen Sprachwechsels zum Spanischen an.
2. Die deutsche Einwanderung in Südchile: Dieses Kapitel beschreibt die Geschichte der deutschen Einwanderung nach Südchile im 19. Jahrhundert, die von wirtschaftlichen und politischen Faktoren in Europa und Chile beeinflusst wurde. Es werden die drei Hauptsiedlungsgebiete (Valdivia, Osorno/La Unión und die Llanquihue-Region) genannt und die Rolle der chilenischen Kolonisationspolitik erläutert. Die Rolle des Kolonisationsgesetzes von 1845 und die Herausforderungen bei der Anwerbung von Siedlern werden detailliert beschrieben. Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen bei der Rekonstruktion der genauen Einwandererzahlen und verweist auf die Schätzungen zwischen 9.000 und 10.000 deutschsprachigen Einwanderern zwischen 1846 und 1925. Die Bedeutung der Einwanderung für den „wertvollen Zuwachs an fähigen Menschen“ in Chile wird hervorgehoben.
2.1 Die Entwicklung der Kolonie am Llanquihue-See: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklung der deutschen Kolonie am Llanquihue-See, die ab 1853 entstand. Es beschreibt die anfängliche geografische Isolation und die Entstehung einer sozial und kulturell geschlossenen Gesellschaft, in der die deutsche Sprache lange Zeit aufrechterhalten werden konnte. Die Notwendigkeit, eigene Institutionen zu schaffen, wird hervorgehoben, ebenso wie die „Musterkolonie“-Funktion der Siedlung für die chilenische Regierung. Der Bau der Eisenbahnlinie nach Puerto Montt im Jahr 1912 und die damit verbundene Öffnung der Gesellschaft werden als entscheidender Wendepunkt für die Sprachentwicklung der deutschen Minderheit dargestellt.
2.2 „Launadeutsch“ und „Chilotendeutsch“: Dieses Kapitel behandelt die sprachliche Entwicklung in der Llanquihue-Region. Die anfängliche Heterogenität der Dialekte wird beschrieben, sowie deren Assimilation zu einer dem Standarddeutschen ähnlichen Umgangssprache, dem „Launadeutsch“. Der Einfluss des Spanischen auf Syntax und Wortschatz des „Launadeutsch“ wird detailliert erklärt. Das Kapitel betont die Fusion verschiedener deutscher Dialekte mit spanischen Elementen, was zu einer einzigartigen Sprachvariante führte.
Schlüsselwörter
Deutsch-chilenische Sprachgemeinschaft, Südchile, deutsche Einwanderung, Sprachkontakt, Launadeutsch, Sprachentwicklung, Sprachwandel, Soziolinguistik, Sprachverwendung, Interaktionspartner, Sprachwechsel, deutsch-spanischer Sprachkontakt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur deutsch-chilenischen Sprachgemeinschaft in Südchile
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die aktuelle Verwendung der deutschen Sprache innerhalb der deutschsprachigen Minderheit in Südchile. Sie beleuchtet die historischen Hintergründe der deutschen Einwanderung und die Entwicklung der deutschen Sprache im Kontext des deutsch-spanischen Sprachkontakts. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der konkreten Gebrauchssituationen der deutschen Sprache und der Untersuchung eines möglichen Sprachwechsels zum Spanischen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Geschichte der deutschen Einwanderung nach Südchile, die Entwicklung des „Launadeutsch“ und anderer deutsch-chilenischer Sprachvarianten, die soziolinguistische Situation der deutschen Sprache in Südchile (Sprecherzahlen, geographische Verbreitung), die Analyse der Sprachverwendung in verschiedenen Kontexten und mit unterschiedlichen Interaktionspartnern sowie die Untersuchung des Sprachwechsels von Deutsch zu Spanisch.
Welche Regionen Südchiles werden betrachtet?
Der geografische Fokus der Untersuchung liegt auf Südchile, von Temuco bis Puerto Montt.
Wie wird die Geschichte der deutschen Einwanderung dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die Geschichte der deutschen Einwanderung nach Südchile im 19. Jahrhundert, die drei Hauptsiedlungsgebiete (Valdivia, Osorno/La Unión und die Llanquihue-Region), die Rolle der chilenischen Kolonisationspolitik und die Herausforderungen bei der Rekonstruktion der genauen Einwandererzahlen. Die Bedeutung der Einwanderung für Chile wird hervorgehoben.
Was ist "Launadeutsch"?
„Launadeutsch“ ist eine dem Standarddeutschen ähnliche Umgangssprache, die sich in der Llanquihue-Region entwickelte. Sie entstand durch die Fusion verschiedener deutscher Dialekte mit spanischen Elementen.
Wie wird die aktuelle Sprachsituation beschrieben?
Die Arbeit analysiert die aktuelle Verwendung der deutschen Sprache in Südchile, berücksichtigt beeinflussende Faktoren wie Alter und Konfession, untersucht den Gebrauch in verschiedenen Institutionen und Situationen und geht auf die Form der Sprache und den Sprachwechsel zum Spanischen ein.
Welche Methoden werden angewendet?
Der methodische Ansatz der Arbeit berücksichtigt sowohl historische Aspekte als auch soziolinguistische Untersuchungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutsch-chilenische Sprachgemeinschaft, Südchile, deutsche Einwanderung, Sprachkontakt, Launadeutsch, Sprachentwicklung, Sprachwandel, Soziolinguistik, Sprachverwendung, Interaktionspartner, Sprachwechsel, deutsch-spanischer Sprachkontakt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Einleitung, der Geschichte der deutschen Einwanderung in Südchile (inkl. der Entwicklung der Kolonie am Llanquihue-See und der Entstehung von „Launadeutsch“), zur Sprachentwicklung der deutschen Minderheit in Südchile, zur aktuellen Situation der deutschen Sprache in Südchile und einer Schlussbetrachtung.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln und ihren Inhalten.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2015, Die deutschsprachige Minderheit in Chile. Verwendung der deutschen Sprache in Südchile, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/590671