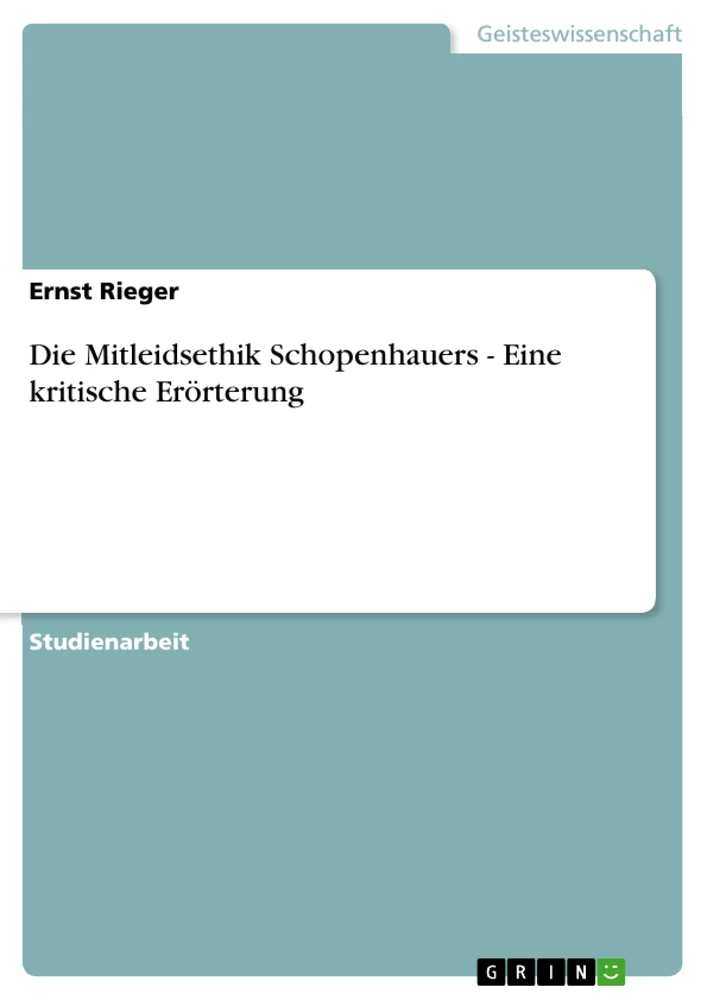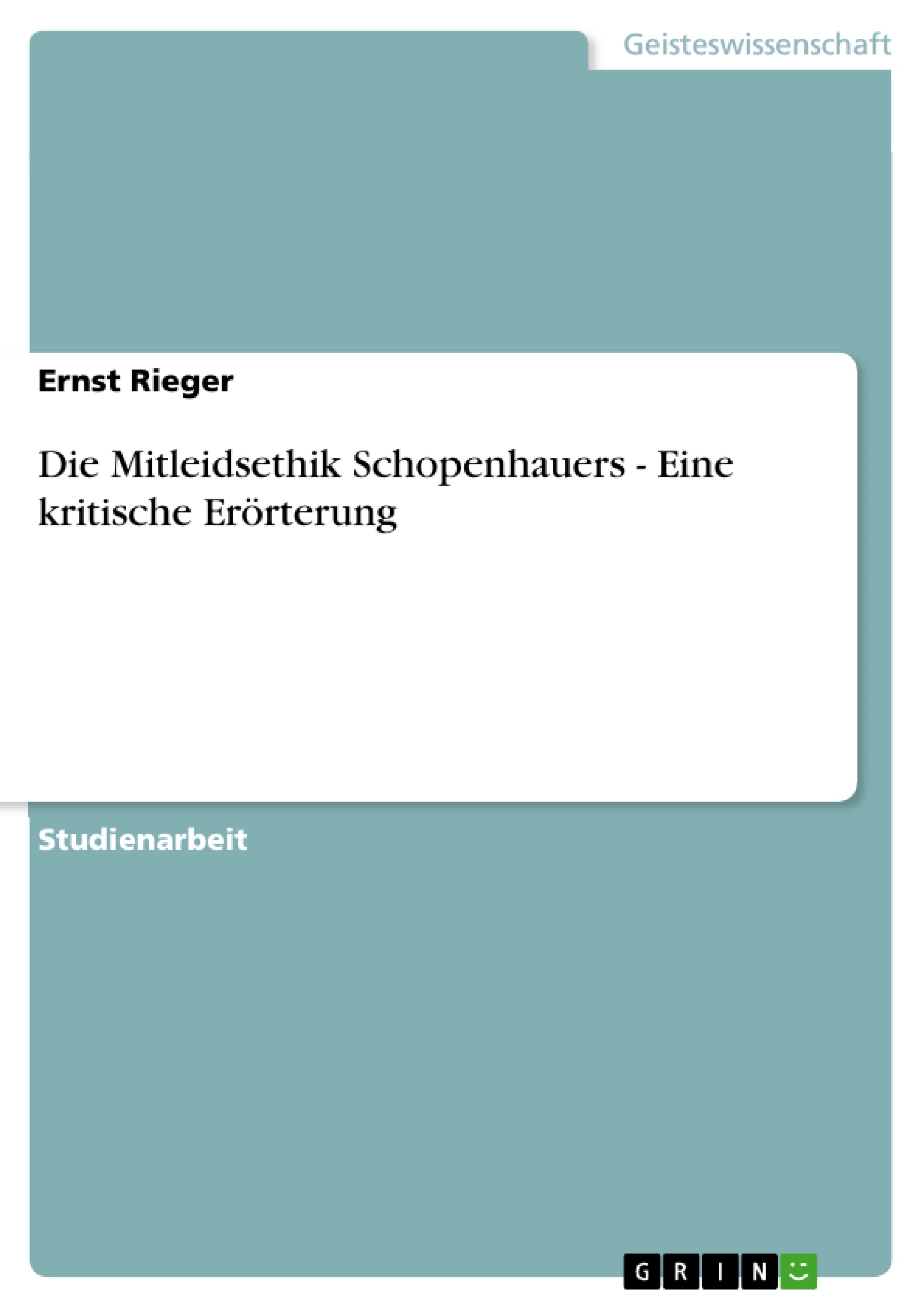„Moral predigen ist leicht, Moral begründen schwer“1. Unter diesem Motto verfasste Arthur Schopenhauer 1840 seine Preisschrift „Über die Grundlage der Moral“2. Thema dieser Hausarbeit ist eine kritische Erörterung der Mitleidsethik Schopenhauers unter metaphysischen und Nicht-metaphysischen Prämissen. Schopenhauers Mitleidsethik lässt sich unter zwei Gesichtspunkten betrachten. Einmal als nicht-metaphysische Erklärung des Fundamentes einer Moral und einmal als metaphysische Erklärung. Das Fundament der Moral wird in der Preisschrift weitgehend unabhängig von einer Metaphysik begründet. Das Mitleid bleibt als Urphänomen mysteriös. Für Schopenhauer ist aber vor allem wichtig zu zeigen, dass sich aus dem Mitleid die beiden Kardinaltugenden „Gerechtigkeit“ und „Menschenliebe“ ableiten lassen sowie anhand des „experimentum crucis“3 zu beweisen, dass der Mensch bei einer moralischen Entscheidung aus Mitleid handelt und keine theoretischen philosophischen Überlegungen anstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Ausgangspunkt, Kant-Kritik und Hinführung zum wahren Fundament einer Moral
- 1.1 Antimoralische Triebfedern (§14)
- 1.2 Aufstellung und Beweis der allein echten moralischen Triebfeder (§15-16)
- 1.3 Die zwei Kardinaltugenden (§17-18)
- 1.4 Schopenhauers Bestätigungen seines Fundamentes einer Moral (§19)
- 2. Kritische Erörterung der §12-19
- 2.1 Tugendhats Einwände und ihre kritische Betrachtung
- 3. Metaphysische Begründung des Fundamentes einer Moral und deren kritische Erörterung
- 3.1 Rekonstruktion der metaphysischen Erklärung (§21-22)
- 3.2 Die Rolle des metaphysisch begründeten Mitleids innerhalb der Philosophie Schopenhauers
- 3.3 Lässt sich das Mitleid aus der Einsicht in die Wesensidentität ableiten?
- 4. Die Rolle des Selbstmitleids
- Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit einer kritischen Erörterung der Mitleidsethik Schopenhauers, sowohl unter nicht-metaphysischen als auch unter metaphysischen Prämissen. Das Ziel ist es, die Grundlagen der Schopenhauer'schen Moraltheorie zu analysieren und ihre Stärken und Schwächen zu beleuchten.
- Die Ableitung der Gerechtigkeit aus dem Mitleid
- Die Rolle des Mitleids als Abwägungskriterium in ethischen Entscheidungen
- Die metaphysische Begründung des Mitleids in Schopenhauers Philosophie
- Die Frage, ob sich aus der Wesensidentität moralisches Handeln in Form von Mitleid ableiten lässt
- Die besonderen Herausforderungen des Selbstmitleids innerhalb der Mitleidsethik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach dem wahren Fundament einer Moral und zeigt, dass Schopenhauer eine rein philosophische und von metaphysischen Überlegungen unabhängige Lösung anstrebt. Der erste Teil der Arbeit behandelt Schopenhauers Kritik an Kants kategorischem Imperativ und erläutert, warum Schopenhauer das Mitleid als die einzige echte moralische Triebfeder sieht. Dieser Abschnitt analysiert die Argumente, die Schopenhauer für seine Mitleidsethik vorbringt, und betrachtet auch kritische Einwände gegen seine Position. Der zweite Teil befasst sich mit der metaphysischen Begründung des Mitleids, untersucht die Wesensidentität und deren Auswirkungen auf das moralische Handeln. Der letzte Teil der Arbeit widmet sich dem Selbstmitleid und den besonderen Herausforderungen, die dieses Phänomen für die Schopenhauer'sche Ethik mit sich bringt.
Schlüsselwörter
Mitleid, Ethik, Moral, Schopenhauer, Kant, kategorischer Imperativ, Wesensidentität, Gerechtigkeit, Selbstmitleid, metaphysische Begründung, Nicht-metaphysische Begründung,
- Citation du texte
- Ernst Rieger (Auteur), 2005, Die Mitleidsethik Schopenhauers - Eine kritische Erörterung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58911