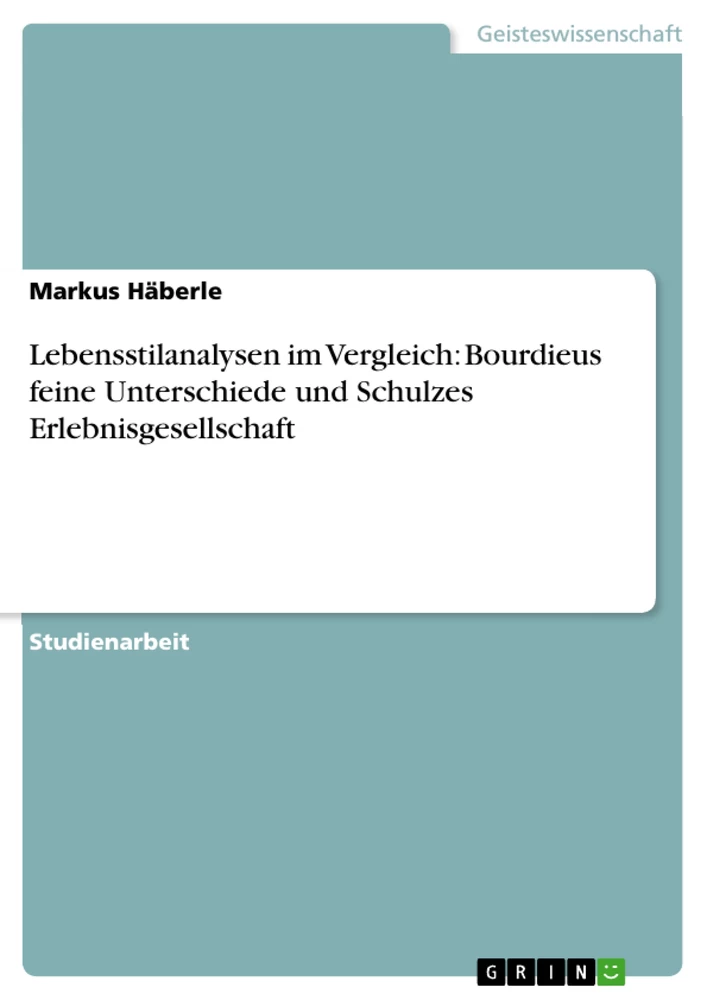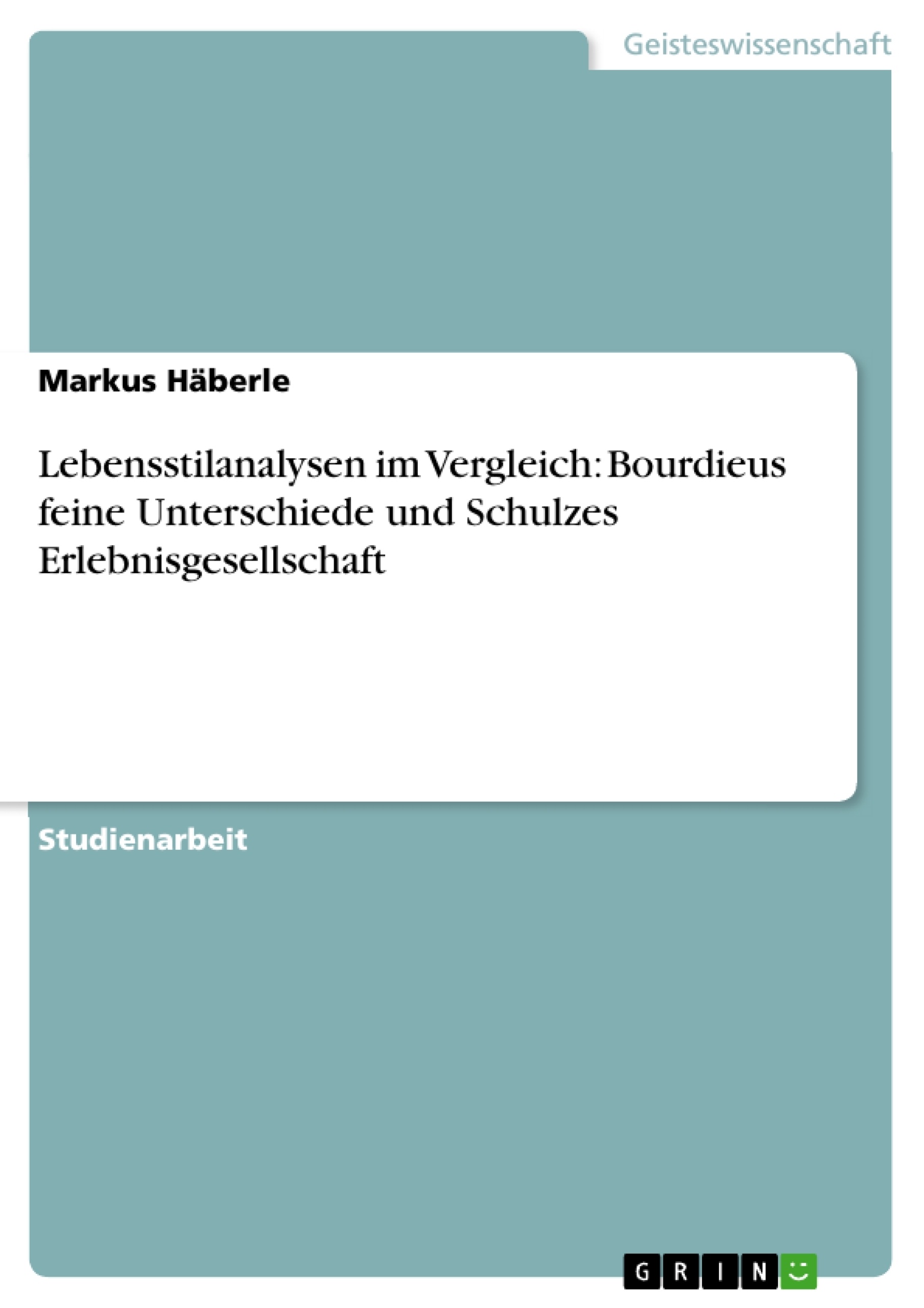Die Lebensstilforschung scheint in letzter Zeit zu einer der bekanntesten und rege diskutiertesten Forschungsrichtungen der Soziologie geworden zu sein. Neben der Marktforschung, welche die Lebensweise der Einzelnen relativ genau erforscht um ihre Produkte „an den Mann“ zu bringen, gibt es seit den 1980er Jahren eine Vielzahl von wissenschaftlichen Studien, die sich im Rahmen von Lebensstilanalysen mit dem sozialen und kulturellen Wandel der Gesellschaft beschäftigen.
Dabei fallen die Diagnosen und Beschreibungen der Gesellschaft höchst unterschiedlich aus: Bis in die 1970er Jahre wurden die Lebensstile fast ausschließlich in einem Zusammenhang von sozioökonomischen Lagebedingungen und subjektiven Lebensweisen betrachtet. Die Einteilung der gesellschaftlichen Großgruppen mit ihrer jeweils eigenen Lebensweise wurde vor allem an dem ihnen zur Verfügung stehenden Geld festgemacht. Seit den 1980er Jahren änderte sich dies: Es wurden weitere Faktoren berücksichtigt, vor allem wurden verstärkt die soziokulturellen Bedingungen betrachtet.
Es wird argumentiert, dass aufgrund von veränderten Lebensbedingungen die individuellen Lebensweisen von sozioökonomischen Lagebedingungen entkoppelt worden sind. Zwei Schlagwörter, die dabei immer wieder Verwendung finden heißen „Individualisierung“ und „Entstrukturierung“. Damit soll, etwas zugespitzt formuliert, der angebliche Wandel der heutigen Gesellschaft hin zu einer losen Vereinigung aus individuellen, voneinander unabhängigen Personen beschrieben werden, in der jeder „sein eigenes Süppchen kocht“, in der jeder sein eigenes Leben lebt.
Manche Autoren zeichnen ein Bild der Gesellschaft, in der sich gemeinsame Lebensstile sich anscheinend völlig aufgelöst haben, das also ganz im Gegensatz zu den früheren Werken steht, in denen die Gemeinsamkeiten der Lebensweise der jeweiligen Gruppen betont wurde.
Doch trifft dies alles zu? Um dies zu untersuchen soll hier eine aktuellere Studie, in diesem Fall Gerhard Schulzes „Erlebnisgesellschaft“, mit einem etwas älteren Werk, einem Klassiker der Lebensstilanalyse, nämlich Pierre Bourdieus „feine Unterschieden“, vergleichen. Dabei stellt sich die Frage, wie die Beschreibungen der Lebensstile differieren, nach welchen Markmalen sich die gesellschaftlichen Großgruppen herausbilden, ob sich die Lebensweise überhaupt geändert hat, inwieweit Unterschiede festzustellen sind und welche Gemeinsam-keiten es gibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Pierre Bourdieu: „Die feinen Unterschiede“
- Werdegang
- methodische Vorgehensweise
- theoretischer Hintergrund
- Die Lebensstile
- Der „Sinn für Distinktion“
- „Bildungsbeflissenheit“
- Der „Geschmack des Notwendigen“
- Gerhard Schulze: „Die Erlebnisgesellschaft“
- Werdegang
- methodische Vorgehensweise
- theoretischer Hintergrund
- Der Lebensstilansatz
- alltagsästhetische Schemata
- Milieus
- Vergleich der Ansätze
- Vergleich der theoretischen Gerüste
- Vergleich der Lebensstile
- Vergleich der Erhebungsfelder
- Pierre Bourdieu: „Die feinen Unterschiede“
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der vergleichenden Analyse von zwei einflussreichen Lebensstilanalysen: Pierre Bourdieus „Die feinen Unterschiede“ und Gerhard Schulzes „Die Erlebnisgesellschaft“. Das Ziel ist es, die unterschiedlichen Beschreibungen von Lebensstilen in beiden Werken zu untersuchen, um herauszufinden, ob sich die Lebensweise in der Gesellschaft tatsächlich verändert hat und welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Ansätzen bestehen.
- Vergleich der methodischen Vorgehensweisen von Bourdieu und Schulze
- Analyse der theoretischen Grundlagen beider Studien
- Untersuchung der jeweiligen Lebensstilkonzepte und deren Unterschiede
- Bewertung der Relevanz beider Studien für die aktuelle Lebensstilforschung
- Beurteilung der Veränderungen in der Lebensweise der Gesellschaft im Laufe der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Lebensstilforschung ein und erläutert die Relevanz des gewählten Vergleichs zwischen Bourdieu und Schulze. Im Hauptteil werden zunächst die beiden Autoren und ihre Studien vorgestellt, wobei jeweils der Werdegang, die methodische Vorgehensweise und der theoretische Hintergrund beleuchtet werden. Anschließend werden die jeweiligen Konzepte der Lebensstile in beiden Werken analysiert und miteinander verglichen. Die Arbeit soll mit einem Resümee abgeschlossen werden, das die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Vergleich der Studien zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Lebensstilforschung, Soziologie, Pierre Bourdieu, Gerhard Schulze, „Die feinen Unterschiede“, „Die Erlebnisgesellschaft“, Distinktion, Bildung, Geschmack, Erlebnisgesellschaft, Milieus, Vergleichende Analyse, Sozialer Wandel, Individualisierung, Entstrukturierung.
- Quote paper
- Markus Häberle (Author), 2006, Lebensstilanalysen im Vergleich: Bourdieus feine Unterschiede und Schulzes Erlebnisgesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58901