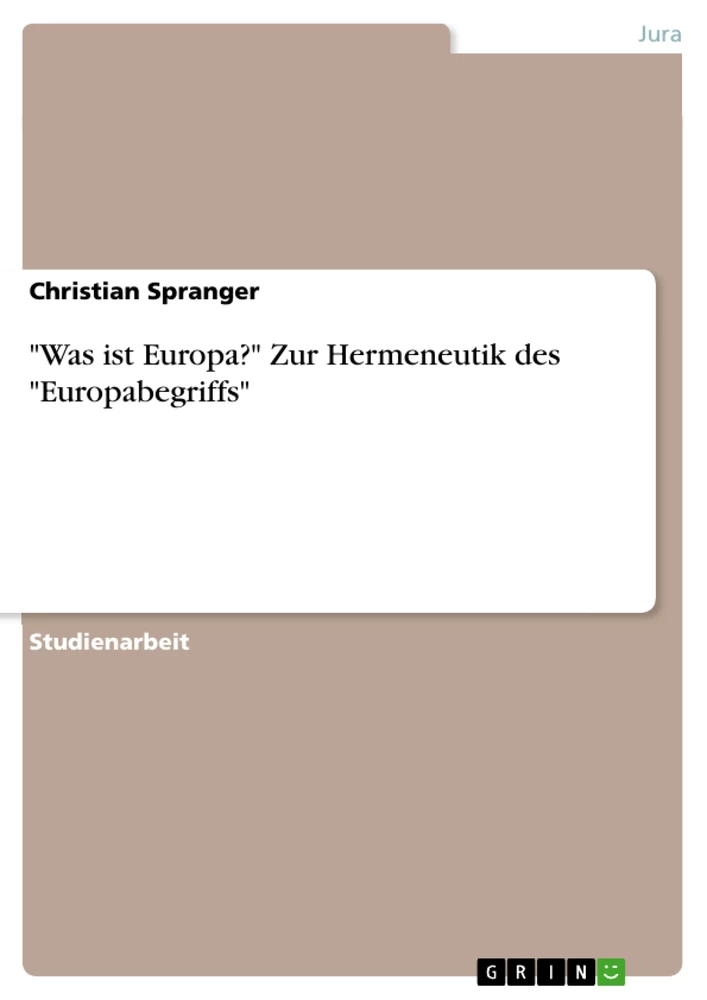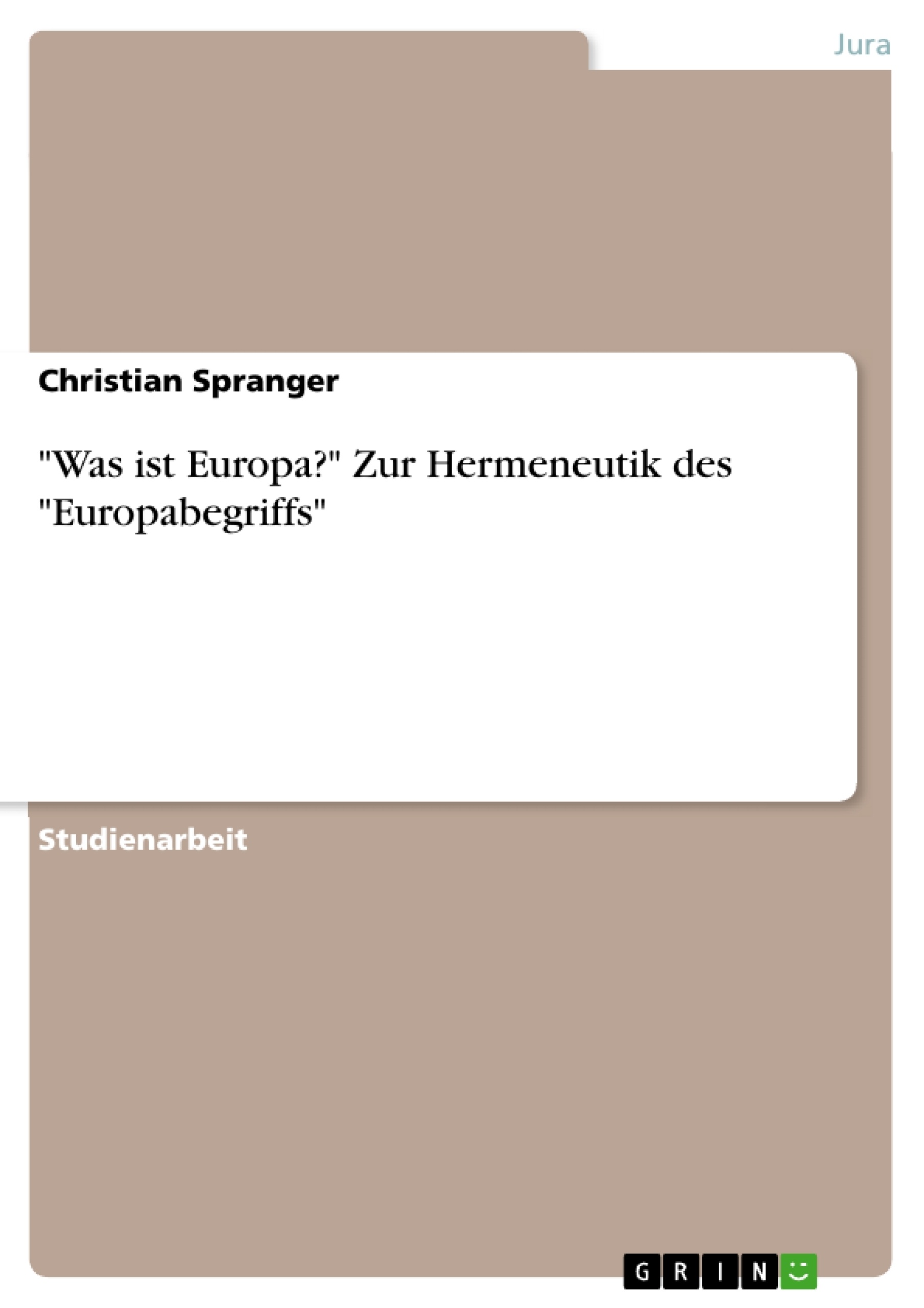In der Arbeit wird versucht, Ansatzpunkte zu einer Charakterisierung der Begrifflichkeit des Wortes „Europa“ zu finden. Ausgangspunkt dieser juristischen Abhandlung ist die in Art. 49 EUV i. V. m. Art. 6 Abs. 1 EUV geregelte Bedingung zum Beitritt in die Europäische Union. Im Zusammenhang mit der Begriffsfindung werden insbesondere geographische und kulturelle Aspekte beleuchtet. Die Diskussion mündet in einer Erörterung zweier aktueller Fragestellungen im Zusammenhang mit der „Europa-Frage“ und endet in einer Schlussfolgerung, die u. a. ein mögliches Szenario der Finalität der Europäischen Union (EU) beschreibt.
Inhaltsverzeichnis
- A. Subjektivität der Bedeutung des Wortes „Europa“
- B. Herkunft des Wortes „Europa“
- I. Etymologische Betrachtung
- II. „Europa“ in der griechischen Mythologie
- C. Geographischer Definitionsansatz des „Europabegriffes“
- I. Rechtlichte Relevanz der geographischen Abgrenzung des europäischen Territoriums
- II. Territoriale Grenzen im historischen Zusammenhang, dargestellt am Beispiel der „Europadefinition“ Herodots (ca. 484-425 vor Christus)
- III. Ergebnis
- D. Historischer Definitionsansatz des „Europabegriffes“
- E. Definitionsansatz auf der Basis der „kulturellen Identität“
- I. Begriff der „kulturellen Identität“
- II. „Kulturelle Identität“ und Staat
- III. „Kultureller Identität“ in Europa
- 1. „Die Aufklärung“ als Basis einer „kulturellen Identität“ in Europa
- 2. „Christentum“ als Basis einer „kulturellen Identität“ in Europa
- F. Betrachtung zweier aktueller politischer Fragestellungen im Zusammenhang mit der „Europa-Definition“ respektive mit dem Begriff einer „kulturellen Identität“ in Europa
- I. Kritik am Ansatz einer durch eine „Elite“ initiierten „kultureller Identität“ in Europa
- II. EU-Beitritt der Türkei – eine Frage der „kulturellen Identität“
- G. Ergebnis und Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den vielschichtigen und oft unklar verwendeten Begriff „Europa“. Ziel ist es, verschiedene Definitionsansätze zu beleuchten und die damit verbundenen Herausforderungen, insbesondere im politischen Kontext, zu analysieren.
- Subjektivität des Europabegriffs und seine Bedeutung für die politische Diskussion
- Etymologische und mythologische Ursprünge des Wortes „Europa“
- Geographische und historische Definitionsansätze
- Der Einfluss kultureller Identität auf die Europadefinition
- Aktuelle politische Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Europabegriff (z.B. der EU-Beitritt der Türkei)
Zusammenfassung der Kapitel
A. Subjektivität der Bedeutung des Wortes „Europa“: Der Text beginnt mit der Feststellung, dass der Begriff „Europa“ im politischen und öffentlichen Diskurs oft unreflektiert verwendet wird, ohne eine klare Definition. Die Bedeutung ist subjektiv und von der individuellen Wahrnehmung geprägt, was zu Irritationen und Meinungsverschiedenheiten führt. Die Arbeit betont die Notwendigkeit einer eindeutigen Definition, besonders im Kontext des EU-Beitritts von Staaten, da die Frage der „Europäisierung“ eine entscheidende Rolle spielt. Die komplexen sprachphilosophischen und erkenntnistheoretischen Implikationen des Begriffs werden nur angerissen, der Fokus liegt auf hermeneutischen Aspekten zur Charakterisierung des Begriffs.
B. Herkunft des Wortes „Europa“: Dieses Kapitel untersucht die etymologischen und mythologischen Ursprünge des Wortes „Europa“. Etymologisch wird der Begriff auf semitische und phönizische Wörter für „Abendland“ zurückgeführt, mit Bedeutungen wie „Abend“, „Dunkelheit“ oder „Abenddämmerung“. Der Text veranschaulicht die Entwicklung des Begriffs vom Plural („Abendländer“) zum Singular, der im 18. Jahrhundert als Gegenbegriff zu „Morgenland“ aufkam und heute auch politisch stark besetzt ist. Die mythologische Perspektive beschreibt Europa als Tochter eines phönizischen Königs und ihre Entführung durch Zeus, was die Symbolik und die vielfältige Interpretation des Begriffs verdeutlicht.
C. Geographischer Definitionsansatz des „Europabegriffes“: Dieses Kapitel analysiert geographische Abgrenzungen Europas. Es beleuchtet die rechtliche Relevanz geographischer Definitionen, insbesondere im Kontext des EU-Rechts. Der historische Aspekt wird am Beispiel Herodots illustriert, um die Entwicklung territorialer Grenzen und die Veränderungen des Europa-Verständnisses im Laufe der Geschichte aufzuzeigen. Der Abschnitt schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse der geographischen Betrachtung des Europabegriffs.
D. Historischer Definitionsansatz des „Europabegriffes“: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des Europabegriffs im Laufe der Geschichte, wobei die historischen Veränderungen des Verständnisses von Europa beleuchtet werden. Es werden verschiedene historische Konzepte von Europa betrachtet, um das Verständnis für die heutige Bedeutung des Begriffs zu erhellen. Der Fokus liegt auf der historischen Entwicklung und den daraus resultierenden unterschiedlichen Perspektiven auf Europa.
E. Definitionsansatz auf der Basis der „kulturellen Identität“: Hier wird der Begriff der „kulturellen Identität“ im Kontext des Europabegriffs untersucht. Es wird der Begriff der „kulturellen Identität“ selbst definiert und dessen Verhältnis zum Staat analysiert. Die Rolle der Aufklärung und des Christentums als potenzielle Basiselemente einer europäischen kulturellen Identität wird diskutiert. Die verschiedenen Aspekte kultureller Identität in Europa werden beleuchtet, um ein umfassendes Bild des Europabegriffs zu zeichnen.
F. Betrachtung zweier aktueller politischer Fragestellungen im Zusammenhang mit der „Europa-Definition“ respektive mit dem Begriff einer „kulturellen Identität“ in Europa: Dieses Kapitel untersucht aktuelle politische Diskussionen rund um den Europabegriff. Kritisch beleuchtet wird der Ansatz einer von einer „Elite“ initiierten kulturellen Identität Europas und deren Auswirkungen. Ein zentraler Punkt ist die Frage des EU-Beitritts der Türkei und die damit verbundene Diskussion über kulturelle Identität und die Kriterien für eine „europäische“ Identität. Die Kapitel veranschaulicht die Bedeutung des Europabegriffs für aktuelle politische Entscheidungen.
Schlüsselwörter
Europabegriff, Hermeneutik, kulturelle Identität, geographische Abgrenzung, historischer Kontext, EU-Beitritt, Türkei, politische Diskussion, Recht, Etymologie, Mythologie, Aufklärung, Christentum.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Der vielschichtige Begriff "Europa"
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text befasst sich umfassend mit dem Begriff "Europa" und analysiert dessen vielschichtige und oft unklar verwendete Bedeutung. Er untersucht verschiedene Definitionsansätze des Begriffs und deren Herausforderungen, insbesondere im politischen Kontext.
Welche Aspekte des Europabegriffs werden behandelt?
Der Text untersucht die Subjektivität des Europabegriffs, seine etymologischen und mythologischen Ursprünge, geographische und historische Definitionsansätze, den Einfluss kultureller Identität auf die Europadefinition sowie aktuelle politische Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Europabegriff (z.B. den EU-Beitritt der Türkei).
Wie wird der Begriff "Europa" etymologisch und mythologisch betrachtet?
Etymologisch wird der Begriff auf semitische und phönizische Wörter für "Abendland" zurückgeführt. Mythologisch wird Europa als Tochter eines phönizischen Königs und ihre Entführung durch Zeus beschrieben, was die Symbolik und die vielfältige Interpretation des Begriffs verdeutlicht.
Welche Rolle spielt die geographische Abgrenzung Europas?
Der Text analysiert die rechtliche Relevanz geographischer Definitionen, insbesondere im Kontext des EU-Rechts. Am Beispiel Herodots wird die historische Entwicklung territorialer Grenzen und die Veränderungen des Europa-Verständnisses im Laufe der Geschichte aufgezeigt.
Welche Bedeutung hat die kulturelle Identität für die Definition Europas?
Der Text untersucht den Begriff der "kulturellen Identität" im Kontext des Europabegriffs und analysiert dessen Verhältnis zum Staat. Die Rolle der Aufklärung und des Christentums als potenzielle Basiselemente einer europäischen kulturellen Identität wird diskutiert.
Welche aktuellen politischen Fragestellungen werden im Zusammenhang mit dem Europabegriff behandelt?
Der Text beleuchtet kritisch den Ansatz einer von einer "Elite" initiierten kulturellen Identität Europas und dessen Auswirkungen. Ein zentraler Punkt ist die Frage des EU-Beitritts der Türkei und die damit verbundene Diskussion über kulturelle Identität und die Kriterien für eine "europäische" Identität.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in diesen?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: A. Subjektivität der Bedeutung des Wortes „Europa“, B. Herkunft des Wortes „Europa“, C. Geographischer Definitionsansatz des „Europabegriffes“, D. Historischer Definitionsansatz des „Europabegriffes“, E. Definitionsansatz auf der Basis der „kulturellen Identität“, F. Betrachtung zweier aktueller politischer Fragestellungen im Zusammenhang mit der „Europa-Definition“ und G. Ergebnis und Schlussfolgerung. Jedes Kapitel befasst sich mit einem spezifischen Aspekt des Europabegriffs, wie im Detail in der Kapitelzusammenfassung beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text am besten?
Schlüsselwörter sind: Europabegriff, Hermeneutik, kulturelle Identität, geographische Abgrenzung, historischer Kontext, EU-Beitritt, Türkei, politische Diskussion, Recht, Etymologie, Mythologie, Aufklärung, Christentum.
Für wen ist dieser Text relevant?
Dieser Text ist relevant für alle, die sich mit dem Begriff "Europa", seiner Geschichte und seiner aktuellen politischen Bedeutung auseinandersetzen möchten. Er ist insbesondere nützlich für Wissenschaftler, Studenten und alle Interessierten, die ein tieferes Verständnis der komplexen Facetten des Europabegriffs erlangen wollen.
- Quote paper
- BBA Christian Spranger (Author), 2006, "Was ist Europa?" Zur Hermeneutik des "Europabegriffs", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58770