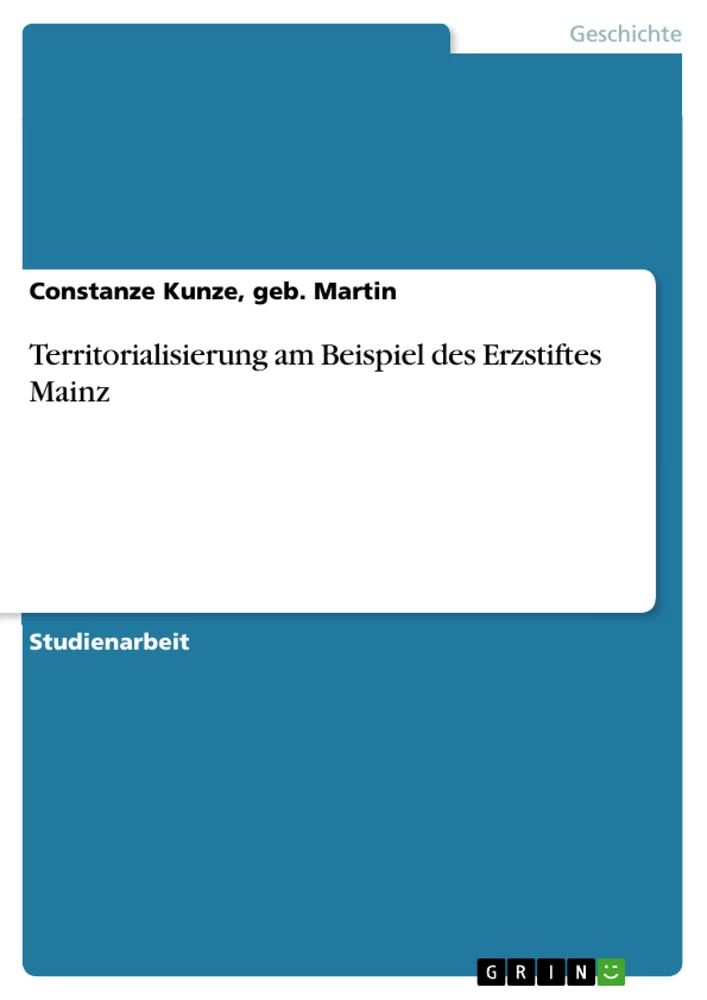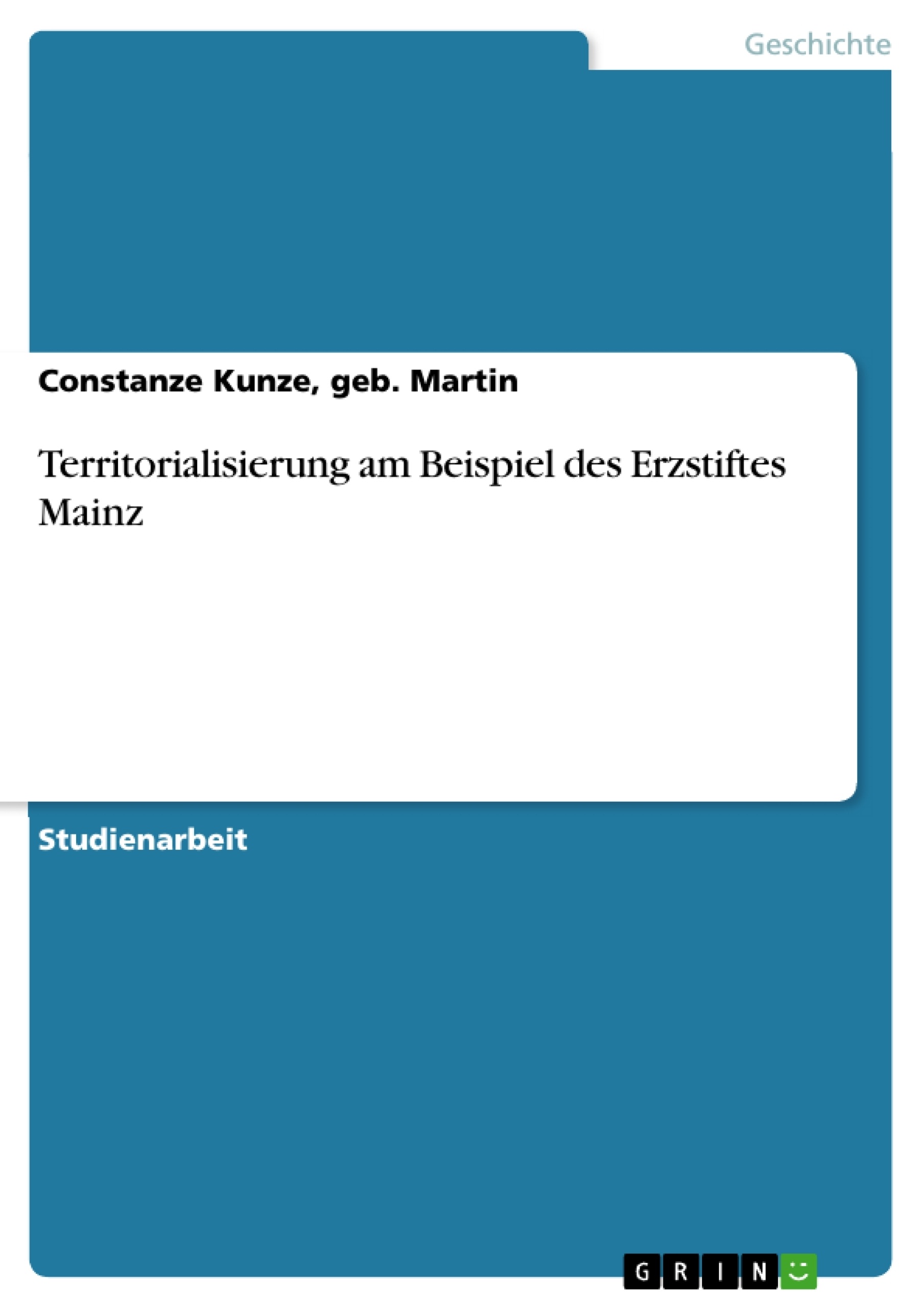Die Geschichte der Stadt Mainz ist wechselhaft. Ihre Kirchengeschichte ist es ebenfalls. Spätestens für die Zeit um 540/50 dürfen Erwähnungen von Mainzer Bischöfen als gesichert gelten. Die Entwicklung des Stiftes Mainz steht in untrennbarem Zusammenhang mit der Entwicklung des Bistums, dessen weltliche Habseligkeiten ersteres zu verwalten, zu betreuen und bisweilen auch zu mehren hatte. So wurde das Bistum 780/1 zum Erzbistum erhoben und mit ihm das Stift zum Erzstift. Die Grundlage allen weltlichherrschaftlichen Handelns des Erzbischofs bildete zunächst „das reiche Kirchengut, über welches das Erzstift schon in karolingischer Zeit“ in Mainz und seiner näheren Umgebung verfügte1. Das Vermögen fußte auf kirchlichem Zehnten, Eigenkirchen und Grundbesitz2. Eine weitere Voraussetzung für das nun folgende territoriale Handeln der Erzbischöfe bestand in der wahrscheinlich unter Bischof Wilhelm (954-968) erlangten Immunität des Mainzer Kirchenbesitzes. Diese machte eine Herauslösung aus zuvor bestehenden Besitzrechten erst möglich, wenn auch kaum anzunehmen ist, dass zu jener Zeit bereits nennenswerte Territorialkomplexe entstanden seien. Viel eher ist davon auszugehen, dass es sich um den für die Zeit üblichen Streubesitz handelte, der keineswegs ein regional homogenes Bild ergeben hätte3.
Inhaltsverzeichnis
- Das Erzstift Mainz - die Anfänge
- Territorialisierung des Erzstiftes
- Bestrebungen des Erzbischofs Adalbert I. (1111-1137)
- Territoriale Entwicklung des Erzstiftes in den Jahren 1137 bis 1200
- Die Gebiete des Erzstifts im 13. Jahrhundert
- Großraum Hessen
- Großraum Thüringen
- Großraum Rhein-Main-Gebiet
- Einfluss Rudolfs von Habsburg
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Territorialisierung des Erzstiftes Mainz, insbesondere die Entwicklung des Herrschaftsgebietes vom frühen Mittelalter bis ins 13. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf den Strategien der Erzbischöfe zur Erweiterung und Konsolidierung ihres Territoriums, sowie dem Einfluss externer Faktoren wie die Politik des Königs.
- Entwicklung des Erzstiftes Mainz von seinen Anfängen bis zum 13. Jahrhundert
- Strategien der Erzbischöfe zur Territorialisierung
- Der Einfluss des Königtums auf die Entwicklung des Erzstiftes
- Die Rolle des Kirchengutes im Prozess der Territorialisierung
- Geographische Ausbreitung des Erzstiftes in verschiedenen Regionen
Zusammenfassung der Kapitel
Das Erzstift Mainz - die Anfänge: Die Geschichte des Erzstiftes Mainz ist eng mit der des Bistums verbunden. Die Anfänge lassen sich bis ins 6. Jahrhundert zurückverfolgen, die Erhebung zum Erzbistum erfolgte um 780/81. Die Grundlage der weltlichen Macht des Erzbischofs bildete das umfangreiche Kirchengut, bestehend aus Zehnten, Eigenkirchen und Grundbesitz. Die unter Bischof Wilhelm (954-968) erlangte Immunität des Mainzer Kirchenbesitzes ermöglichte eine Herauslösung aus bestehenden Besitzrechten. Bemerkenswert ist die Amtszeit von Erzbischof Willigis (975-1011), der das Bistum um Gebiete wie Büraburg und Erfurt erweiterte und die Immunität des Kirchenbesitzes bestätigte. Trotz des Mangels an ausführlichen Quellen wird deutlich, dass die Territorialisierung des Erzstiftes ein langfristiger Prozess war, der auf dem bereits bestehenden Kirchengut aufbaute.
Territorialisierung des Erzstiftes: Dieses Kapitel behandelt die aktive Territorialpolitik der Mainzer Erzbischöfe, beginnend mit Adalbert I. (1111-1137). Territorialisierung wird hier als Bildung zusammenhängender Herrschaftsgebiete definiert, inklusive der Schließung bestehender Lücken. Im Gegensatz zu weltlichen Fürsten konnten die Erzbischöfe nicht von dynastischen Verbindungen profitieren. Ihnen blieben Erwerb, Tausch und Eroberung als Mittel zur Gebietsvergrößerung. Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich den Erzbischöfen bei der Erweiterung ihres Territoriums stellten und analysiert die Grenzen geistlicher Herrschaftsausübung im Vergleich zu weltlicher Macht. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Strategien und den Schwierigkeiten, ein zusammenhängendes Herrschaftsgebiet zu schaffen.
Schlüsselwörter
Erzstift Mainz, Territorialisierung, Erzbischöfe, Kirchengut, Immunität, Gebietsentwicklung, Mittelalter, Herrschaftsansprüche, Rudolf von Habsburg, Heiliges Römisches Reich.
Häufig gestellte Fragen zum Erzstift Mainz: Territorialisierung und Entwicklung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Territorialisierung des Erzstiftes Mainz vom frühen Mittelalter bis ins 13. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf den Strategien der Erzbischöfe zur Gebietsausweitung und -konsolidierung sowie dem Einfluss externer Faktoren wie der königlichen Politik.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Erzstiftes von seinen Anfängen bis ins 13. Jahrhundert, die Strategien der Erzbischöfe zur Territorialisierung, den Einfluss des Königtums, die Rolle des Kirchengutes und die geographische Ausbreitung in verschiedenen Regionen (Hessen, Thüringen, Rhein-Main-Gebiet).
Wie wird die Territorialisierung definiert?
Territorialisierung wird als die Bildung zusammenhängender Herrschaftsgebiete definiert, inklusive der Schließung bestehender Lücken im Herrschaftsgebiet.
Welche Methoden nutzten die Erzbischöfe zur Gebietsausweitung?
Im Gegensatz zu weltlichen Fürsten konnten die Erzbischöfe nicht von dynastischen Verbindungen profitieren. Ihnen standen Erwerb, Tausch und Eroberung als Mittel zur Gebietsvergrößerung zur Verfügung.
Welche Rolle spielte das Kirchengut?
Das umfangreiche Kirchengut (Zehnten, Eigenkirchen, Grundbesitz) bildete die Grundlage der weltlichen Macht des Erzbischofs. Die unter Bischof Wilhelm (954-968) erlangte Immunität des Mainzer Kirchenbesitzes spielte eine entscheidende Rolle für die Herauslösung aus bestehenden Besitzrechten und ermöglichte die Erweiterung des Herrschaftsgebietes.
Welche Bedeutung hatte die Amtszeit von Erzbischof Willigis (975-1011)?
Erzbischof Willigis erweiterte das Bistum um Gebiete wie Büraburg und Erfurt und bestätigte die Immunität des Kirchenbesitzes. Seine Amtszeit unterstreicht die langfristige Entwicklung der Territorialisierung des Erzstiftes.
Welche Herausforderungen gab es bei der Territorialisierung?
Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich den Erzbischöfen bei der Erweiterung ihres Territoriums stellten, und analysiert die Grenzen geistlicher Herrschaftsausübung im Vergleich zu weltlicher Macht. Es wird auf die Schwierigkeiten hingewiesen, ein zusammenhängendes Herrschaftsgebiet zu schaffen.
Welche Rolle spielte Rudolf von Habsburg?
Der Einfluss Rudolfs von Habsburg auf die Gebietsentwicklung des Erzstiftes Mainz wird in der Arbeit untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu den Anfängen des Erzstiftes Mainz, zur Territorialisierung des Erzstiftes (inkl. der Aktivitäten Erzbischof Adalberts I. und der Entwicklung bis ins 13. Jahrhundert) und Schlussbemerkungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Erzstift Mainz, Territorialisierung, Erzbischöfe, Kirchengut, Immunität, Gebietsentwicklung, Mittelalter, Herrschaftsansprüche, Rudolf von Habsburg, Heiliges Römisches Reich.
- Quote paper
- Constanze Kunze, geb. Martin (Author), 2006, Territorialisierung am Beispiel des Erzstiftes Mainz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58754