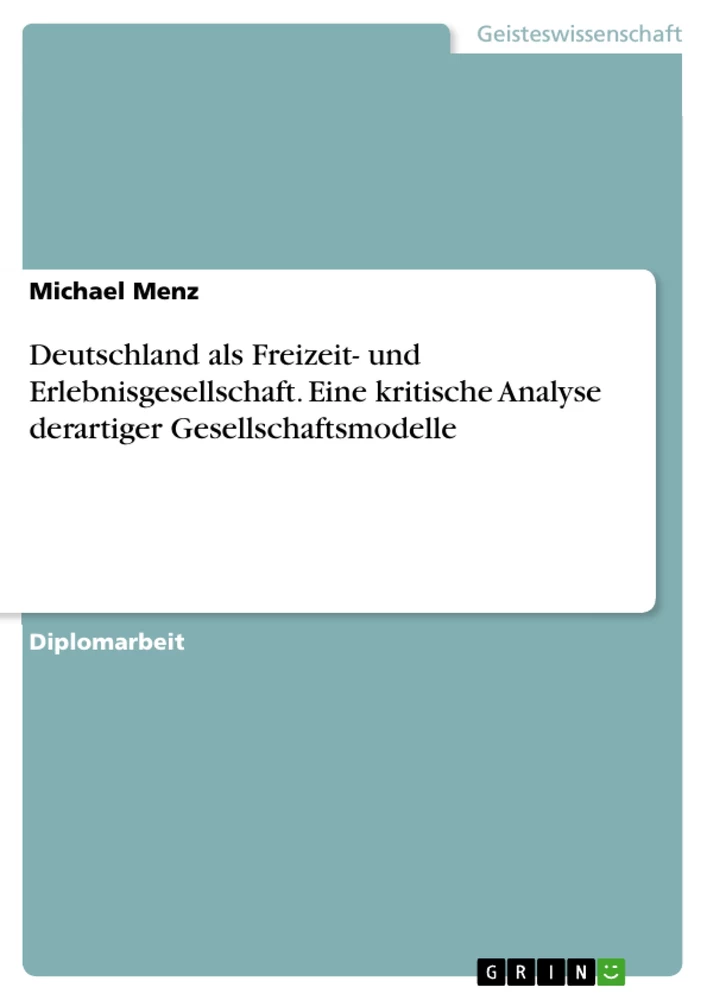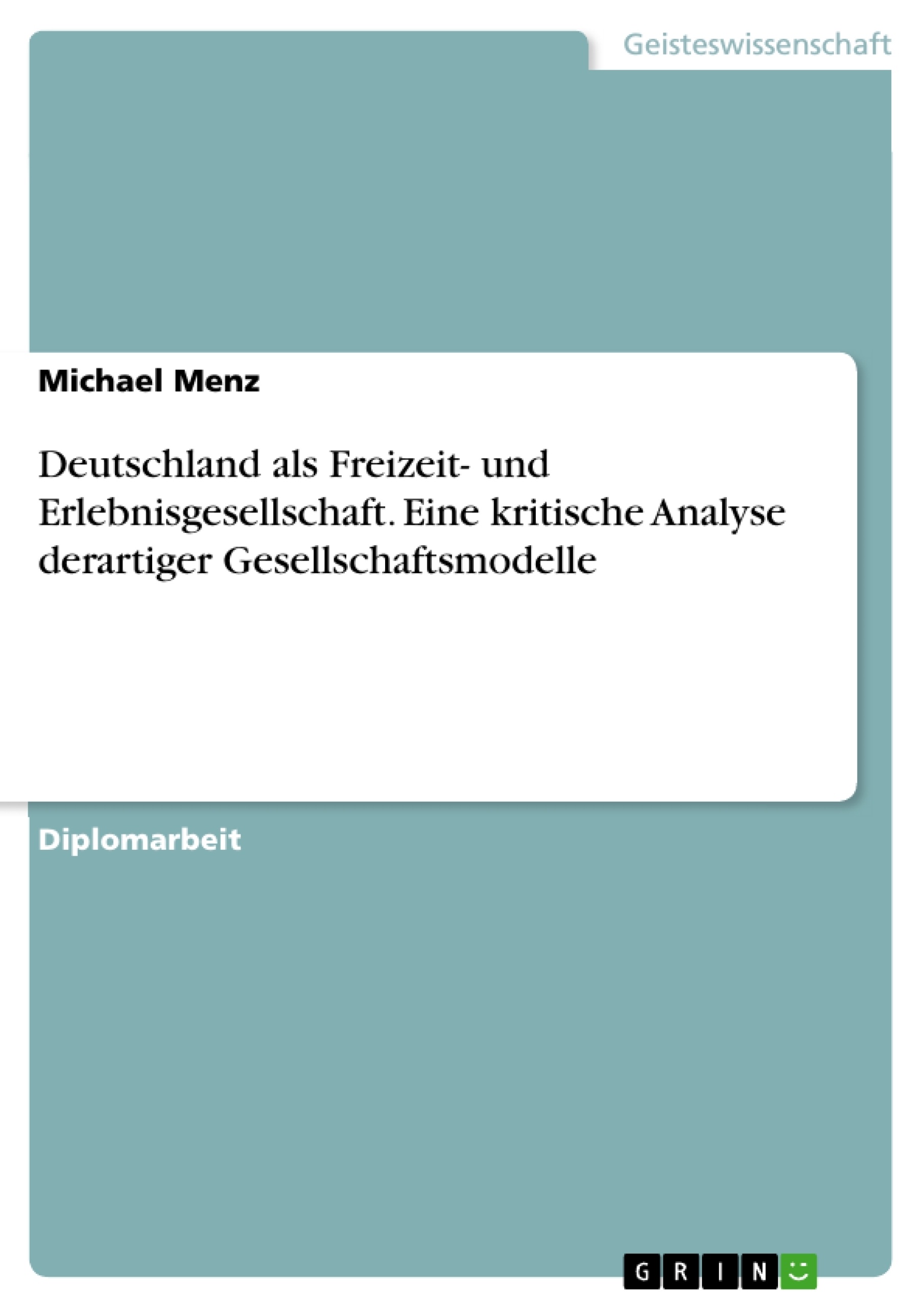Die Diplomarbeit „Deutschland als Freizeit- und Erlebnisgesellschaft“ beschäftigt sich mit der kritischen Analyse zweier Gesellschaftsmodelle, die erkannte gesellschaftliche Phänomene, in Form von zugespitzten Freizeit- und Erlebnisorientierungen, zum Ausgangspunkt machen, um Gesellschaftsbilder zu entwerfen, die eine Bezeichnung der deutschen Gesellschaft als Freizeit- und/oder Erlebnisgesellschaft rechtfertigten.
So wird hier die Erlebnisgesellschaft von Gerhard Schulze mit dem Modell der freizeitorientierten Erlebnisgesellschaft von Horst W. Opaschowski verglichen. Einen wichtigen Ausgangspunkt bildet dabei die Frage, wie beide Theorien, Schulzes Kultursoziologie auf der einen Seite, und Opaschowskis Freizeitsoziologie auf der anderen Seite, unter Anwendung unterschiedlicher empirischer Methoden, zu ähnlichen, auf die Gesamtgesellschaft bezogene Aussagen kommen, wenn es um Schilderungen ausufernder Freizeit- und Erlebnisorientierungen geht.
Gerhard Schulze macht Verbesserungen der objektiven Lebensbedingungen zum Ausgangspunkt seines Lebensstilansatzes, indem diese Faktoren dazu beitrügen, dass sich Handlungsalternativen ausweiteten und subjektive Erlebnisorientierungen verbreiteten, die wiederum kollektiv in entsprechenden Großgruppen wie Deutungsgemeinschaften, Milieus, und Szenen in Erscheinung träten, und entsprechend zu schematisieren seien. Horst W. Opaschowski bezieht sich bei seinen Argumentationen über veränderte objektive Lebensbedingungen, hauptsächlich auf quantitativ zu ermittelnde Zuwächse der Freizeit. Er entwirft einen „ganzheitlichen Lebensansatz“ im Spannungsfeld zwischen Arbeitszeit, Lebenszeit und Freizeit. Eine wesentliche Gemeinsamkeit beider Forscher besteht in dem Umstand, dass sowohl Schulze als auch Opaschowski, von Prämissen einer Wohlstands- und Überflussgesellschaft ausgehen, in der rastlose Erlebnisorientierung, das signifikante Merkmal vielfältiger gesellschaftlicher Ausprägungen darstellte.
Dabei werden aber jeweils Probleme der Knappheit ausgeblendet, da für die Mehrzahl der Gesellschaftsmitglieder behauptet wird, dass sie nahezu mit gleichen Möglichkeiten an der behaupteten Erlebnisgesellschaft partizipieren könnten. Die vorliegende Diplomarbeit zeigt auf, das eine angemessene soziologischen Reflektion, zu einem völlig anderen Gesellschaftskonzept führen muss, als die beiden Autoren vorgeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. DEFINITION UND ENTWICKLUNG DES FREIZEITBEGRIFFS BEI HORST W. OPASCHOWSKI
- 2.1. Vorbemerkung
- 2.2. Historische Entwicklung des Freizeitbegriffs in Deutschland
- 2.3. Grundlagen der Freizeittheorie von Horst W. Opaschowski
- 2.3.1. Definition der Lebenszeit bei Opaschowski: Dispositionszeit, Obligationszeit und Determinationszeit
- 2.3.2. Exkurs:Altagsästhetische Episoden bei Schulze
- 2.3.3. Inhaltliche Komponenten der Freizeit bei Opaschowski
- 2.3.4. Grundbedürfnisse in der Freizeit bei Opaschowski
- 2.4. Differenzierung des Freizeitbegriffs bei Opaschowski
- 2.4.1. Positiver Freizeitbegriff bei Opaschowski
- 2.4.2. Handlungsfelder von Freizeitsituationen
- 2.5. Entwicklung des Freizeitumfangs in Deutschland
- 2.5.1. Historische Entwicklung des Freizeitumfangs
- 2.5.2. Aktuelle Konflikte und Diskrepanzen im Freizeitbewußtsein und Freizeitverhalten breiter Bevölkerungsschichten
- 2.5.3. Kritische Anmerkungen zur Darstellung der Entwicklung des aktuellen Freizeitumfangs bei Opaschowski
- 2.5.4. Widersprüche in der Behauptung gesellschaftlicher Tatbestände
- 2.5.5. Diskrepanzen zwischen tatsächlicher und wahrgenommener Freizeit
- 3. ENTWICKLUNG DES ERLEBNISBEGRIFFS BEI HORST W. OPASCHOWSKI UND GERHARD SCHULZE
- 3.1. Erlebnisorientierung bei Opaschowski
- 3.2. Spaß- und Genußorientierung bei Opaschowski
- 3.3. Definition und Entwicklung des Erlebnisbegriffs bei Gerhard Schulze
- 3.3.1. Definition des Erlebnisbegriffs
- 3.3.2. Subjektbestimmtheit, Reflexion und Unwillkürlichkeit
- 3.3.3. Beziehung von Subjekt und Situation
- 3.3.4. Erlebnisorientierung
- 3.3.5. Probleme der Unsicherheit und Enttäuschung
- 3.3.6. Erlebnisrationalität
- 3.4. Probleme der Erlebnisorientierung und Erlebnisrationalität bei Opaschowski
- 3.4.1. Tendenzen zu Wünschen nach sofortiger Bedürfniserfüllung
- 3.4.2. Tendenzen zu übermäßigem Konsum
- 3.4.3. Tendenzen zu rastlosem Konsum
- 3.4.4. Tendenzen zu exzessivem Konsum
- 3.4.5. Tendenzen zu orientierungslosem Konsum
- 3.4.6. Tendenzen zur Flucht in künstliche Sphären
- 3.5. Kritische Anmerkungen zu Prämissen der Erlebnisorientierungen bei Schulze und Opaschowski
- 4. ALLTAGSÄSTHETISCHE SCHEMATA BEI SCHULZE UND FREIZEITSTILE BEI OPASCHOWSKI
- 4.1. Alltagsästhetik und Stil
- 4.2. Genuß, Distinktion und Lebensphilosophie
- 4.3. Grundlagen zur Generierung alltagsästhetischer Schemata
- 4.4. Freizeitwissenschaft und Lebensstilforschung bei Opaschowski
- 4.5. Hochkulturschema
- 4.6. Trivialschema
- 4.7. Spannungsschema
- 4.8. Bedeutung des Alters
- 4.9. Bedeutung der Bildung
- 4.10. Ermittlung der sozialen Lage unter Kombination der alltagsästhetischen Schemata mit dem Merkmalen Alter und Bildung
- 5. SYSTEMATISCHE UND INHALTLICHE BEZÜGE OPASCHOWSKIS ZU SCHULZES ALLTAGSÄSTHETISCHEN SCHEMATA
- 5.1. Lebenslagen und Lebensphasen bei Opaschowski
- 5.2. Spannungsschema bei Schulze und Opaschowski
- 5.3. Hochkulturschema bei Schulze und Opaschowski
- 5.3.1. Hochkultur bei Schulze
- 5.3.2. Hochkultur bei Opaschowski
- 6. ZWISCHENBILANZ UND AUSBLICK
- 7. MILIEUMODELL BEI SCHULZE
- 7.1. Milieumerkmale
- 7.2. Ältere Milieus bei Schulze
- 7.2.1. Niveaumilieu
- 7.2.2. Integrationsmilieu
- 7.2.3. Harmoniemilieu
- 7.3. Jüngere Milieus bei Schulze
- 7.3.1. Selbstverwirklichungsmilieu
- 7.3.2. Unterhaltungsmilieu
- 8. SZENEMODELL BEI SCHULZE UND ÖFFENTLICHE PRÄSENZ BEI OPASCHOWSKI
- 8.1. Definition von Szenen
- 8.2. Unterschiedliche Arten von Szenen
- 8.2.1. Hochkulturszene
- 8.2.2. Neue Kulturszene
- 8.2.3. Kneipenszene
- 8.3. Folgerungen für die gesellschaftliche Präsenz bestimmter Schemata bzw. Milieus
- 8.4. Öffentliche Präsenz bei Opaschowski
- 8.4.1. Normalkonsumenten
- 8.4.2. Sparkonsumenten
- 8.4.3. Anspruchskonsumenten
- 8.4.4. Anpassungskonsumenten
- 8.4.5. Geltungskonsumenten
- 8.4.6. Luxuskonsumenten
- 8.4.7. Gesellschaftlich relevante Gruppen des Erlebniskonsums bei Opaschowski
- 9. LEBENS- UND FREIZEITSITUATIONEN IN UNTERSCHIEDLICHEN LEBENSLAGEN BEI OPASCHOWSKI
- 9.1. Exkurs: Entstehungsgeschichte von “Einführung in die Freizeitwissenschaft”
- 9.2. Untersuchungsgrundlagen und Aussagen zum typischen Feierabend bzw. dem typischen Wochenende
- 9.2.1. Untersuchungsgrundlagen
- 9.2.2. Typischer, miẞlungener, und gelungener Feierabend
- 9.3. Lebens- und Freizeitsituation jüngerer Generationen bei Opaschowski
- 9.3.1. Lebens- und Freizeitsituation von Jugendlichen
- 9.3.1.1. Lebenssituation Jugendlicher
- 9.3.1.2. Freizeitsituation Jugendlicher
- 9.3.2. Konsequenzen für das Freizeitverhalten Jugendlicher
- 9.3.3. Gemessene jugendliche Freizeittypen
- 9.3.4. Freizeitaktivitäten
- 9.3.5. Querverweise zu Schulzes jungen Milieus
- 9.4. Lebens- und Freizeitsituation von Singles und Alleinlebenden
- 9.4.1. Alleinstehende, Alleinlebene und Singles
- 9.4.2. Unterschiede von Alleinlebenden nach soziodemografischen Merkmalen
- 9.4.2.1. Unterschiede nach dem Geschlecht
- 9.4.2.2. Unterschiede nach dem Alter
- 9.4.2.3. Unterschiede nach der Bildung
- 9.4.2.4. Unterschiede nach dem Einkommen und dem Beruf
- 9.4.2.5. Weitere Querverweise zu Schulzes jüngeren Milieus
- 9.5. Lebens- und Freizeitsituation der älteren Generation
- 9.5.1. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
- 9.5.2. Neues Generationenverständnis
- 9.5.2.1. Die 50plus-Generation (50-64 Jahre)
- 9.5.2.2. Die 65plus-Generation (65 bis 79 Jahre)
- 9.5.2.3. Gesellschaftliche Relevanz möglicher Zweitkarrieren von Senioren
- 9.5.2.4. Die 80plus-Generation (80 Jahre und mehr)
- 9.5.3. Freizeit im Ruhestand
- 9.5.3.1. Übergangsprobleme von der Berufsarbeit zum Ruhestand
- 9.5.3.2. Freizeitempfinden und alltägliches Freizeitverhalten
- 9.5.3.3. Typischer, gelungener, mißlungener Ruhestand
- 9.5.3.4. Diskrepanzen zwischen Freizeiterwartungen und tatsächlichen Freizeitaktivitäten
- 9.5.3.5. Soziodemografisch bedingte Unterschiede
- 9.5.3.6. Gesellschaftliche Folgerungen
- 9.5.3.7. Querverweise zu Schulzes älteren Milieus
- Definition und Entwicklung des Freizeitbegriffs bei Opaschowski
- Entwicklung des Erlebnisbegriffs bei Opaschowski und Schulze
- Alltagsästhetische Schemata bei Schulze und Freizeit-Stile bei Opaschowski
- Systematische und inhaltliche Beziehungen zwischen Opaschowski und Schulzes Modellen
- Lebens- und Freizeitsituationen in unterschiedlichen Lebenslagen bei Opaschowski
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert kritisch die Konzepte von "Freizeit- und Erlebnisgesellschaft", wie sie von Horst W. Opaschowski und Gerhard Schulze geprägt wurden. Sie beleuchtet die Entstehung und Entwicklung dieser Konzepte, ihre zentralen Thesen und die damit verbundenen problematischen Tendenzen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dieser Arbeit bietet eine Einführung in das Thema "Deutschland als Freizeit- und Erlebnisgesellschaft" und skizziert den Forschungsstand.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Definition und Entwicklung des Freizeitbegriffs im Werk von Horst W. Opaschowski. Es werden die zentralen Thesen und die wissenschaftlichen Grundlagen seines Konzepts erörtert.
Das dritte Kapitel untersucht die Entwicklung des Erlebnisbegriffs im Werk von Opaschowski und Schulze. Es werden die Definitionen und die problematischen Tendenzen der Erlebnisorientierung dargestellt.
Das vierte Kapitel untersucht die alltagsästhetischen Schemata von Schulze und die Freizeit-Stile bei Opaschowski. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Ansätze beleuchtet.
Das fünfte Kapitel analysiert die systematischen und inhaltlichen Beziehungen zwischen Opaschowski und Schulzes Modellen.
Das sechste Kapitel beleuchtet Lebens- und Freizeitsituationen in unterschiedlichen Lebenslagen bei Opaschowski, insbesondere hinsichtlich der Generationen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Konzepte von Freizeit- und Erlebnisgesellschaft, die von Horst W. Opaschowski und Gerhard Schulze geprägt wurden. Zentrale Themen sind die Definition des Freizeitbegriffs, die Entwicklung des Erlebnisbegriffs, die Analyse alltagsästhetischer Schemata und die Betrachtung von Lebensstilen. Darüber hinaus werden die Auswirkungen dieser Konzepte auf die Gesellschaft, insbesondere auf verschiedene Generationen und Lebensphasen, beleuchtet.
- Quote paper
- Diplom - Soziologe Michael Menz (Author), 2002, Deutschland als Freizeit- und Erlebnisgesellschaft. Eine kritische Analyse derartiger Gesellschaftsmodelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58733