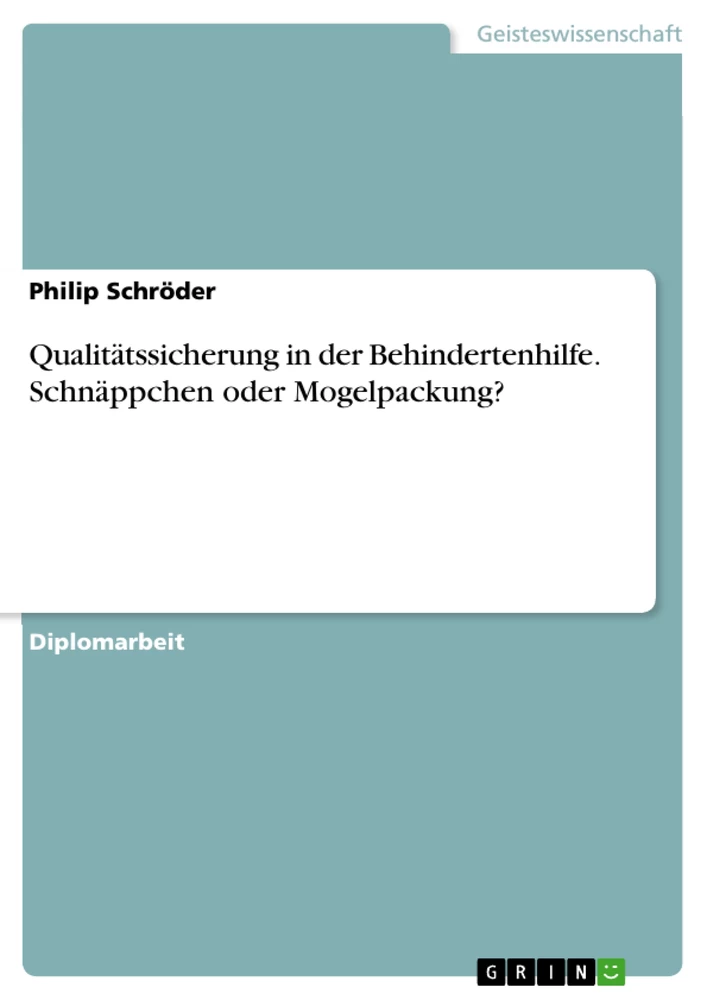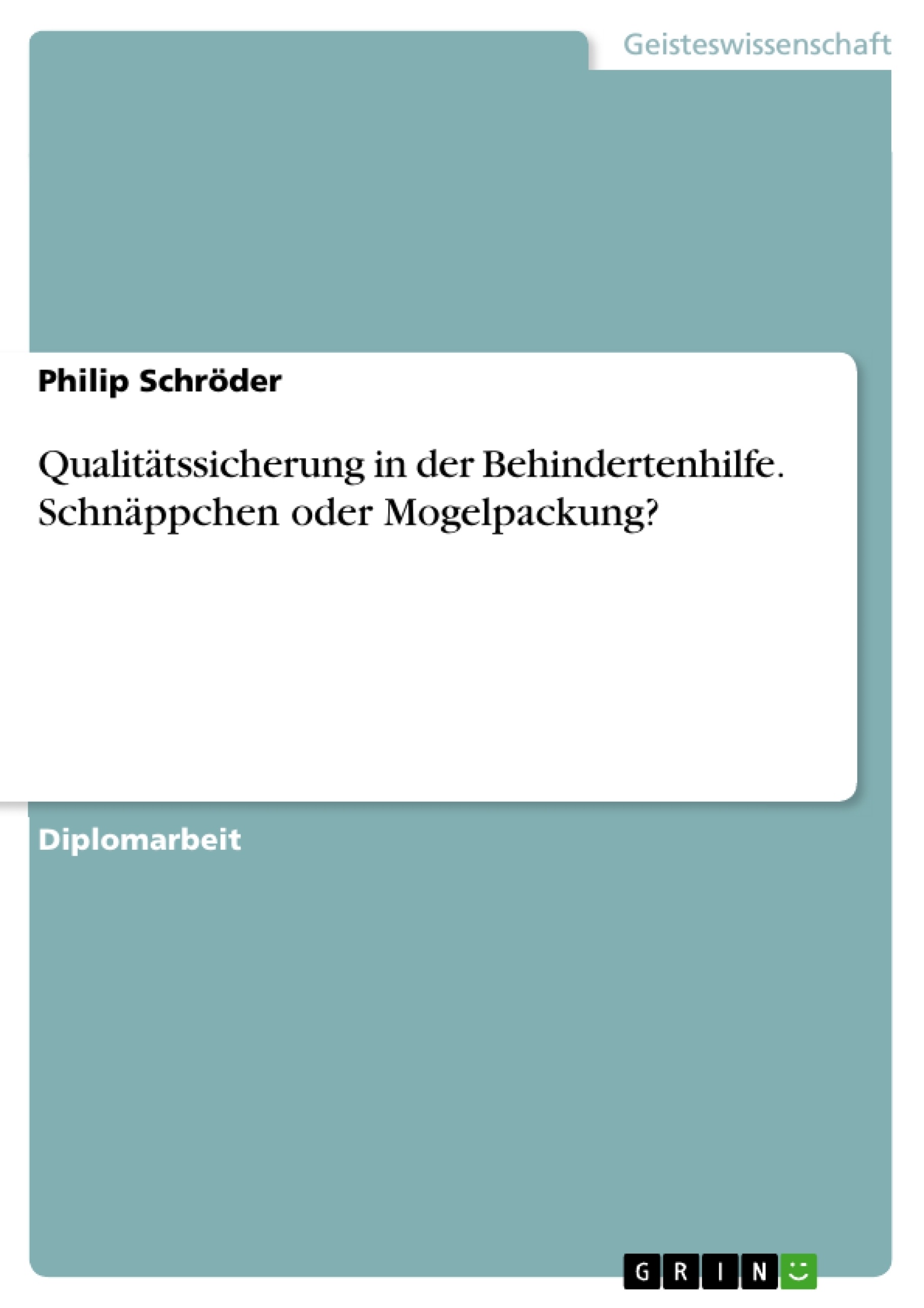Bis zur massiven wirtschaftlichen Rezession in den frühen Neunzigern war sozialen Diensten der ›Luxus‹ vergönnt, sich ohne prinzipielle ökonomische Erwägungen an ihren Leitprinzipien und fachlichen Erkenntnissen und an den Bedürfnissen der betroffenen Menschen orientieren zu können.
Spätestens seit der Novellierung der §§ 93 ff des Bundessozialhilfegesetzes (Kostenübernahme von Einrichtungen) im Jahre 1999 sind ›Qualitätssicherung‹ und ›Qualitätsmanagement‹ zu unumgänglichen Schlüsselbegriffen in der Sozialen Arbeit geworden. Auch den Institutionen und Mitarbeitern, die bislang der Diskussion über Qualitätsmanagement in der Sozialarbeit eher reserviert bis ablehnend gegenüberstanden und darin mehr eine vorübergehende Modeerscheinung sahen, bleibt mittlerweile nichts anderes mehr übrig, als die Auseinandersetzung mit Qualitätssicherungskonzepten als existentielle Notwendigkeit hinzunehmen.
Infolge der geänderten gesetzlichen Anforderungen haben sich im gesamten Feld der sozialen Einrichtungen die Rahmenbedingungen hinsichtlich Finanzierung und Legitimation der geleisteten Arbeit erheblich gewandelt. In den Vordergrund treten unaufhaltsam neue und fachfremde Werte, vornehmlich ökonomischen Ursprungs, wie Produktivität, Wettbewerb oder Effizienz. Auch soziale Dienstleistungen werden nun privatisiert und dem Wettbewerb des Marktes ausgesetzt.
Die immer augenfälliger werdenden Kontraste und Widersprüche lassen daran zweifeln, dass marktwirtschaftliche Bedingungen für den Bereich der karitativen Tätigkeiten zu wünschenswerten Verhältnissen führen.
Mit der vorliegenden Arbeit versucht der Autor, offensichtliche Schwierigkeiten, Widersprüche und mögliche Verschleierungen im Zusammenhang mit Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung in Institutionen der Behindertenhilfe – insbesondere aus Sicht und Interessenlage geistig behinderter Menschen – offenzulegen und einen Beitrag zur Entwicklung klientenzentrierter Qualitätskriterien zu leisten.
Philip Schröder (Jahrgang 1969) ist seit 1989 in der praktischen Behindertenhilfe tätig und hat mit der vorliegenden Arbeit sein Diplom als Sozialpädagoge erlangt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 1.1 Zentraler Auftrag von Einrichtungen der Behindertenhilfe
- 1.2 Behindertenhilfe und soziale Sicherung
- 1.3 Notwendigkeit der Implementierung von QS-Maßnahmen
- 1.4 Dynamik der Übernahme eines QM-Systems
- 2. Leitbilder der Behindertenhilfe im Wandel der Geschichte
- 2.1 Historische Entwicklung
- 2.2 Das Normalisierungsprinzip
- 2.3 Integration
- 2.4 Selbstbestimmtes Leben
- 2.5 Vom Klienten zum Bürger
- 2.6 Legitimation der >Selbstbestimmt-leben-Forderung<
- 3. Qualitätssicherung und marktwirtschaftliche Entwicklung in der sozialen Arbeit
- 3.1 Gesetzliche Vorläufer als Grundlagen von Qualitätssicherung in der Behindertenhilfe
- 3.2 Novellierung des § 93 BSHG
- 4. Qualitätsentwicklung, -sicherung und -management in der Behindertenhilfe
- 4.1 Ziele und Methoden von Qualitätssicherung in der Behindertenhilfe
- 4.2 DIN EN ISO 9000 ff.
- 4.3 Bereits bekannte Verfahren der Standardisierung
- 4.4 Ermittlung des Hilfebedarfes nach METZLER
- 4.5 Externe Organisations- und Personalberater
- 5. Probleme von Markt, Wettbewerb und Standardisierung in der Behindertenhilfe
- 5.1 Der Wert des Ökonomischen kontra Humanität
- 5.2 Der >Kundenbegriff< – Chance oder Euphemismus?
- 5.3 Probleme der Standardisierung im Sozialen Bereich
- 5.4 >Qualitätszirkus‹ als Mittel zur individuellen beruflichen Aufwertung
- 5.5 Erfahrungen von QS und Ökonomisierung im sozialen Bereich
- 5.6 Die Qualitätsdiskussion als Vorwand für Ökonomisierung?
- 6. Praktische Erfahrungen mit Auswirkungen von Qualitätssicherung
- 6.1 Erheblicher zeitlicher Mehraufwand einzelner Maßnahmen kontra individuelle Betreuungszeit
- 7. Forderungen an ein sinnvolles QM-System
- 7.1 Besonderheiten von Beziehungsdienstleistungen und sozialer Qualität
- 7.2 Notwendigkeit permanenter Qualitätsentwicklung
- 7.3 Individualisierung statt Standardisierung
- 7.4 Integration und Partizipation im Qualitätsmanagement-Konzept
- 7.5 Ethische Grundlagen sozialer Arbeit
- 7.6 Fachlich und moralisch orientierte Qualitätsentwicklung kontra ökonomisch dominantem QM
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Auswirkungen der Ökonomisierung auf die Qualität der stationären Behindertenhilfe und beleuchtet die Auswirkungen von Qualitätssicherungsmaßnahmen auf das Paradigma der Selbstbestimmung. Sie hinterfragt die Vereinbarkeit von Marktwirtschaft und Menschenwürde im Kontext der Behindertenhilfe.
- Entwicklung des Konzepts der Selbstbestimmung in der Behindertenhilfe
- Einfluss von Qualitätssicherungsmaßnahmen auf die Praxis der Behindertenhilfe
- Kritische Analyse der Auswirkungen von Ökonomisierung auf die Qualität der Behindertenhilfe
- Entwicklung von Forderungen für ein sinnvolles Qualitätsmanagement-System in der Behindertenhilfe
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt den zentralen Auftrag von Einrichtungen der Behindertenhilfe, den Stellenwert der Behindertenhilfe im Sozialstaat und die Notwendigkeit der Implementierung von Qualitätssicherungsmaßnahmen dar.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel zeichnet die historische Entwicklung von Leitbildern der Behindertenhilfe nach, von der Erbkrankheits- und Versorgungsperspektive bis hin zum Konzept des selbstbestimmten Lebens.
- Kapitel 3: Hier werden die gesetzlichen Grundlagen der Qualitätssicherung in der Behindertenhilfe beleuchtet, insbesondere die Novellierung des § 93 BSHG.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel befasst sich mit Zielen und Methoden der Qualitätssicherung in der Behindertenhilfe, einschließlich der Einführung von DIN EN ISO 9000 ff. und bekannter Verfahren der Standardisierung.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel untersucht die Probleme von Markt, Wettbewerb und Standardisierung in der Behindertenhilfe und analysiert den Konflikt zwischen ökonomischen und humanistischen Werten.
- Kapitel 6: Dieses Kapitel schildert praktische Erfahrungen mit den Auswirkungen von Qualitätssicherungsmaßnahmen in der Behindertenhilfe und zeigt den erheblichen zeitlichen Mehraufwand einzelner Maßnahmen auf.
- Kapitel 7: Hier werden Forderungen für ein sinnvolles Qualitätsmanagement-System in der Behindertenhilfe formuliert, das sich an den Bedürfnissen der Menschen mit Behinderung orientiert und den Fokus auf soziale Qualität legt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Behindertenhilfe, darunter Selbstbestimmung, Qualitätssicherung, Ökonomisierung, Marktwirtschaft, Standardisierung, Individualisierung, Qualitätsmanagement und soziale Qualität. Sie fokussiert auf die Auswirkungen von Qualitätssicherungsmaßnahmen auf die Praxis der Behindertenhilfe und analysiert kritisch die Auswirkungen der Ökonomisierung auf die Qualität der erbrachten Leistungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat die Ökonomisierung die Behindertenhilfe verändert?
Durch gesetzliche Änderungen (wie die Novellierung des BSHG) rückten Werte wie Produktivität und Wettbewerb in den Vordergrund, was oft im Widerspruch zu pädagogischen Leitprinzipien steht.
Was bedeutet das „Normalisierungsprinzip“?
Es ist ein Leitbild, das fordert, Menschen mit Behinderung ein Leben zu ermöglichen, das so weit wie möglich den Lebensbedingungen nicht-behinderter Menschen entspricht.
Welche Kritik gibt es am Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9000?
Kritiker bemängeln, dass diese industriellen Standards die Besonderheiten zwischenmenschlicher Beziehungsdienstleistungen nicht ausreichend berücksichtigen und zu einer Standardisierung führen, die Individualität unterdrückt.
Ist der Begriff „Kunde“ in der Behindertenhilfe passend?
Die Arbeit hinterfragt, ob die Bezeichnung von Menschen mit geistiger Behinderung als „Kunden“ eine echte Chance zur Selbstbestimmung bietet oder lediglich ein ökonomischer Euphemismus ist.
Was fordert der Autor für ein sinnvolles QM-System?
Gefordert wird eine fachlich und moralisch orientierte Qualitätsentwicklung, die Partizipation und Individualisierung in den Mittelpunkt stellt, statt rein ökonomischer Effizienz.
- Quote paper
- Dipl. Soz. Päd. Philip Schröder (Author), 2003, Qualitätssicherung in der Behindertenhilfe. Schnäppchen oder Mogelpackung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58715