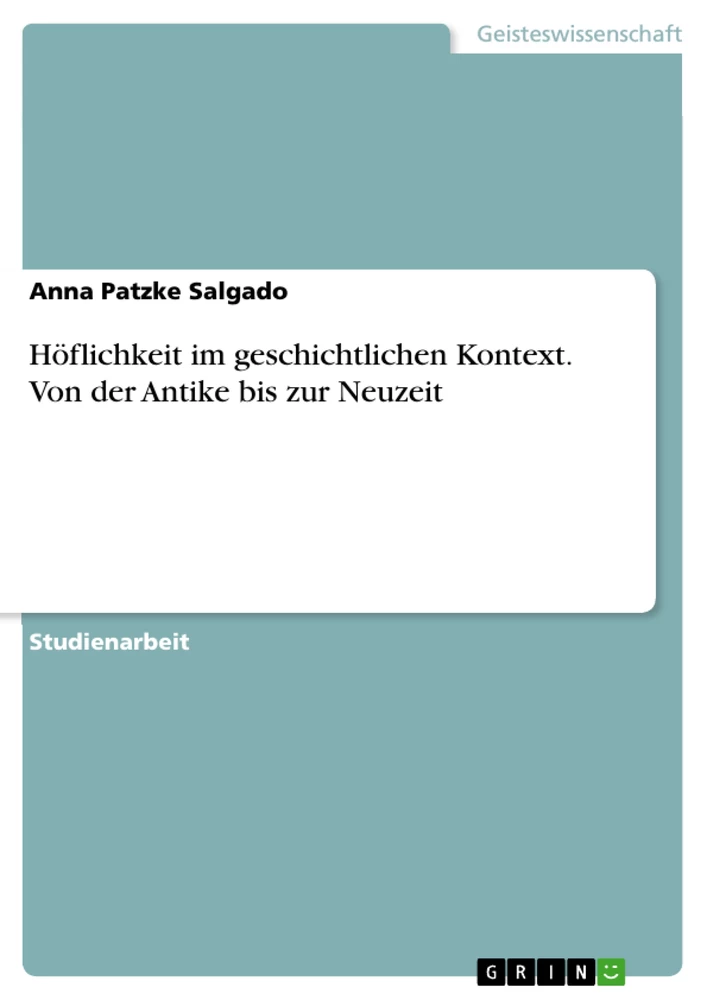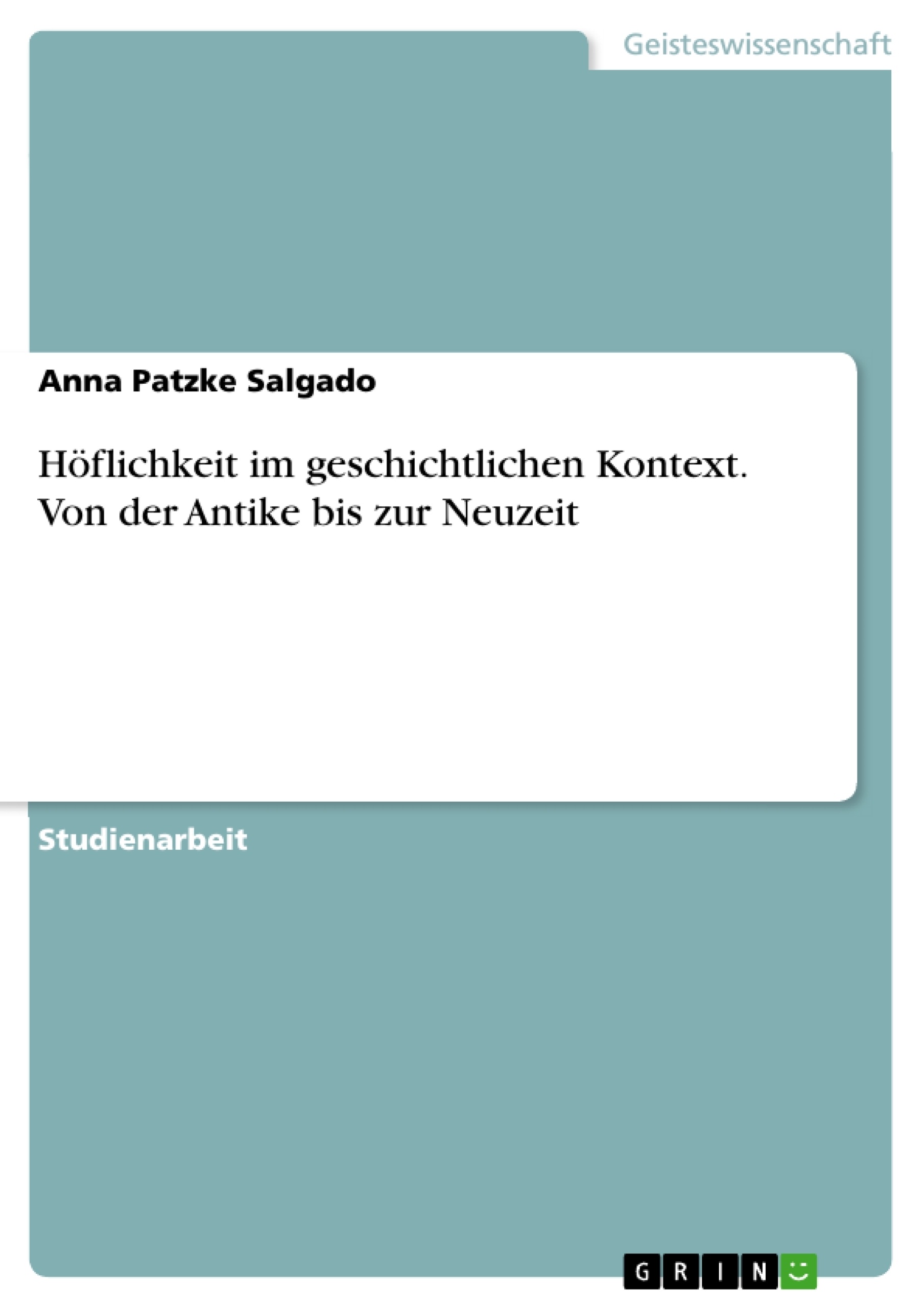Höflichkeit ist ein weit gefächerter Begriff, dem in verschiedenen Epochen und verschiedenen Kulturen andere Bedeutungen zugeschrieben wurden. Cicero entwickelte Konzepte für das menschliche Zusammenleben innerhalb einer Gesellschaft, wie unter anderem Regelungen innerhalb des Stadtlebens, Feinheit in Rede und Gesprächsnormen, aber auch Höflichkeit und Umgänglichkeit. Ciceros Konzept wurde später verändert und im höfischen Mittelalter verwendet, um eine obere Schichtzugehörigkeit zu verdeutlichen. Im 15. und 16. Jahrhundert weicht der Begriff der Höflichkeit von den Verhaltensregeln bei Hofe ab und besinnt sich auf den antiken Humanismus, aus welchem sich die bürgerlichen Werte der Erziehung, Bildung, Höflichkeit und Zivilisation entwickeln. Diese Verhaltensregeln der Höflichkeit werden daraufhin erweitert, bis sie im französischen Absolutismus durch ihre Überspitzung verfälscht werden und somit ihren Zweck verfehlen. Mit Hilfe der Aufklärung im 18. Jahrhundert entwickelt sich eine Gegenrichtung zu der übertriebenen Verhaltensordnung im Absolutismus. Es entwickeln sich liberal-demokratische Gesellschaftsformen, welche die verpönten Feudalgesellschaften ablösen. Ein weiterer Wandel des Inhaltes von „Höflichkeit“ vollzieht sich im 19. Jahrhundert. Feinsinnigkeit und bedachtes Handeln im zwischenmenschlichen Umgang rücken hier in den Mittelpunkt. Adolph Freiherr von Knigge verfasste zu dieser Zeit Schriftstücke, welche eine „allgemeine Moral“ und Fragen von Höflichkeit im Umgang mit dem anderen Geschlecht sowie Pflichten und Freiheiten beinhalteten. Der Höflichkeitsbegriff verändert sich grundlegend zur Zeit des Nationalsozialismus. Höflichkeit und Tugend werden hier als Gehorsam und korrektes Verhalten der Staatsmacht gegenüber betrachtet. Nach dem 2. Weltkrieg zerfällt diese Bedeutung von Höflichkeit und alte Sitten und Regeln werden modern. In den 68gern beruft sich die Höflichkeit auf „Natürlichkeit“ und „authentischen Verhalten“, welche die überkommenen Rituale und Konventionen der Höflichkeit abzulösen versucht. Dennoch besinnt sich Höflichkeit in der heutigen Zeit wieder auf Regeln und Verhaltensnormen, welche im Umgang mit Menschen immer wichtiger zu werden scheinen. Höflichkeit dient dabei als Basis zwischen den verschiedenen Interessengruppen und Verhaltensmustern in der Gesellschaft zu kommunizieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Selbstinszenierung im Mittelalter
- Bildung von Gemeinschaft im 15. und 16. Jahrhundert
- Bildung von Gesellschaft im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert
- Geschichtlicher Hintergrund
- Der Gebrauch von „Höflichkeit“ im 17. und frühen 18. Jahrhundert
- Die Bedeutung von Höflichkeit
- Die Bedeutung von Freiheit
- Shaftesbury
- Shaftesbury im geschichtlichen Kontext
- Entstehung der Feinsinnigkeit im 19. Jahrhundert
- Die Wahrung des Gesichts im 20. Jahrhundert
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Entwicklung des Begriffs „Höflichkeit“ von der Antike bis zur Neuzeit. Ziel ist es, die Wandelnde Bedeutung von Höflichkeit in verschiedenen Epochen und Kulturen aufzuzeigen und deren Relevanz für das heutige Verständnis von sozialen Interaktionen zu beleuchten.
- Die historische Entwicklung des Höflichkeitbegriffes
- Der Einfluss gesellschaftlicher Strukturen auf die Definition von Höflichkeit
- Die Rolle von Höflichkeit in der Selbstinszenierung und im sozialen Aufstieg
- Die Bedeutung von Höflichkeit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
- Die Veränderung des Höflichkeitbegriffes im 20. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erklärt die Notwendigkeit, die Entwicklung des Höflichkeitbegriffes im historischen Kontext zu betrachten, um dessen heutige Bedeutung zu verstehen. Sie skizziert die Veränderungen des Begriffs von Cicero bis zur Gegenwart und hebt die sich ändernden sozialen und politischen Kontexte hervor, die die Definition und Anwendung von Höflichkeit beeinflusst haben. Die Einleitung begründet die Notwendigkeit einer historischen Analyse, um ein tieferes Verständnis von Höflichkeit zu ermöglichen.
Selbstinszenierung im Mittelalter: Dieses Kapitel analysiert die Rolle von Kleidung und Gesten als Mittel der Selbstinszenierung im Mittelalter. Es wird dargelegt, wie Herrscher durch ihr Auftreten – trotz möglicher Diskrepanzen zur idealisierten Vorstellung – ihre Legitimität und Macht demonstrierten. Das Kapitel betont die Bedeutung der aristokratischen Selbstdarstellung durch Herrschaftszeichen, Kleidung, Gestus und Rhetorik für die Akzeptanz durch das Volk und den Erhalt der gesellschaftlichen Ordnung. Das Verhalten des Herrschers in der Öffentlichkeit wird als Vorbildfunktion hervorgehoben, wobei die strikte Trennung von öffentlichem und privatem Verhalten betont wird, um den Anschein von Heuchelei zu vermeiden.
Bildung von Gemeinschaft im 15. und 16. Jahrhundert: Das Kapitel beschreibt den Wandel des Höflichkeitbegriffes im 15. und 16. Jahrhundert, der sich vom Hofzeremoniell abwendet und sich auf den antiken Humanismus bezieht. Es wird gezeigt, wie bürgerliche Werte wie Erziehung, Bildung und Zivilisation mit dem Begriff der Höflichkeit verbunden werden. Die Erweiterung der Verhaltensregeln der Höflichkeit in dieser Epoche wird dargestellt, im Gegensatz zu der späteren Verfälschung im französischen Absolutismus.
Bildung von Gesellschaft im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss des französischen Absolutismus und der Aufklärung auf den Höflichkeitbegriff. Es wird beschrieben, wie die übertriebenen Verhaltensregeln des Absolutismus ihren Zweck verfehlten und wie die Aufklärung eine Gegenrichtung zu dieser Entwicklung einleitete. Der Wandel hin zu liberal-demokratischen Gesellschaftsformen wird beleuchtet, und die Entwicklung einer komplexeren, humaneren Form von Höflichkeit im England des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts wird im Kontext der städtischen Tradition und ihrer Einbeziehung politischer, sozialer und kultureller Aspekte dargestellt.
Entstehung der Feinsinnigkeit im 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Wandel im 19. Jahrhundert, wo Feinsinnigkeit und bedachtes Handeln im zwischenmenschlichen Umgang im Vordergrund stehen. Die Schriften Adolph von Knigge werden als Beispiel für eine „allgemeine Moral“ mit Aspekten von Höflichkeit, Umgang mit dem anderen Geschlecht und Fragen von sozialer Nähe und Distanz herangezogen. Das Kapitel beleuchtet die komplexeren Anforderungen an höfliches Benehmen in dieser Epoche.
Die Wahrung des Gesichts im 20. Jahrhundert: Der Abschnitt beschreibt die Entwicklung des Höflichkeitbegriffes im 20. Jahrhundert, von einer sarkastischen Sichtweise auf die „feine Gesellschaft“ bis hin zu dessen Umdeutung im Nationalsozialismus als Gehorsam gegenüber der Staatsmacht. Die darauf folgende Modernisierung und die Entwicklung im Kontext der 60er-Jahre mit dem Fokus auf „Natürlichkeit“ und „authentisches Verhalten“ werden dargestellt. Der Abschnitt endet mit der erneuten Betonung von Regeln und Verhaltensnormen im Umgang mit Menschen als essentiell für die Kommunikation und das Funktionieren der Gesellschaft, wobei die Arbeiten von Levinson und Brown bezüglich der „Gesichtswahrung“ hervorgehoben werden.
Schlüsselwörter
Höflichkeit, Geschichte, Gesellschaft, soziale Interaktion, Selbstinszenierung, Mittelalter, Humanismus, Aufklärung, Absolutismus, Feinsinnigkeit, Gesichtswahrung, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Die Entwicklung des Höflichkeitbegriffes
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die historische Entwicklung des Begriffs „Höflichkeit“ von der Antike bis zur Moderne. Sie analysiert die Wandelnde Bedeutung von Höflichkeit in verschiedenen Epochen und Kulturen und beleuchtet deren Relevanz für das heutige Verständnis sozialer Interaktionen.
Welche Epochen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit betrachtet die Entwicklung des Höflichkeitbegriffes über verschiedene Epochen hinweg: Mittelalter, 15./16. Jahrhundert, 17./18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert. Dabei werden jeweils die spezifischen gesellschaftlichen und kulturellen Kontexte berücksichtigt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die historische Entwicklung des Höflichkeitbegriffes, der Einfluss gesellschaftlicher Strukturen auf dessen Definition, die Rolle von Höflichkeit in der Selbstinszenierung und im sozialen Aufstieg, die Bedeutung von Höflichkeit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die Veränderungen des Begriffs im 20. Jahrhundert.
Wie wird die Entwicklung des Höflichkeitbegriffes im Mittelalter dargestellt?
Das Mittelalter wird unter dem Aspekt der Selbstinszenierung betrachtet. Es wird analysiert, wie Herrscher durch Kleidung und Gesten ihre Legitimität und Macht demonstrierten, und wie wichtig die aristokratische Selbstdarstellung für die Akzeptanz durch das Volk war. Die strikte Trennung von öffentlichem und privatem Verhalten wird hervorgehoben.
Wie beschreibt die Hausarbeit den Wandel des Höflichkeitbegriffes im 15. und 16. Jahrhundert?
Dieses Kapitel zeigt den Wandel vom Hofzeremoniell hin zu einer Verbindung bürgerlicher Werte wie Erziehung, Bildung und Zivilisation mit dem Begriff der Höflichkeit. Die Erweiterung der Verhaltensregeln wird dargestellt, im Gegensatz zu der späteren Verfälschung im französischen Absolutismus.
Welche Rolle spielt der französische Absolutismus und die Aufklärung in der Hausarbeit?
Das 17./18. Jahrhundert wird im Kontext des französischen Absolutismus und der Aufklärung betrachtet. Es wird analysiert, wie die übertriebenen Verhaltensregeln des Absolutismus ihren Zweck verfehlten und wie die Aufklärung eine Gegenrichtung einleitete. Der Wandel hin zu liberal-demokratischen Gesellschaftsformen und die Entwicklung einer humaneren Form von Höflichkeit in England werden beleuchtet.
Wie wird der Höflichkeitbegriff im 19. Jahrhundert beschrieben?
Das 19. Jahrhundert wird durch den Fokus auf Feinsinnigkeit und bedachtes Handeln im zwischenmenschlichen Umgang charakterisiert. Die Schriften Adolph von Knigge dienen als Beispiel für eine „allgemeine Moral“ mit Aspekten von Höflichkeit, Umgang mit dem anderen Geschlecht und Fragen sozialer Nähe und Distanz.
Wie entwickelt sich der Höflichkeitbegriff im 20. Jahrhundert?
Der 20. Jahrhundert wird von einer sarkastischen Sichtweise auf die „feine Gesellschaft“ bis hin zur Umdeutung im Nationalsozialismus als Gehorsam gegenüber der Staatsmacht betrachtet. Die Entwicklung im Kontext der 60er-Jahre mit dem Fokus auf „Natürlichkeit“ und „authentisches Verhalten“ und die erneute Betonung von Regeln und Verhaltensnormen werden dargestellt. Die Arbeiten von Levinson und Brown bezüglich der „Gesichtswahrung“ werden hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Höflichkeit, Geschichte, Gesellschaft, soziale Interaktion, Selbstinszenierung, Mittelalter, Humanismus, Aufklärung, Absolutismus, Feinsinnigkeit, Gesichtswahrung, Kommunikation.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der Kapitel?
Die Hausarbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, die die Kernaussagen und die behandelten Aspekte jedes Abschnitts beschreibt. Diese Zusammenfassungen bieten einen Überblick über den Inhalt und die Argumentationslinie der gesamten Arbeit.
- Quote paper
- Anna Patzke Salgado (Author), 2005, Höflichkeit im geschichtlichen Kontext. Von der Antike bis zur Neuzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58587