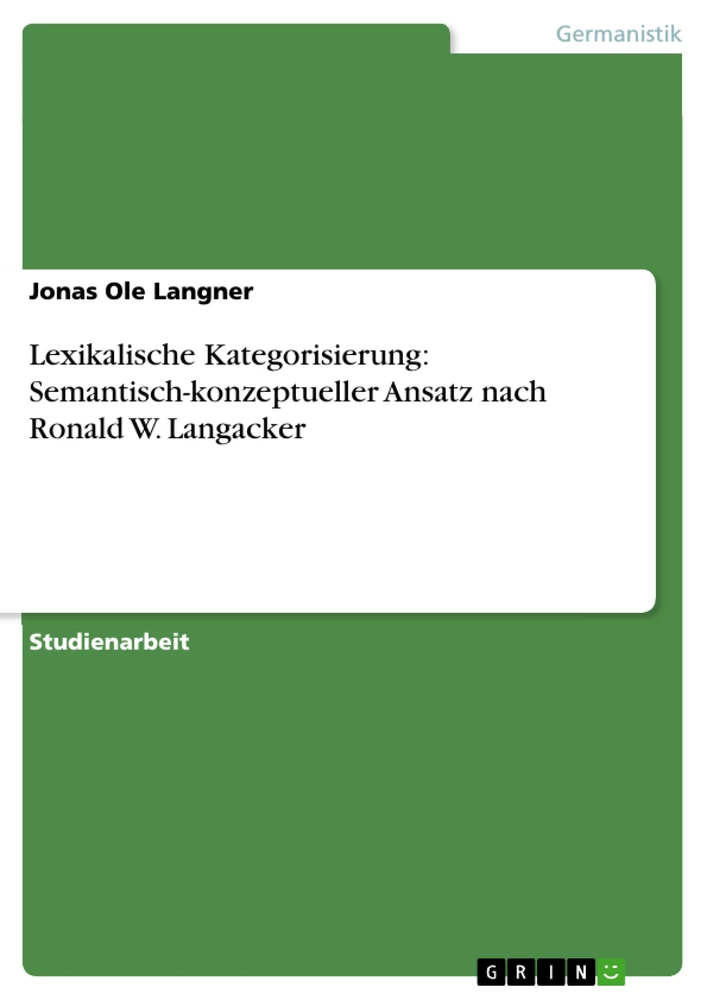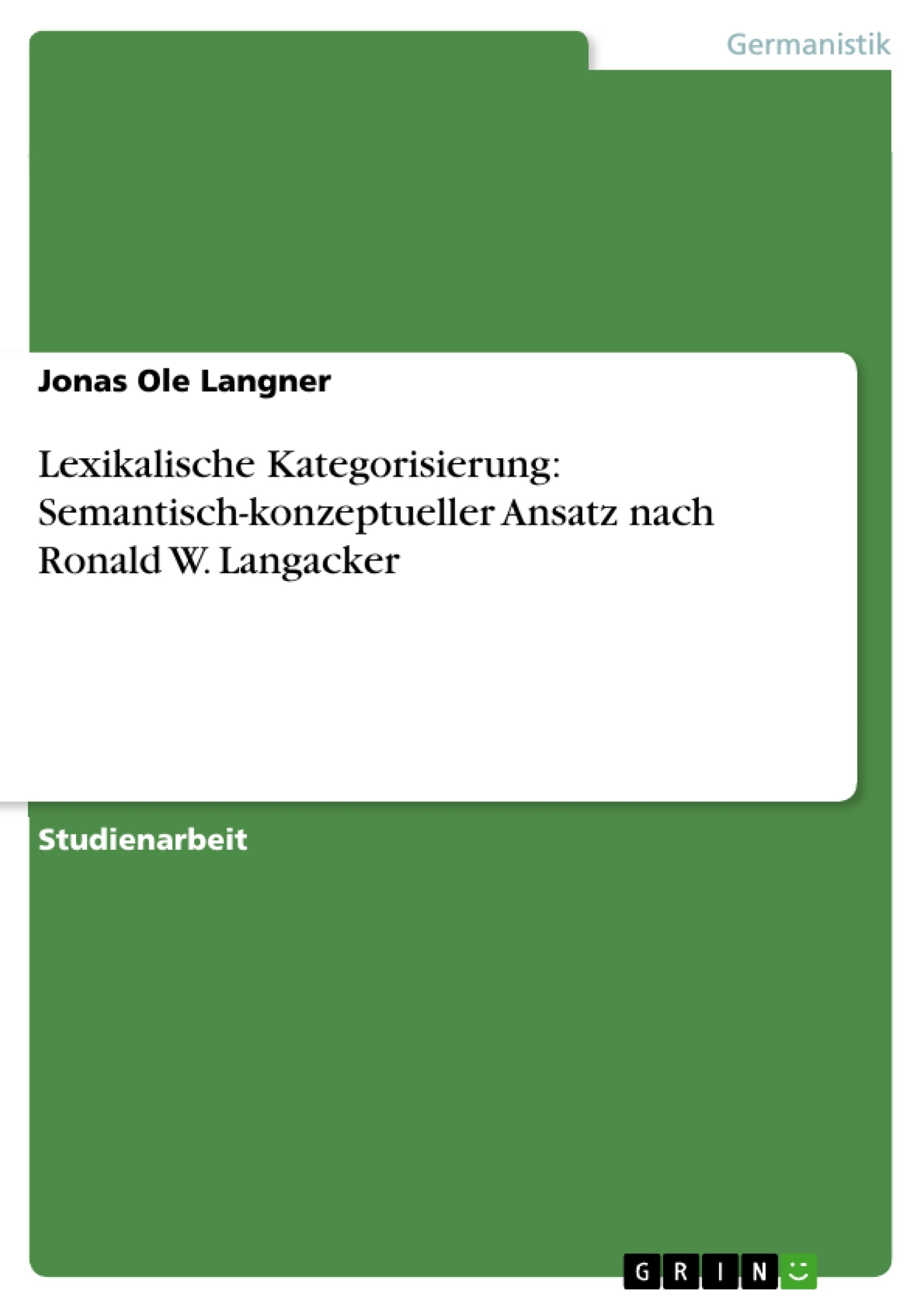Seit Jahrhunderten, denkt man beispielsweise an Dionysius Thrax, beschäftigen sich die Menschen bzw. Sprachwissenschaftler mit der Frage der Wortarten. Dabei kam und kommt man zu unterschiedlichen Einteilungen von Wortarten, die sich an jeweils anderen Klassifizierungskriterien orientieren; dies ist oft bedingt durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Strömung innerhalb der Sprachwissenschaft. Deshalb existieren neben der schulgrammatischen Kategorisierung, morphologische (vgl. Sütterlin, Glinz, van der Elst) und distributionell-strukturalistische Klassifizierungen; diskursfunktionale Ansätze und die Generative Grammatik bieten weitere Varianten. Schließlich entwickelten sich auch noch Vorschläge, die Wortarten nach semantischen Kriterien zu klassifizieren. Hierbei kommt Ronald W. Langacker mit seinem semantisch-konzeptuellen Ansatz ins Spiel. Auch in der Schule, im Deutschunterricht, spielen Wortarten und die Wortartenlehre eine Rolle. Dort ist man abhängig bzw. beruft man sich auf die Erkenntnisse der Wissenschaft. Dabei ist sicherlich interessant, für welchen Ansatz sich der Lehrer entscheidet. Nun liegt es nahe, dass hier, allein schon wegen der Bezeichnung, die schulgrammatische Variante verbreitet wird. Zu Recht ergibt sich dann jedoch die Frage, ob „[…] manche […] Lehrer mit der Bezeichung ‚Wortklassen’ mitunter etwas mechanisch arbeiten, ohne zu überlegen, ob die von ihnen weiter benutzte alte Einteilung auch wirklich zu ihrer sonstigen modernen Einstellung paßt.“ Eine Frage, die Pollak wohlgemerkt schon 1958 stellt, und es darf bezweifelt werden, ob sie bis heute, fast 50 Jahre später, die Schulen erreicht hat. Dies gilt natürlich auch für die Forschung. Wenn eine Disziplin bzw. ein bestimmtes Forschungsgebiet einer solchen seit Jahrhunderten existiert, muss überprüft werden, ob nicht einiges veraltet und überholt ist. Mittlerweile gilt die Defintion von ‚Wort’ nämlich nicht mehr als so eindeutig wie es einmal gewesen ist. Man verabschiedet sich von der Vorstellung, dass jede sprachliche Einheit, die in einem Text getrennt steht, auch gleichzeitig ein Wort ist, sondern dass mehrere sprachliche Einheiten ein Wort ergeben können. Aus diesen Gründen spricht man heute auch besser von lexikalischer Kategorisierung statt von Wortarten (vgl. den Titel des Seminars). Dies bietet die Möglichkeit sich von den bisherigen Einteilungen in ‚Nomen’, ‚Verben’, ‚Adjektive’, etc. zu trennen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Ronald W. Langackers semantisch-konzeptueller Ansatz zur lexikalischen Kategorisierung
- II.1 Voraussetzungen für und Einleitendes zu Langackers Ansatz
- II.2 Nomen
- II.3 Verben
- II.4 Atemporale Beziehungen
- III. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit präsentiert Ronald W. Langackers semantisch-konzeptuellen Ansatz zur lexikalischen Kategorisierung. Ziel ist es, Langackers Konzept vorzustellen und auf dessen neue Erkenntnisse hinzuweisen, insbesondere seine Einteilung lexikalischer Einheiten nach semantischen Kriterien. Die Arbeit beleuchtet die Vorzüge und Herausforderungen dieses Ansatzes im Vergleich zu traditionellen Ansätzen.
- Langackers semantisch-konzeptueller Ansatz zur lexikalischen Kategorisierung
- Vergleich mit anderen Ansätzen zur Wortartenklassifizierung (z.B. schulgrammatisch, morphologisch)
- Die Rolle des Semantischen und Konzeptuellen in Langackers Modell
- Klassifizierung von Nomen und Verben nach Langacker
- Die Kategorie der atemporalen Beziehungen bei Langacker
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die lange Geschichte der Wortartenklassifizierung und die verschiedenen existierenden Ansätze, von schulgrammatischen bis hin zu distributionell-strukturalistischen und diskursfunktionalen Modellen. Sie führt in die Problematik der traditionellen Wortartendefinition ein und argumentiert für den Wechsel zu „lexikalischer Kategorisierung“. Der Ansatz von Ronald W. Langacker wird als eine bedeutende Alternative vorgestellt, die semantische Kriterien in den Mittelpunkt stellt und die Grenzen traditioneller Kategorien aufzeigt. Die Arbeit kündigt die Darstellung und Analyse von Langackers Konzept an. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit einer Überprüfung bestehender Modelle im Kontext der sich entwickelnden Sprachwissenschaft.
II. Ronald W. Langackers semantisch-konzeptueller Ansatz zur lexikalischen Kategorisierung: Dieses Kapitel stellt Langackers Ansatz umfassend dar. Es beginnt mit den Voraussetzungen und grundlegenden Prinzipien seines Modells, die die Bedeutung von Semantik und Konzeptualisierung hervorheben und sich von traditionellen, rein formalen Ansätzen abgrenzen. Es werden die Kategorien Nomen und Verben detailliert analysiert, wobei Langackers Definitionen im Detail erläutert und mit anderen Ansätzen verglichen werden. Besonderes Augenmerk liegt auf der Erklärung von Langackers Konzept „atemporaler Beziehungen“, das Adjektive, Adverbien, Partizipien und Präpositionen umfasst. Der Abschnitt diskutiert die Schwierigkeiten bei der Beweisführung für Langackers Ansatz und die Notwendigkeit eines umfassenden beschreibenden Rahmens.
Schlüsselwörter
Lexikalische Kategorisierung, semantisch-konzeptueller Ansatz, Ronald W. Langacker, Nomen, Verben, atemporale Beziehungen, kognitive Linguistik, Wortarten, Semantik, Konzeptualisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ronald W. Langackers semantisch-konzeptueller Ansatz zur lexikalischen Kategorisierung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit präsentiert und analysiert Ronald W. Langackers semantisch-konzeptuellen Ansatz zur lexikalischen Kategorisierung. Sie untersucht seine Einteilung lexikalischer Einheiten nach semantischen Kriterien und vergleicht ihn mit traditionellen Ansätzen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Langackers semantisch-konzeptuellen Ansatz, vergleicht ihn mit anderen Ansätzen zur Wortartenklassifizierung (z.B. schulgrammatisch, morphologisch), beleuchtet die Rolle von Semantik und Konzeptualisierung in Langackers Modell, klassifiziert Nomen und Verben nach Langacker und untersucht die Kategorie der atemporalen Beziehungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zu Langackers Ansatz (mit Unterkapiteln zu Voraussetzungen, Nomen, Verben und atemporalen Beziehungen) und ein Fazit. Die Einleitung diskutiert die Geschichte der Wortartenklassifizierung und die Notwendigkeit einer neuen, semantisch orientierten Herangehensweise. Das Hauptkapitel erläutert detailliert Langackers Modell. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Was sind die zentralen Aspekte von Langackers Ansatz?
Langackers Ansatz betont die Bedeutung von Semantik und Konzeptualisierung für die lexikalische Kategorisierung. Er unterscheidet sich von traditionellen, formalen Ansätzen durch seine Fokussierung auf die Bedeutung und die konzeptuelle Struktur von Wörtern. Die Arbeit erläutert seine Definitionen von Nomen und Verben und sein Konzept der „atemporalen Beziehungen“, das Kategorien wie Adjektive, Adverbien, Partizipien und Präpositionen umfasst.
Welche Vorteile bietet Langackers Ansatz?
Die Arbeit hebt die Vorzüge von Langackers Ansatz im Vergleich zu traditionellen Ansätzen hervor. Genauer wird dies nicht im FAQ ausgeführt, sondern muss aus der Arbeit selbst erschlossen werden.
Welche Schwierigkeiten werden im Zusammenhang mit Langackers Ansatz angesprochen?
Die Arbeit diskutiert die Schwierigkeiten bei der Beweisführung für Langackers Ansatz und die Notwendigkeit eines umfassenden beschreibenden Rahmens. Konkrete Schwierigkeiten werden nicht im FAQ aufgeführt, sondern müssen dem Haupttext entnommen werden.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Lexikalische Kategorisierung, semantisch-konzeptueller Ansatz, Ronald W. Langacker, Nomen, Verben, atemporale Beziehungen, kognitive Linguistik, Wortarten, Semantik, Konzeptualisierung.
- Quote paper
- Jonas Ole Langner (Author), 2006, Lexikalische Kategorisierung: Semantisch-konzeptueller Ansatz nach Ronald W. Langacker, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58557