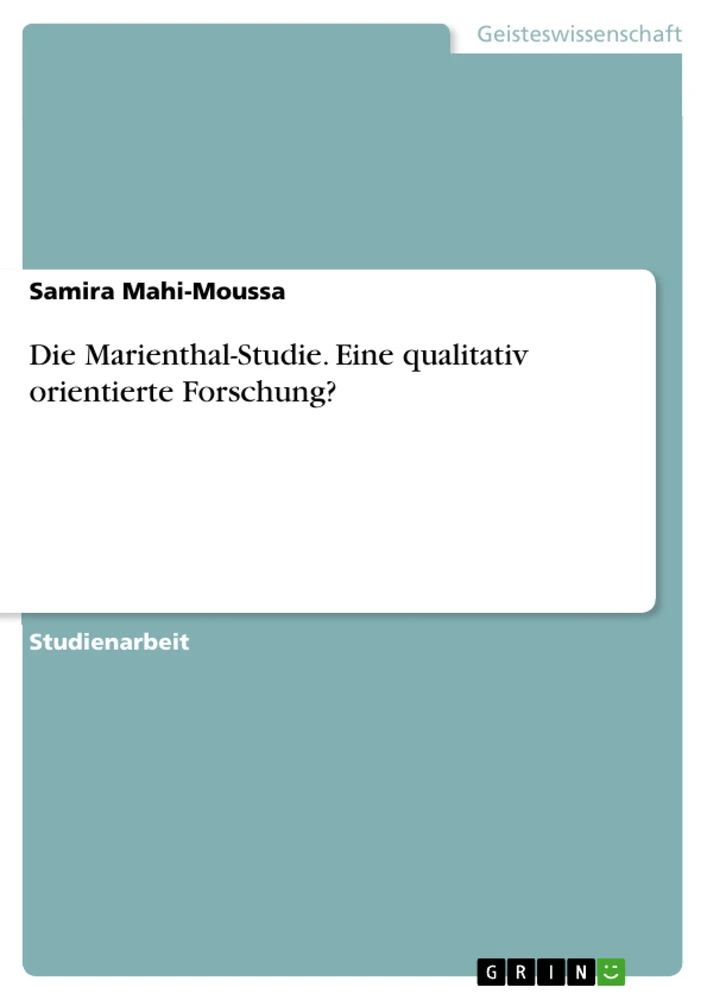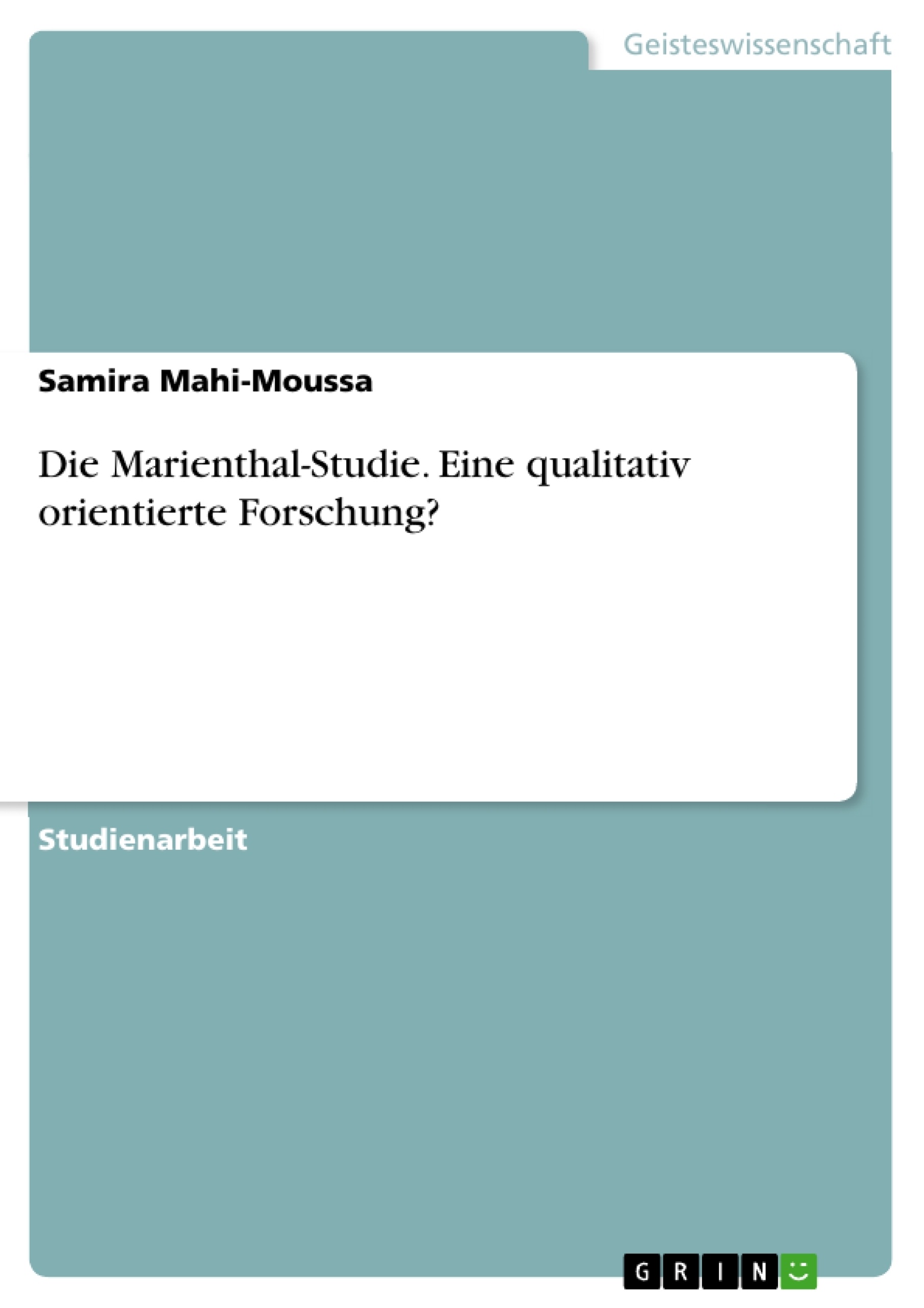Pionier der Studien über die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit ist eindeutig die Marienthal-Studie. Sie beschäftigt sich mit den psychischen und sozialen Auswirkungen von dauerhafter Arbeitslosigkeit des Dorfes Marienthal mit 2920 Einwohnern, von denen nahezu alle im Zuge der Weltwirtschaftskrise 1929/1930 arbeitslos wurden. Die Studie ist vor allem für ihren Methodenkanon gerühmt worden. Sie setzten als Wegbereiter der empirischen Sozialforschung erstmalig praktisch Verfahren ein, welche als solche erst in der jüngeren Forschung theoretisch definiert und entwickelt wurden. Deshalb entspricht die Studie den heutigen Ansprüchen der Forschung und dient vielen wissenschaftlichen Arbeiten bis heute als Vorbild. Die große Bandbreite an angewandten Verfahren macht eine Analyse der Studie hinsichtlich ihres zugrunde liegenden Forschungsparadigmas und ihrer Forschungsmethodik besonders interessant.
Deshalb besteht das Ziel dieser Arbeit darin, eine Feststellung darüber zu treffen, inwiefern die Marienthal-Studie trotz quantifizierender Verfahren eine qualitative Studie ist. Zunächst wird im zweiten Kapitel Aufschluss über die beiden Typologien der empirischen Sozialforschung gegeben, die qualitative und die quantitative Forschung. Hierzu werden die Axiome beider Paradigmen dargestellt und erläutert. In Kapitel 3 wird die Marienthal-Studie anschließend hinsichtlich ihrer Vorgehensweise analysiert und Bezug zu ihrem zugrundeliegenden Paradigma genommen, sodass eine argumentative Einordnung in ein Paradigma vorgenommen werden kann. Darauf aufbauend können schließlich im vierten Kapitel die quantifizierenden Methoden in Betracht genommen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Qualitatives und quantitatives Forschungsparadigma
- Das quantitative Forschungsparadigma.
- Das qualitative Forschungsparadigma.
- Die Marienthal-Studie als qualitativ orientierte Forschung.
- Quantifizierende Methoden der Marienthal-Studie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit die Marienthal-Studie trotz quantifizierender Verfahren als qualitative Studie bezeichnet werden kann. Die Analyse zielt darauf ab, die Studie hinsichtlich ihres zugrundeliegenden Forschungsparadigmas und ihrer Forschungsmethodik zu untersuchen.
- Erläuterung der Axiome des quantitativen und qualitativen Forschungsparadigmas
- Analyse der Marienthal-Studie hinsichtlich ihrer Vorgehensweise und Einordnung in das entsprechende Paradigma
- Beurteilung des Einflusses quantifizierender Erhebungsmethoden auf die Einordnung der Studie
- Zusammenführung der Ergebnisse und Beantwortung der Leitfrage
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung beleuchtet das Thema Arbeitslosigkeit als globales Problem und stellt die Marienthal-Studie als wegweisende Untersuchung der Auswirkungen von Arbeitslosigkeit vor.
- Kapitel 2 definiert und erläutert die beiden Paradigmen der empirischen Sozialforschung: das quantitative und das qualitative Forschungsparadigma.
- Kapitel 3 analysiert die Marienthal-Studie hinsichtlich ihrer Vorgehensweise und ordnet sie in das entsprechende Paradigma ein.
Schlüsselwörter
Qualitative Forschung, Quantitative Forschung, Marienthal-Studie, Arbeitslosigkeit, empirische Sozialforschung, Forschungsparadigma, Methodenkanon, quantifizierende Methoden.
- Quote paper
- Samira Mahi-Moussa (Author), 2019, Die Marienthal-Studie. Eine qualitativ orientierte Forschung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/585055