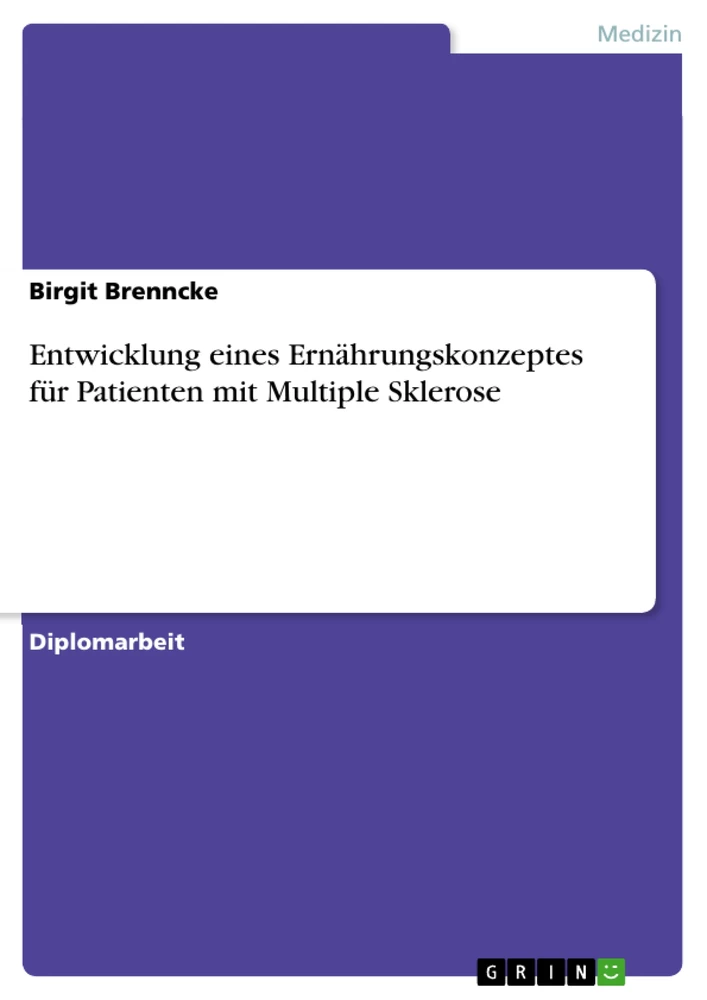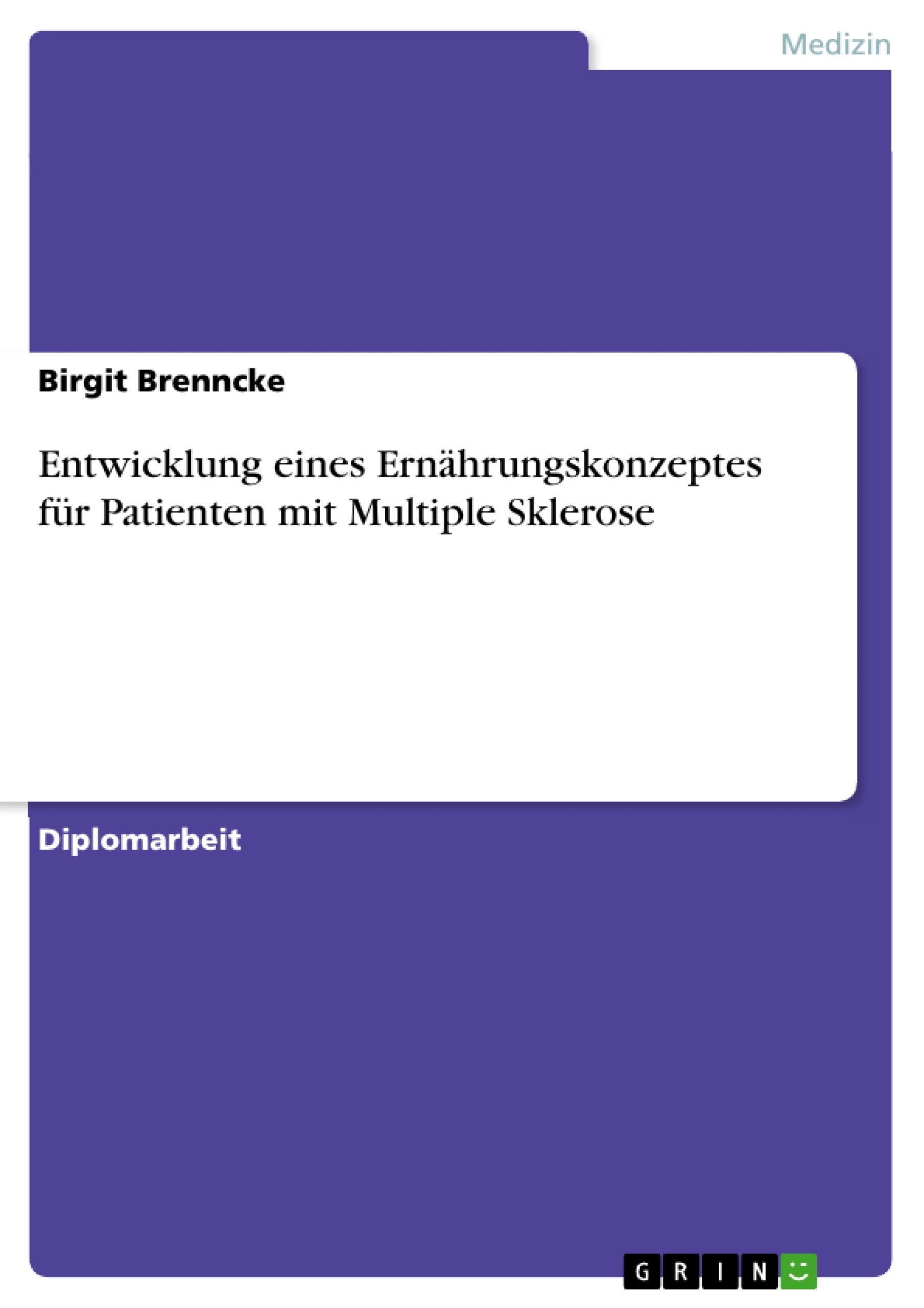Die Multiple Sklerose gehört zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen des jungen Erwachsenenalters. Die Ätiologie der Krankheit ist unbekannt und auch bezüglich der Prognose und des Verlaufs existieren große Unterschiedlichkeiten. Die zunehmende Gewebezerstörung im Nervensystem tritt unvorhersehbar, meist anfangs in Schüben mit Remissionen auf, kann über Jahre hinweg anhalten und dann in eine chronisch fortschreitende Verlaufsform übergehen, welche bleibende Behinderungen mit sich bringt und sogar zur Bettlägerigkeit und zum frühen Tod führen kann. Die Krankheit bedeutet für den Betroffenen und seine Angehörigen einen schweren Einschnitt ins Leben, da zunächst die starre Vorstellung eines schicksalhaften, nicht vorhersehbaren Verlaufs Angst macht.
Die vorliegende Arbeit, in der ein Ernährungskonzept für Patienten mit Multipler Sklerose erstellt wurde, verfolgt die Zielsetzung eine umfassende Informationszusammenstellung der aktuellen Ergebnisse über diese Krankheit und einem ernährungsphysiologischen Zusammenhang zu bieten. Das Konzept kann auch als Leitfaden für die Ernährungsberatung von Multiple-Sklerose-Patienten dienen.
Im ersten Teil der Arbeit wird zunächst erklärt, welche Veränderungen die Krankheit im Körper veranlasst und welche Ergebnisse epidemiologische und neuropathologische Untersuchungen erzielt haben.
Im zweiten Teil wird die Wirksamkeit der bekanntesten Multiple-Sklerose-Diäten kritisch hinterfragt und andere neuronale bzw. autoimmuninduzierte Krankheiten vorgestellt.
Innerhalb des dritten Teils werden dann Möglichkeiten aufgezeigt, die Lebensqualität und das Wohlbefinden mittels einer bewussten Ernährungsweise zu verbessern. Da die Lebensumstände und Krankheitsverläufe der Patienten unterschiedlich sind, kann auf Basis eines Fragebogens die individuelle Situation ermittelt werden und daraufhin, durch den Verweis auf die relevanten Kapitel dieser Arbeit, eine persönliche Strategie entwickelt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- Teil 1: Die Multiple Sklerose
- 1. Anatomie und Physiologie des Nervensystems
- 1.1. Das Nervensystem
- 1.2. Das Nervengewebe
- 1.3. Das Myelin
- 1.4. Das Prinzip der Erregungsleitung
- 1.5. Die Demyelinisierung
- 1.6. Aspekte der gestörten Erregungsleitung
- 1.7. Auswirkungen der Demyelinisierung
- 2. Darstellung der Erkenntnisse über die Multiple Sklerose
- 2.1. Epidemiologische Erkenntnisse
- 2.1.1. Geographische Verteilung
- 2.1.2. Demographische Verteilung
- 2.2. Pathogenese
- 2.2.1. Genetische Faktoren
- 2.2.2. Virale Faktoren
- 2.2.3. Stoffwechseltheorie
- 2.1. Epidemiologische Erkenntnisse
- 3. Neuropathologische Veränderungen
- 3.1. Entmarkungszonen (Plaques)
- 3.2. Makroskopische Charakteristika
- 3.3. Mikroskopische Charakteristika
- 3.4. Die Antigene des ZNS
- 3.5. Liquorveränderungen
- 3.6. Befunde von Liquoruntersuchungen
- 4. Klinische Symptomatik
- 4.1. Verlaufsformen
- 4.2. Motorik
- 4.3. Koordination
- 4.4. Sensorik
- 4.5. Erschöpfung und Schmerzen
- 4.6. Vegetative Störungen
- 4.7. Ophtalmologische Störungen
- 4.8. Weitere auftretende Veränderung
- 4.9. Auslöser für Schub und Remission
- 1. Anatomie und Physiologie des Nervensystems
- Teil 2: Darstellung von Ernährungsempfehlungen für die Multiple Sklerose und anderer Erkrankungen
- 5. Kritische Bezugnahme auf bisher angewandte Ernährungstherapien
- 5.1. Die Evers - Diät
- 5.2. Die Swank - Diät
- 5.3. Die Allergenfreie Diät
- 5.4. Die Fettarme Diät
- 5.5. Die Fruchzuckerarme Diät
- 5.6. Die Glutenfreie Diät
- 6. Vergleichende Darstellung anderer neuronaler bzw. autoimmuninduzierter Erkrankungen mit der MS unter Berücksichtigung der Ernährungsempfehlungen
- 6.1. Epilepsie
- 6.2. Morbus Parkinson
- 6.3. Morbus Alzheimer
- 6.4. Rheumatische Gelenkerkrankungen
- 5. Kritische Bezugnahme auf bisher angewandte Ernährungstherapien
- Teil 3: Das Ernährungskonzept für Patienten mit Multiple Sklerose
- 7. Ernährung und Multiple Sklerose
- 7.1. Das soziale Umfeld und die ökonomische Situation
- 7.2. Feststellung des Ernährungszustandes
- 7.3. Einflussfaktoren auf den Energieverbrauch
- 7.4. Der Energie- und Nährstoffbedarf
- 8. Die Nahrungsbestandteile und die Nährstoffgruppen
- 8.1. Kohlenhydrate
- 8.2. Ballaststoffe
- 8.3. Fette
- 8.4. Proteine
- 8.5. Vitamine
- 8.5.1. Vitamin A
- 8.5.2. Vitamin D
- 8.5.3. Vitamin E
- 8.5.4. Vitamin K
- 8.5.5. Vitamin B₁
- 8.5.6. Vitamin B2
- 8.5.7. Vitamin B6
- 8.5.8. Vitamin B12 und Folsäure
- 8.5.9. Vitamin C
- 8.6. Mineralstoffe
- 8.6.1. Natrium
- 8.6.2. Kalium
- 8.6.3. Calcium
- 8.6.4. Magnesium
- 8.7. Spurenelemente
- 8.7.1. Eisen
- 8.7.2. Zink und Kupfer
- 8.7.3. Selen
- 9. Ernährung in speziellen Lebenssituationen
- 9.1. Schwangerschaft bei Multiple Sklerose-Patientinnen
- 9.2. Multiple Sklerose und Sport
- 9.3. Multiple Sklerose und Genussmittel
- 7. Ernährung und Multiple Sklerose
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit hat zum Ziel, ein umfassendes Ernährungskonzept für Patienten mit Multipler Sklerose (MS) zu entwickeln. Es wird ein kritischer Überblick über bestehende Ernährungsempfehlungen gegeben und deren Wirksamkeit hinterfragt. Das Konzept berücksichtigt sowohl den individuellen Nährstoffbedarf als auch die speziellen Bedürfnisse von MS-Patienten in verschiedenen Lebenssituationen.
- Anatomie und Physiologie der MS
- Kritische Analyse bestehender Ernährungskonzepte für MS
- Entwicklung eines individuellen Ernährungsplans für MS-Patienten
- Berücksichtigung von Lebenssituationen (Schwangerschaft, Sport, Genussmittel)
- Der Einfluss von Nährstoffen auf den Krankheitsverlauf
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und erläutert die Relevanz eines speziell auf MS-Patienten zugeschnittenen Ernährungskonzeptes. Sie beschreibt den Aufbau der Arbeit und die verfolgte Methodik.
1. Anatomie und Physiologie des Nervensystems: Dieses Kapitel liefert die notwendigen anatomischen und physiologischen Grundlagen zum Verständnis der MS. Es beschreibt detailliert das Nervensystem, das Nervengewebe, das Myelin und das Prinzip der Erregungsleitung. Der Fokus liegt auf der Demyelinisierung und deren Auswirkungen auf die Nervenfunktion, um den pathologischen Prozess der MS zu veranschaulichen.
2. Darstellung der Erkenntnisse über die Multiple Sklerose: Dieses Kapitel präsentiert die aktuellen Erkenntnisse über MS, beginnend mit epidemiologischen Daten zur geographischen und demographischen Verteilung. Es analysiert die Pathogenese der Erkrankung, unter Berücksichtigung genetischer, viraler und metabolischer Faktoren. Die Zusammenhänge zwischen diesen Faktoren und dem Auftreten von MS werden ausführlich diskutiert.
3. Neuropathologische Veränderungen: Dieses Kapitel befasst sich mit den neuropathologischen Veränderungen im Zentralnervensystem bei MS-Patienten. Es beschreibt Entmarkungszonen (Plaques), makroskopische und mikroskopische Charakteristika der Läsionen, Antigene des ZNS und Liquorveränderungen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der mikroskopischen Veränderungen und deren Korrelation mit den klinischen Symptomen.
4. Klinische Symptomatik: Dieses Kapitel beschreibt die vielschichtige klinische Symptomatik der MS. Es differenziert zwischen verschiedenen Verlaufsformen und erläutert die Auswirkungen der Erkrankung auf Motorik, Koordination, Sensorik, sowie Erschöpfung, Schmerzen und vegetative Störungen. Die möglichen Auslöser für Schübe und Remissionen werden ebenfalls diskutiert.
5. Kritische Bezugnahme auf bisher angewandte Ernährungstherapien: Dieses Kapitel analysiert kritisch verschiedene, bisher angewandte Ernährungstherapien bei MS, wie die Evers-Diät, die Swank-Diät, allergenfreie Diäten, fettarme Diäten, fruchzuckerarme Diäten und glutenfreie Diäten. Es bewertet die wissenschaftliche Evidenz für die Wirksamkeit dieser Ansätze und identifiziert deren Stärken und Schwächen.
6. Vergleichende Darstellung anderer neuronaler bzw. autoimmuninduzierter Erkrankungen mit der MS unter Berücksichtigung der Ernährungsempfehlungen: Dieses Kapitel vergleicht MS mit anderen neuronalen und autoimmuninduzierten Erkrankungen wie Epilepsie, Morbus Parkinson, Morbus Alzheimer und rheumatischen Gelenkerkrankungen. Es analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Symptomatik und den möglichen Auswirkungen von Ernährung auf den Krankheitsverlauf.
7. Ernährung und Multiple Sklerose: Dieses Kapitel legt den Grundstein für das entwickelte Ernährungskonzept. Es betrachtet das soziale Umfeld und die ökonomische Situation von MS-Patienten, die Bestimmung des Ernährungszustandes und die Einflussfaktoren auf den Energieverbrauch. Es berechnet den Energie- und Nährstoffbedarf von MS-Patienten, basierend auf den zuvor gewonnenen Erkenntnissen.
8. Die Nahrungsbestandteile und die Nährstoffgruppen: Dieses Kapitel analysiert die Rolle verschiedener Nahrungsbestandteile und Nährstoffgruppen bei MS. Es werden Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Fette, Proteine, Vitamine und Mineralstoffe detailliert betrachtet. Für jede Nährstoffgruppe wird der Bedarf und die Bedeutung für MS-Patienten erklärt.
9. Ernährung in speziellen Lebenssituationen: Dieses Kapitel betrachtet den Einfluss von Schwangerschaft, Sport und Genussmitteln auf die Ernährung von MS-Patientinnen und -Patienten und gibt spezifische Empfehlungen für diese Lebenssituationen.
Schlüsselwörter
Multiple Sklerose, Ernährung, Ernährungskonzept, Demyelinisierung, Neuropathologie, klinische Symptomatik, Ernährungstherapie, Energiebedarf, Nährstoffbedarf, Kohlenhydrate, Fette, Proteine, Vitamine, Mineralstoffe, Schwangerschaft, Sport, Genussmittel, Epidemiologie, Pathogenese.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Ernährungskonzept für Multiple Sklerose
Was ist der Inhalt dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit entwickelt ein umfassendes Ernährungskonzept für Menschen mit Multipler Sklerose (MS). Sie beinhaltet eine kritische Analyse bestehender Ernährungsempfehlungen, die Untersuchung der anatomischen und physiologischen Grundlagen der MS, eine detaillierte Beschreibung der klinischen Symptomatik und berücksichtigt den individuellen Nährstoffbedarf sowie die Bedürfnisse von MS-Patienten in verschiedenen Lebenssituationen (Schwangerschaft, Sport, Genussmittel).
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Anatomie und Physiologie des Nervensystems im Kontext der MS, eine kritische Bewertung bestehender Ernährungskonzepte (z.B. Evers-Diät, Swank-Diät), die Entwicklung eines individuellen Ernährungsplans für MS-Patienten, die Berücksichtigung von Lebenssituationen wie Schwangerschaft, Sport und Konsum von Genussmitteln, sowie der Einfluss von Nährstoffen auf den Krankheitsverlauf der MS. Weiterhin werden Vergleiche mit anderen neuronalen und autoimmuninduzierten Erkrankungen gezogen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile mit insgesamt neun Kapiteln. Teil 1 behandelt die anatomischen und physiologischen Grundlagen der MS, die epidemiologischen Erkenntnisse und die neuropathologischen Veränderungen. Teil 2 analysiert kritisch bestehende Ernährungsempfehlungen und vergleicht MS mit anderen Erkrankungen. Teil 3 entwickelt das Ernährungskonzept, beschreibt den Energie- und Nährstoffbedarf und betrachtet die Ernährung in speziellen Lebenssituationen. Jedes Kapitel ist detailliert im Inhaltsverzeichnis aufgeführt.
Welche bestehenden Ernährungskonzepte werden kritisch analysiert?
Die Arbeit analysiert kritisch verschiedene Ernährungskonzepte, die bisher bei MS angewendet wurden: die Evers-Diät, die Swank-Diät, allergenfreie Diäten, fettarme Diäten, fruchzuckerarme Diäten und glutenfreie Diäten. Die wissenschaftliche Evidenz für die Wirksamkeit dieser Ansätze wird bewertet, und deren Stärken und Schwächen werden identifiziert.
Welche Nährstoffe werden im Detail betrachtet?
Das Ernährungskonzept analysiert die Rolle verschiedener Nahrungsbestandteile und Nährstoffgruppen bei MS. Im Detail werden Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Fette, Proteine, Vitamine (A, D, E, K, B1, B2, B6, B12, Folsäure, C) und Mineralstoffe (Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium) sowie Spurenelemente (Eisen, Zink, Kupfer, Selen) betrachtet. Für jede Nährstoffgruppe wird der Bedarf und die Bedeutung für MS-Patienten erklärt.
Wie berücksichtigt die Arbeit spezielle Lebenssituationen?
Die Arbeit berücksichtigt den Einfluss von Schwangerschaft, Sport und Genussmitteln auf die Ernährung von MS-Patienten und gibt spezifische Empfehlungen für diese Lebenssituationen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit hat zum Ziel, ein umfassendes und individuelles Ernährungskonzept für Patienten mit Multipler Sklerose zu entwickeln. Es soll ein kritischer Überblick über bestehende Ernährungsempfehlungen gegeben und deren Wirksamkeit hinterfragt werden. Das Konzept berücksichtigt den individuellen Nährstoffbedarf und die speziellen Bedürfnisse von MS-Patienten in verschiedenen Lebenssituationen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter beschrieben: Multiple Sklerose, Ernährung, Ernährungskonzept, Demyelinisierung, Neuropathologie, klinische Symptomatik, Ernährungstherapie, Energiebedarf, Nährstoffbedarf, Kohlenhydrate, Fette, Proteine, Vitamine, Mineralstoffe, Schwangerschaft, Sport, Genussmittel, Epidemiologie, Pathogenese.
- Quote paper
- Birgit Brenncke (Author), 2003, Entwicklung eines Ernährungskonzeptes für Patienten mit Multiple Sklerose, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58478