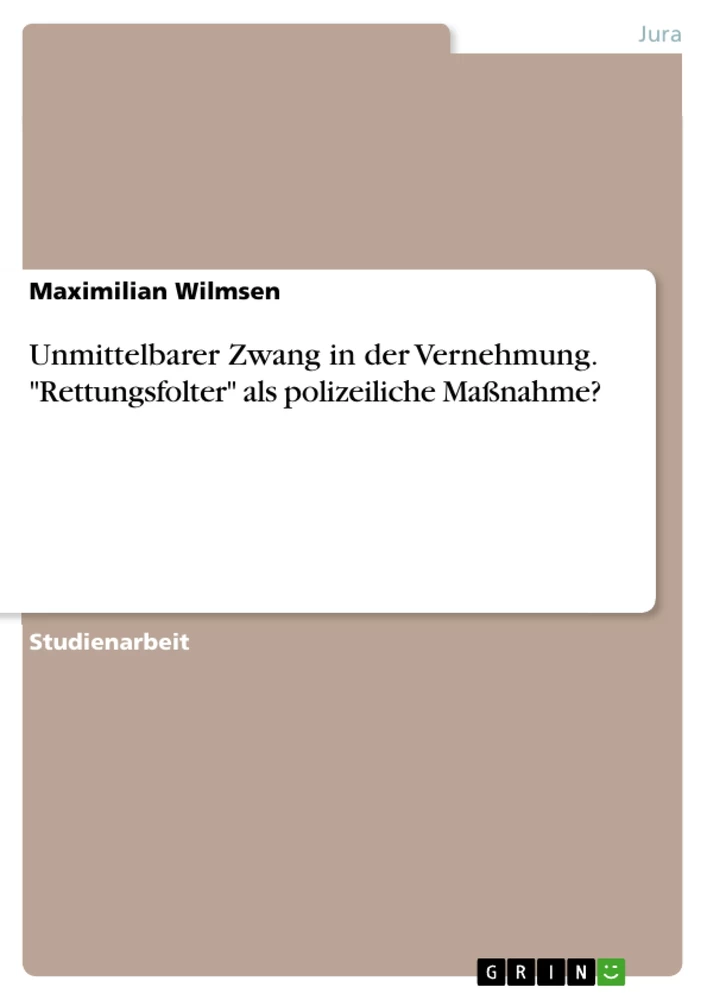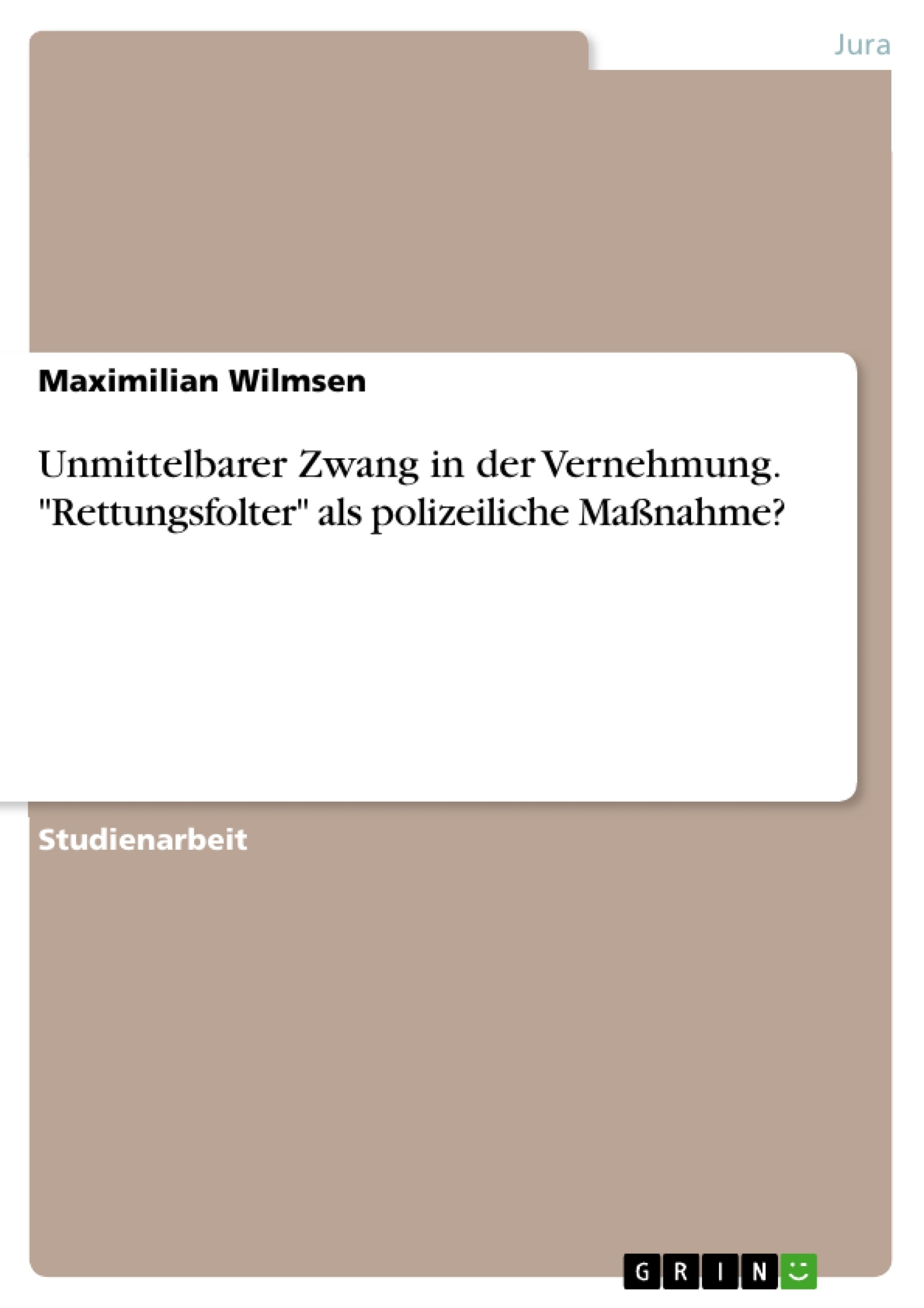Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit Folter eine polizeiliche Vernehmungsmethode darstellen könnte. Die Arbeit erläutert und orientiert sich dabei an der Entführung im Jahre 2003 von Jakob von Metzler durch Markus Gäfgen. Gesetze rund um die Folter werden beleuchtet, die Entführung wird zusammengefasst und schließlich werden Argumente, die die Folter gesetzlich rechtfertigen könnten, vorgestellt, bevor eine Abwägung stattfindet.
Ende 2002 macht die Entführung des Jungen Jakob von Metzler und der folgende Prozess von Markus Gäfgen Schlagzeilen in ganz Deutschland. Schlagzeilen in der ganzen Welt macht allerdings der darauffolgende Prozess, als sich herausstellt, dass die Polizei möglicherweise Folter in der Vernehmung des Entführers angewandt hat. Zwei Polizisten werden schließlich verurteilt. Im Rahmen der gerichtlichen Verhandlungen entbrennt eine Diskussion: ist das Verbot der Folter unstrittig gültig oder wäre unter bestimmten Bedingungen unmittelbarer Zwang, die „Rettungsfolter“ denkbar?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffserklärungen
- 2.1 Unmittelbarer Zwang
- 2.2 Folter
- 2.3 Rettungsfolter
- 3 Folterrelevante Gesetze
- 4 Der „Frankfurter Fall“
- 4.1 Tathergang und Vernehmung
- 4.2 Urteile
- 5 Argumente für „Rettungsfolter“
- 6 Das Problem der Regulierung
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ethischen und rechtlichen Fragen der „Rettungsfolter“ im Kontext des deutschen Rechts und der öffentlichen Debatte. Sie analysiert die Definition von Folter und unmittelbarem Zwang, beleuchtet relevante Gesetze und den „Frankfurter Fall“ als prominentes Beispiel. Die Arbeit untersucht schließlich Argumente für und gegen Rettungsfolter und die Herausforderungen ihrer Regulierung.
- Definition und Abgrenzung von Folter und unmittelbarem Zwang
- Analyse der Rechtslage in Deutschland bezüglich Folter
- Der „Frankfurter Fall“ und seine rechtlichen Konsequenzen
- Ethische und moralische Argumente für und gegen Rettungsfolter
- Die Herausforderungen der gesetzlichen Regulierung von Rettungsfolter
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar, ausgehend vom Fall Gäfgen und der öffentlichen Debatte um die Zulässigkeit von „Rettungsfolter“. Sie skizziert die unterschiedlichen Positionen in der Gesellschaft und die Diskrepanz zwischen Rechtsprechung und Moralempfinden. Die Arbeit kündigt ihre Zielsetzung an: die Ergründung der ethischen und rechtlichen Begründbarkeit von Rettungsfolter.
2 Begriffserklärungen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe „unmittelbarer Zwang“, „Folter“ und „Rettungsfolter“. Es erläutert die Legaldefinition von unmittelbarem Zwang gemäß dem Polizeigesetz und die UN-Definition von Folter, unter Berücksichtigung der fünf wesentlichen Kriterien. Der Begriff „Rettungsfolter“ wird im Kontext des „ticking-bomb“-Szenarios diskutiert und die von Trapp vorgeschlagene „selbstverschuldete Rettungsbefragung“ als möglicher Lösungsansatz vorgestellt.
3 Folterrelevante Gesetze: Dieses Kapitel analysiert die deutsche Gesetzeslage im Hinblick auf Folter. Es stellt fest, dass es zwar kein explizites Folterverbot gibt, Folter aber implizit durch diverse Gesetze wie das Strafgesetzbuch (StGB) mit seinen Paragraphen zur Körperverletzung, Nötigung und Aussageerpressung, sowie die Strafprozessordnung (StPO) mit ihren verbotenen Vernehmungsmethoden, untersagt ist. Die Anwendung auf den Fall psychischer Gewalt wird diskutiert.
4 Der „Frankfurter Fall“: Dieses Kapitel untersucht den „Frankfurter Fall“ (Fall Gäfgen) detailliert. Es analysiert den Tathergang und die Vernehmung des Entführers, unter besonderer Berücksichtigung der Vorwürfe der Polizeigewalt. Es beleuchtet die Urteile und deren rechtliche Begründung im Kontext der Frage nach der Zulässigkeit von Zwangsmaßnahmen während polizeilicher Vernehmungen.
Schlüsselwörter
Rettungsfolter, Folter, Unmittelbarer Zwang, Polizeigesetz, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Menschenrechte, Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), Daschner-Prozess, Gäfgen-Fall, ethische Dilemmata, Rechtsstaatlichkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Thema "Rettungsfolter"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der ethischen und rechtlichen Problematik der „Rettungsfolter“. Sie analysiert den Begriff im Kontext des deutschen Rechts und der öffentlichen Debatte, unter Einbezug des prominenten „Frankfurter Falls“ (Fall Gäfgen).
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit definiert und grenzt die Begriffe „Folter“, „unmittelbarer Zwang“ und „Rettungsfolter“ ab. Sie untersucht die relevante deutsche Gesetzeslage (StGB, StPO), analysiert den „Frankfurter Fall“ hinsichtlich Tathergang, Vernehmung und Urteilen, beleuchtet ethische Argumente für und gegen Rettungsfolter und diskutiert die Herausforderungen ihrer rechtlichen Regulierung.
Wie werden die Begriffe „Folter“, „unmittelbarer Zwang“ und „Rettungsfolter“ definiert?
Die Arbeit verwendet die Legaldefinitionen des unmittelbaren Zwangs (gemäß Polizeigesetz) und der Folter (gemäß UN-Definition), inklusive der fünf wesentlichen Kriterien. „Rettungsfolter“ wird im Kontext des „ticking-bomb“-Szenarios und der „selbstverschuldeten Rettungsbefragung“ (Trapp) diskutiert.
Welche Rolle spielt der „Frankfurter Fall“ (Fall Gäfgen)?
Der „Frankfurter Fall“ dient als Fallbeispiel. Die Arbeit analysiert den Tathergang, die Vernehmung des Entführers (einschließlich der Vorwürfe der Polizeigewalt), die Urteile und deren rechtliche Begründung im Hinblick auf die Zulässigkeit von Zwangsmaßnahmen während der Vernehmung.
Welche Gesetze sind relevant für die Thematik?
Die Arbeit analysiert die deutsche Gesetzeslage, insbesondere das Strafgesetzbuch (StGB) mit Paragraphen zur Körperverletzung, Nötigung und Aussageerpressung, sowie die Strafprozessordnung (StPO) mit ihren verbotenen Vernehmungsmethoden. Die Anwendung auf psychische Gewalt wird diskutiert. Obwohl es kein explizites Folterverbot gibt, wird Folter implizit durch diese Gesetze untersagt.
Welche ethischen und moralischen Argumente werden behandelt?
Die Arbeit untersucht ethische und moralische Argumente sowohl für als auch gegen die Anwendung von „Rettungsfolter“ und diskutiert die damit verbundenen Dilemmata im Kontext von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten.
Welche Herausforderungen bestehen bei der Regulierung von „Rettungsfolter“?
Die Arbeit diskutiert die Schwierigkeiten, „Rettungsfolter“ rechtlich zu regulieren, und die Spannungen zwischen dem Schutz von Menschenrechten und der Notwendigkeit, in extremen Situationen Leben zu retten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter umfassen: Rettungsfolter, Folter, Unmittelbarer Zwang, Polizeigesetz, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Menschenrechte, Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), Daschner-Prozess, Gäfgen-Fall, ethische Dilemmata, Rechtsstaatlichkeit.
- Quote paper
- Maximilian Wilmsen (Author), 2019, Unmittelbarer Zwang in der Vernehmung. "Rettungsfolter" als polizeiliche Maßnahme?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/583780