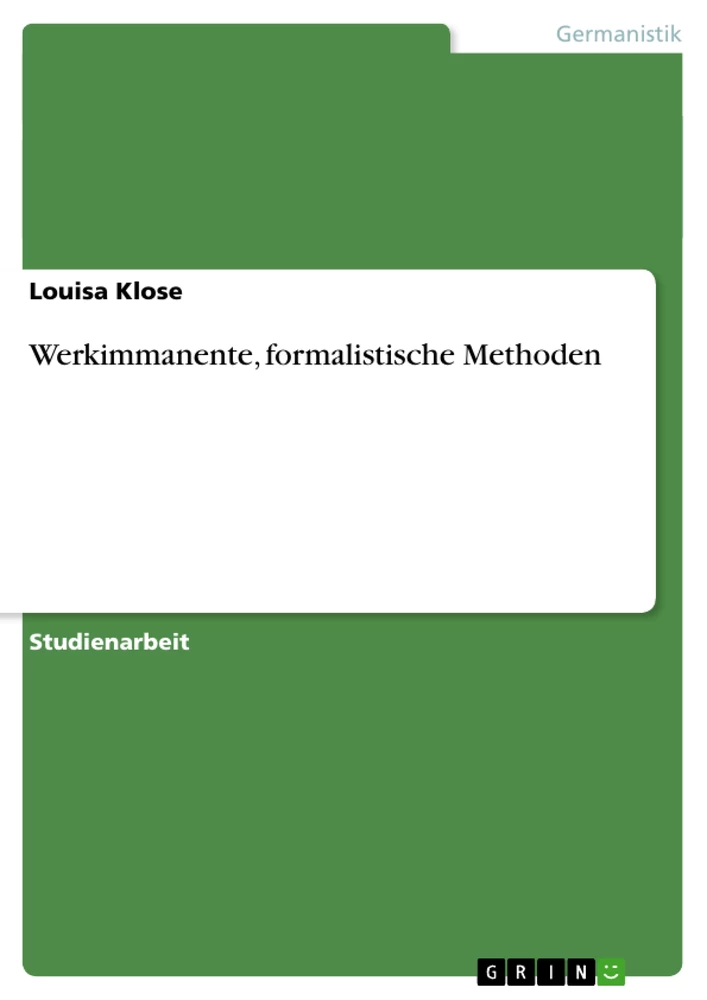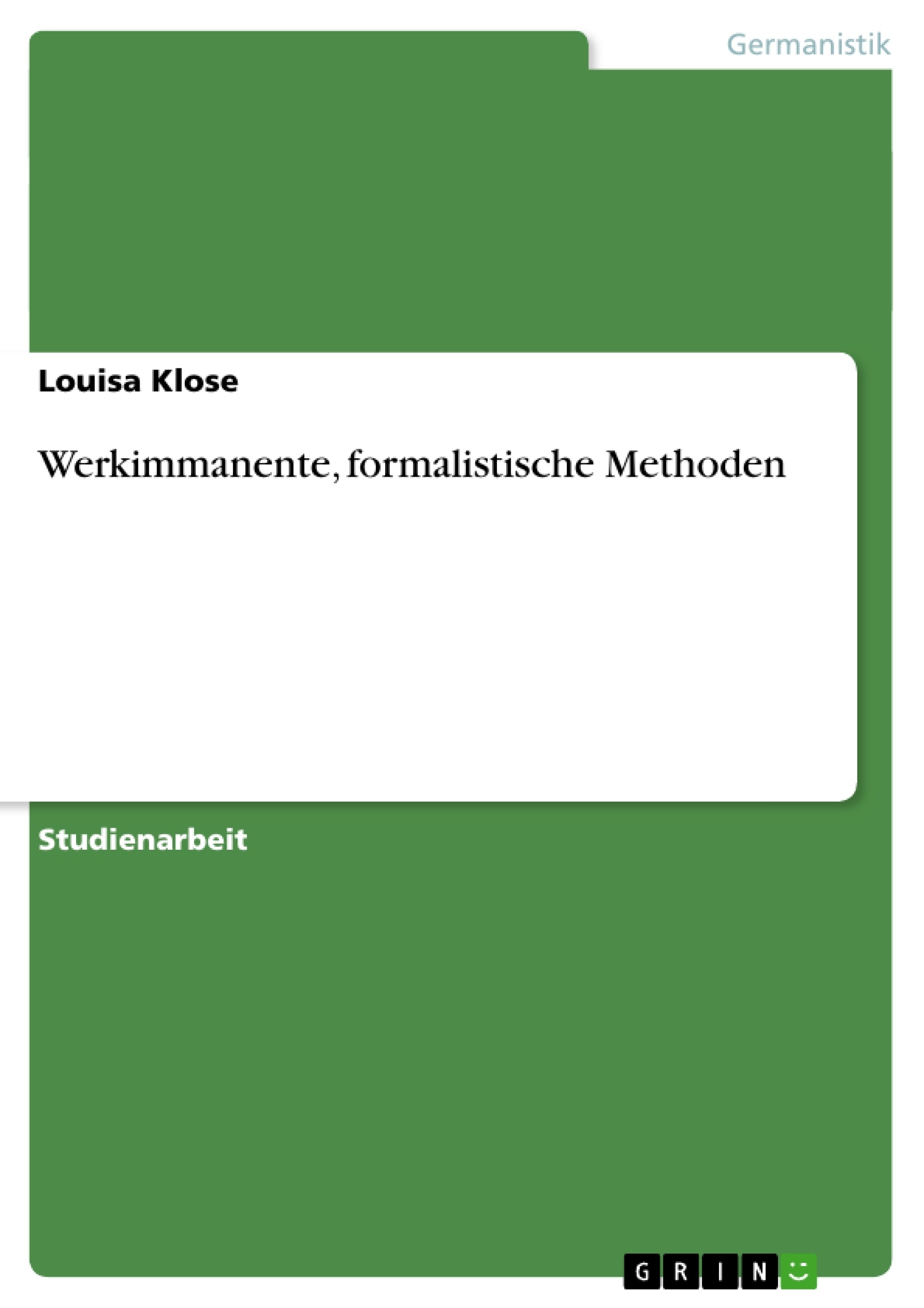Die "werkimmanente Methode" dient der Interpretation dichterischer Texte. Sie wird auch als "formalistische" Methode bezeichnet, da der Text ausschließlich als ein "Produkt künstlerischer Konstruktion" aufgefaßt wir dessen Bauform und Strukturen aufgedeckt werden sollen: Bei einem dichterischen Werk wird nur nach dem "Was" und dem "Wie" gefragt, "indem man sich auf die in ihm greifbaren Phänomene konzentriert, d.h. man orientiert sich ausschließlich am Ergebnisobjekt selbst und fragt weder, unter welchen Bedingungen es entstand, noch, an wen es sich richtet, noch, wie weit es einer literarischen Tradition folgt usw. ." Der Begriffsteil immanent zeigt an, daß die Analyse innerhalb des Werkes bleibt. Mit dieser Methode soll erreicht werden, daß nur das "Werkimmanente" erfaßt wird. "Außerhalb des Werkes liegende Feststellungsakte" dürfen dabei nicht als eine Urteilsbasis dienen. Die Analyse soll sich nur auf die textliche Realität beziehen. Jegliche außerliterarische Faktoren sind außer Acht zu lassen, und die Analyse muß frei von jedem Vorurteil sein. Daraus folgt zwingend, daß gesellschaftliche, ideologische oder historische Einflüsse bei der Interpretation nicht berücksichtigt werden. Auch die Biographie des Autors hat keinen Einfluß auf diese Interpretationsmethode: "Auf keinen Fall lasse sich ein Gedicht aus biographischen Daten erklären." Diese Methode ist demgemäß als Analyse nur solcher Phänomene anzusehen, die sich in dem entsprechenden Text selbst finden. "Die Interpretation will das Werk als Ganzheit fassen, keine Seite von ihm übergehen und dabei tunlichst das Subjektive vermeiden." Formelemente müssen erkannt werden, um sie in ihrem Zusammenhang und ihrer Wirksamkeit zu begreifen: "Doch eben dies, was uns der unmittelbare Eindruck aufschließt, ist der Gegenstand literarischer Forschung: das wir begreifen, was uns ergreift, (...)."6 Es muß darauf geachtet werden, daß nicht der Inhalt des Werkes noch einmal wiederholt wird (Inhaltsnacherzählung). Auch soll nicht der Gemütszustand des Betrachters beim Lesen des Werkes beschrieben, "sondern Sachliches im Werk"7 aufzeigt werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Theorie und Kritik der werkimmanenten Methode
- II. Eigene Stellungnahme
- III. Interpretation von Kafkas „Gibs auf“
- IV. Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die werkimmanente, formalistische Methode der Literaturinterpretation. Ziel ist es, diese Methode zu beschreiben, zu kritisieren und ihre Anwendung anhand eines Beispiels (Kafkas „Gibs auf“) zu demonstrieren.
- Theorie und Praxis der werkimmanenten Methode
- Kritik an der werkimmanenten Methode
- Anwendung der werkimmanenten Methode auf ein literarisches Werk
- Geschichtliche Entwicklung der Literaturwissenschaft und der werkimmanenten Methode
- Alternative Interpretationsmethoden
Zusammenfassung der Kapitel
I. Theorie und Kritik der werkimmanenten Methode: Diese Einleitung beschreibt die werkimmanente Methode als rein textzentrierte Analyse, die ausschließlich die Struktur und Form des Werkes betrachtet und externe Faktoren wie historische Kontext oder Autorenbiografie ausblendet. Die Methode wird als „formalistisch“ bezeichnet, da sie sich auf das „Was“ und „Wie“ des Textes konzentriert, ohne den „Warum“-Aspekt zu berücksichtigen. Kritiker bemängeln den Ausschluss außertextlicher Faktoren und die mögliche Flucht vor gesellschaftlicher Verantwortung, die diese Methode impliziert. Die Arbeit diskutiert verschiedene Ansätze der werkimmanenten Interpretation und verweist auf wichtige Vertreter wie Boris Eichenbaum, Emil Staiger und Wolfgang Kayser. Sie verdeutlicht die Herausforderungen und Grenzen dieser Methode, insbesondere im Kontext der deutschen Literaturwissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg.
II. Eigene Stellungnahme: (Kapitel fehlt im bereitgestellten Text. Es wird angenommen, dass dieses Kapitel eine persönliche Auseinandersetzung der Autorin mit der werkimmanenten Methode beinhaltet, möglicherweise inklusive einer kritischen Bewertung und Ausblick auf alternative Methoden.)
III. Interpretation von Kafkas „Gibs auf“: (Kapitel fehlt im bereitgestellten Text. Es ist davon auszugehen, dass dieses Kapitel eine detaillierte Interpretation von Kafkas „Gibs auf“ unter Anwendung der werkimmanenten Methode enthält. Die Analyse würde sich auf formale Aspekte des Textes, wie z.B. Struktur, Sprache und Stil, konzentrieren, ohne den historischen oder biographischen Kontext zu berücksichtigen.)
Schlüsselwörter
Werkimmanente Methode, Formalismus, Literaturinterpretation, Textanalyse, Emil Staiger, Wolfgang Kayser, Boris Eichenbaum, Literatursoziologie, deutsche Literaturwissenschaft, Kafka, „Gibs auf“
Häufig gestellte Fragen zu: Unbenannter Text zur Werkimmanenten Methode
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text ist eine wissenschaftliche Arbeit, die sich mit der werkimmanenten (oder formalistlischen) Methode der Literaturinterpretation auseinandersetzt. Er beschreibt die Methode, kritisiert sie und illustriert ihre Anwendung anhand einer Interpretation von Kafkas "Gibs auf".
Welche Themen werden behandelt?
Der Text behandelt die Theorie und Praxis der werkimmanenten Methode, ihre Kritikpunkte, ihre Anwendung auf ein literarisches Werk, die geschichtliche Entwicklung der Literaturwissenschaft im Zusammenhang mit dieser Methode und alternative Interpretationsansätze. Wichtige Vertreter der werkimmanenten Methode wie Boris Eichenbaum, Emil Staiger und Wolfgang Kayser werden erwähnt.
Welche Kapitel enthält der Text und worum geht es darin?
Der Text umfasst (mindestens) vier Kapitel: Kapitel I beschreibt die werkimmanente Methode, ihre Stärken und Schwächen und wichtige Vertreter. Kapitel II (im vorliegenden Auszug fehlt der Inhalt) sollte die persönliche Stellungnahme der Autorin zur Methode enthalten. Kapitel III (ebenfalls ohne Inhalt im Auszug) sollte eine werkimmanente Interpretation von Kafkas "Gibs auf" bieten. Kapitel IV (Schlußbetrachtung) fehlt im Auszug.
Welche Kritikpunkte an der werkimmanenten Methode werden genannt?
Kritiker bemängeln den Ausschluss außertextlicher Faktoren wie historischer Kontext oder Autorenbiografie. Die Methode wird als Flucht vor gesellschaftlicher Verantwortung interpretiert, da der Fokus allein auf dem Text liegt und der Kontext ignoriert wird. Der Text verdeutlicht die Herausforderungen und Grenzen dieser Methode, besonders in der deutschen Literaturwissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg.
Wie wird Kafkas "Gibs auf" im Text behandelt?
Kafkas "Gibs auf" dient als Beispieltext, um die werkimmanente Methode zu demonstrieren. Der Auszug enthält keine detaillierte Interpretation, aber es ist ersichtlich, dass eine solche im fehlenden Kapitel III zu erwarten wäre. Diese Interpretation würde sich ausschließlich auf formale Aspekte des Textes konzentrieren (Struktur, Sprache, Stil).
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Schlüsselwörter sind: Werkimmanente Methode, Formalismus, Literaturinterpretation, Textanalyse, Emil Staiger, Wolfgang Kayser, Boris Eichenbaum, Literatursoziologie, deutsche Literaturwissenschaft, Kafka, "Gibs auf".
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Die Zielsetzung ist die Beschreibung, Kritik und Demonstration der werkimmanenten Methode anhand eines konkreten Beispiels (Kafkas "Gibs auf").
- Quote paper
- Louisa Klose (Author), 2000, Werkimmanente, formalistische Methoden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5836