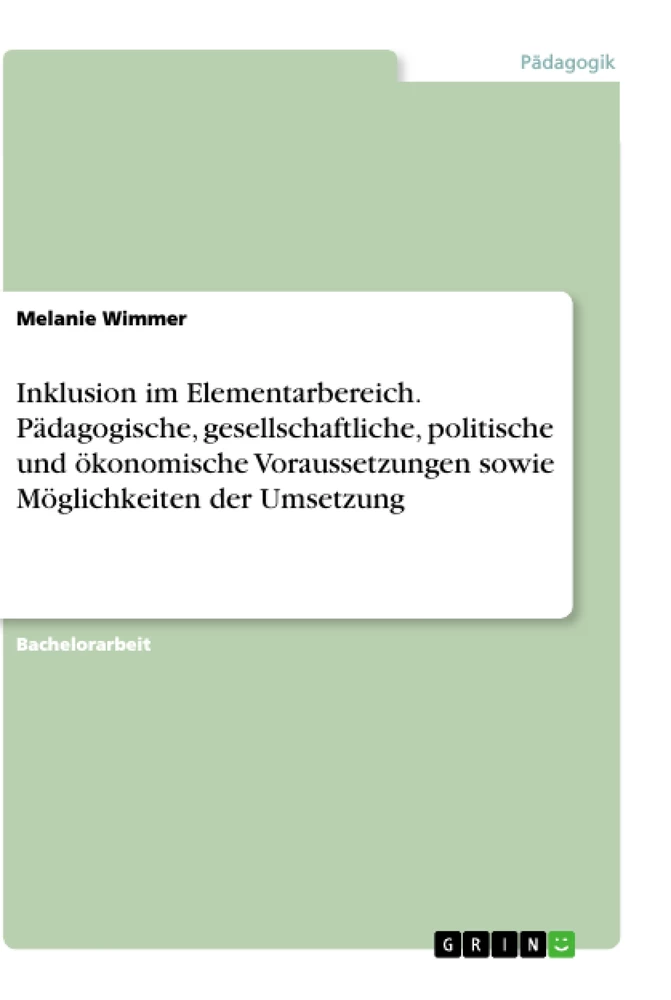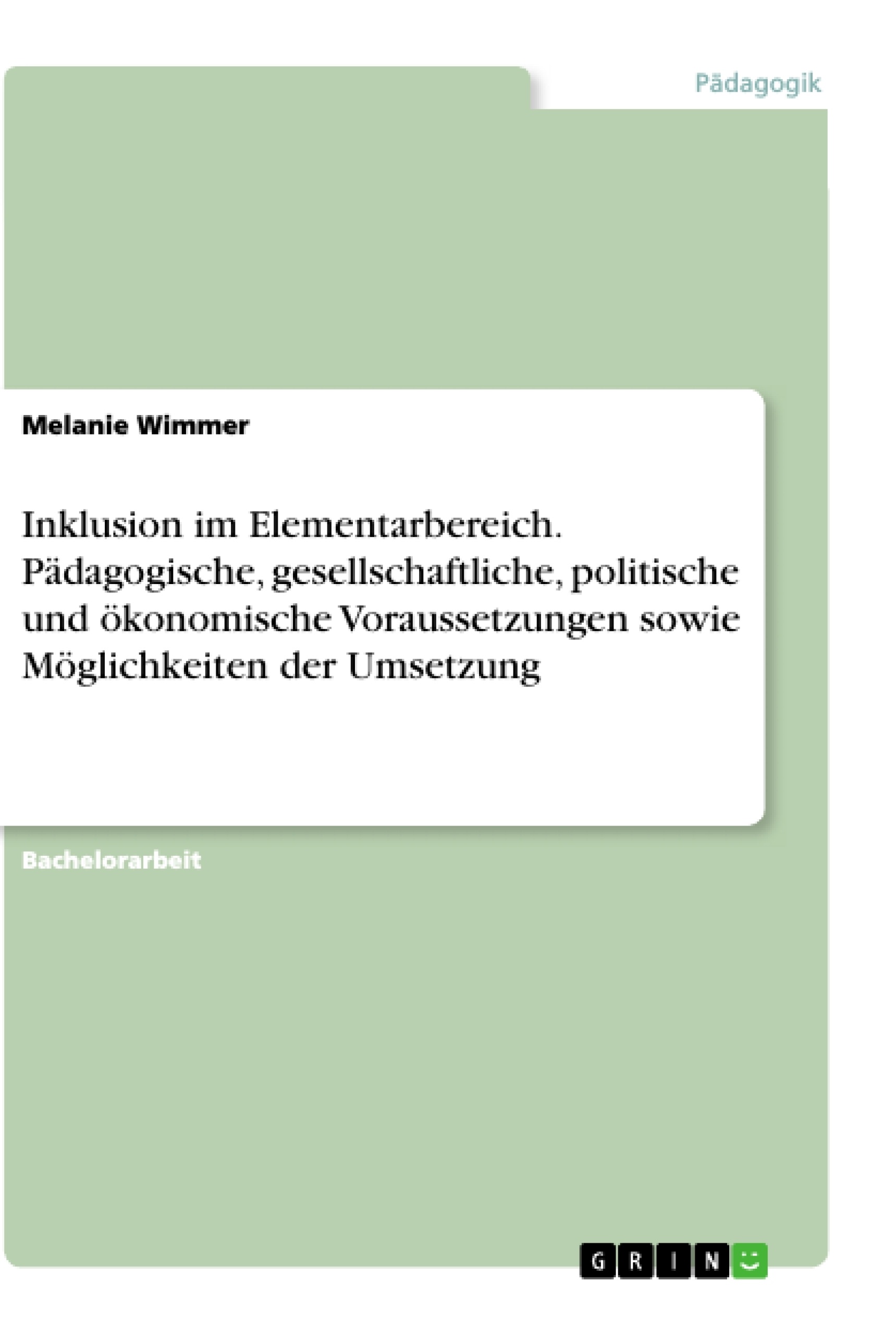Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Unterschied zwischen Integration und Inklusion und betrachtet diese auf Grundlage der vielen Heterogenitätsdimensionen. Aufgrund der Bedeutung von Inklusion von Geburt an und des neuen Bildungsverständnisses des Elementarbereichs befasst sich diese Arbeit zuerst mit den Aspekten der Heterogenität sowie des geschichtlichen Hintergrunds, welche zum heutigen Verständnis von Inklusion führten. Des Weiteren werden die einzelnen Bereiche, welche zur Umsetzung von Inklusion von Bedeutung sind, in Hinblick auf deren Voraussetzungen und Schwierigkeiten betrachtet. Die Ergebnisse der Rheinland-Kita-Studie fließen zusätzlich mit ein, wenn es um die Frage geht, wie Inklusion gelebt werden kann. Hierzu werden die Bereiche Pädagogik, Gesellschaft, Politik und Ökonomie eingehend auf ihre Voraussetzungen und Schwierigkeiten beleuchtet, um am Ende Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten.
Die Bedeutung der Kindertagesstätte als erster außerfamiliärer Bildungs- und Betreuungsort hat in jüngster Vergangenheit immer mehr zugenommen. Der Elementarbereich wird als eigener Bildungsbereich verstanden, um den Grundstein für Bildungs- und Chancengleichheit zu legen. Zudem rückt das Thema Inklusion immer stärker in den Fokus der Pädagogik. Ausgrenzung soll vermieden, umfassende Teilhabe ermöglicht werden. Hier ist auch die Betreuung in Kindertagesstätten zumeist der erste Ort, an welchem Kinder die Vielfalt der Gesellschaft erleben und erfahren können.
Der Begriff der Inklusion ist selbst in der Pädagogik oft nicht ausdifferenziert, wird unterschiedlich verstanden und somit Auswirkungen auf die pädagogische Praxis. Die Definition als auch Umsetzung inklusiver Pädagogik stellt alle Beteiligten vor neue Herausforderungen und Schwierigkeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung / Problemstellung
- Begriffsdefinition Behinderung
- Begriffsdefinition Heterogenität
- Heterogenitätsdimensionen in der Frühpädagogik
- Entwicklungsgefährdete Kinder
- Kinder mit besonderem Verhalten
- Sprachauffälligkeiten
- Mehrsprachige Kinder
- Sinnes- und Körperbeeinträchtigungen
- Von Armut bedrohte Familien
- Geschichtliche Hintergründe – von Exklusion zur Inklusion
- Begriffsdefinitionen Exklusion, Separation, Integration und Inklusion
- Exklusion
- Separation
- Integration
- Inklusion
- Unterscheidung zwischen Integration und Inklusion
- Voraussetzungen und Schwierigkeiten der Inklusion im Elementarbereich
- pädagogische Voraussetzungen und Schwierigkeiten
- gesellschaftliche Voraussetzungen und Schwierigkeiten
- politische Voraussetzungen und Schwierigkeiten
- Ökonomische Voraussetzungen und Schwierigkeiten
- Die Rheinland-Kita-Studie
- Ergebnisse der qualitativ-empirischen Onlinebefragung
- Ergebnisse der qualitativ-empirischen Vertiefungsstudie
- Ausblick der Studie
- Ergebnisse und Möglichkeiten der Umsetzung in der Praxis
- Pädagogische Möglichkeiten der Umsetzung in der Praxis
- Gesellschaftliche Möglichkeiten der Umsetzung in der Praxis
- Politische Möglichkeiten der Umsetzung in der Praxis
- Ökonomische Möglichkeiten der Umsetzung in der Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Voraussetzungen und Möglichkeiten der Umsetzung von Inklusion im Elementarbereich unter Berücksichtigung pädagogischer, gesellschaftlicher, politischer und ökonomischer Aspekte. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen von Inklusion zu entwickeln und Handlungsempfehlungen abzuleiten.
- Heterogenität in der Frühpädagogik
- Geschichtliche Entwicklung von Exklusion zu Inklusion
- Unterschiede zwischen Integration und Inklusion
- Voraussetzungen und Schwierigkeiten der Inklusion in verschiedenen Bereichen
- Möglichkeiten der Umsetzung von Inklusion in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung / Problemstellung: Die Einleitung betont die wachsende Bedeutung von Kindertagesstätten und den Fokus auf Inklusion. Sie verdeutlicht die Uneinheitlichkeit des Inklusionsbegriffs und die damit verbundenen Herausforderungen in der pädagogischen Praxis. Die Arbeit untersucht die Heterogenitätsdimensionen, den historischen Hintergrund von Inklusion und die relevanten Bereiche (Pädagogik, Gesellschaft, Politik, Ökonomie) hinsichtlich ihrer Voraussetzungen und Schwierigkeiten, wobei die Ergebnisse der Rheinland-Kita-Studie berücksichtigt werden.
Begriffsdefinition Behinderung: Dieses Kapitel definiert Behinderung im Kontext der UN-BRK, unterstreicht die Bedeutung des gesellschaftlichen Aspekts und die Abhängigkeit des Behinderungsbegriffs vom Verständnis für Menschen mit Behinderung. Es wird hervorgehoben, dass Behinderung nicht nur eine individuelle Eigenschaft ist, sondern im Kontext von gesellschaftlichen Barrieren und Teilhabemöglichkeiten zu sehen ist.
Begriffsdefinition Heterogenität: Der Begriff der Heterogenität wird als zentral für das Verständnis von Inklusion und ihren Dimensionen eingeführt. Die kurze Erläuterung bildet die Grundlage für die folgenden Kapitel, die sich mit den verschiedenen Aspekten der Heterogenität in der Frühpädagogik auseinandersetzen.
Heterogenitätsdimensionen in der Frühpädagogik: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Dimensionen von Heterogenität in der Frühpädagogik, wie z.B. entwicklungsgefährdete Kinder, Kinder mit besonderem Verhalten, Kinder mit Sprachauffälligkeiten, mehrsprachige Kinder, Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigungen und Kinder aus armutsbetroffenen Familien. Es liefert einen Überblick über die vielfältigen Herausforderungen und Bedürfnisse von Kindern im Elementarbereich.
Geschichtliche Hintergründe – von Exklusion zur Inklusion: Dieses Kapitel verfolgt den geschichtlichen Wandel vom Ausschluss (Exklusion) bis hin zum Konzept der Inklusion. Es wird die Entwicklung des Verständnisses von Behinderung und die sich verändernden gesellschaftlichen Einstellungen beleuchtet. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der historischen Prozesse, die zum heutigen Verständnis von Inklusion geführt haben.
Begriffsdefinitionen Exklusion, Separation, Integration und Inklusion: Dieses Kapitel differenziert die Begriffe Exklusion, Separation, Integration und Inklusion und verdeutlicht die Unterschiede zwischen diesen Konzepten, insbesondere zwischen Integration und Inklusion. Es liefert eine konzeptionelle Grundlage für die weiteren Analysen der Arbeit.
Unterscheidung zwischen Integration und Inklusion: Dieses Kapitel vertieft die Unterscheidung zwischen Integration und Inklusion, indem es die jeweiligen Konzepte detailliert gegenüberstellt und die Unterschiede in der Praxis herausarbeitet. Es werden die impliziten Annahmen und Zielsetzungen beider Konzepte beleuchtet.
Voraussetzungen und Schwierigkeiten der Inklusion im Elementarbereich: Dieses Kapitel analysiert die Voraussetzungen und Schwierigkeiten der Inklusion im Elementarbereich aus pädagogischer, gesellschaftlicher, politischer und ökonomischer Perspektive. Es werden die verschiedenen Faktoren beleuchtet, die den Erfolg oder Misserfolg inklusiver Maßnahmen beeinflussen können. Die Analyse wird durch die Ergebnisse der Rheinland-Kita-Studie ergänzt.
Schlüsselwörter
Inklusion, Elementarbereich, Frühpädagogik, Heterogenität, Behinderung, Integration, Exklusion, pädagogische Voraussetzungen, gesellschaftliche Voraussetzungen, politische Voraussetzungen, ökonomische Voraussetzungen, Rheinland-Kita-Studie, Teilhabe, Chancengleichheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Inklusion im Elementarbereich
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Voraussetzungen und Möglichkeiten der Umsetzung von Inklusion im Elementarbereich. Sie betrachtet pädagogische, gesellschaftliche, politische und ökonomische Aspekte und zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen von Inklusion zu entwickeln sowie Handlungsempfehlungen abzuleiten. Die Arbeit bezieht sich stark auf die Ergebnisse der Rheinland-Kita-Studie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt diverse Themen, darunter: die Definition von Behinderung und Heterogenität; die geschichtlichen Hintergründe von Exklusion zu Inklusion; die Unterschiede zwischen Integration und Inklusion; die verschiedenen Dimensionen der Heterogenität in der Frühpädagogik (z.B. Entwicklung, Sprache, Sinnesbeeinträchtigungen, Armut); die Voraussetzungen und Schwierigkeiten der Inklusion aus verschiedenen Perspektiven (pädagogisch, gesellschaftlich, politisch, ökonomisch); und schließlich Möglichkeiten zur Umsetzung von Inklusion in der Praxis.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine Literaturrecherche und die Auswertung der Rheinland-Kita-Studie, die sowohl qualitative Online-Befragungen als auch vertiefende qualitative Studien umfasst. Die Ergebnisse dieser Studie fliessen in die Analyse der Voraussetzungen und Schwierigkeiten der Inklusion ein.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung/Problemstellung, Begriffsdefinitionen (Behinderung, Heterogenität), Heterogenitätsdimensionen in der Frühpädagogik, geschichtliche Entwicklung von Exklusion zu Inklusion, Unterschiede zwischen Integration und Inklusion, Voraussetzungen und Schwierigkeiten der Inklusion (mit Unterteilung nach pädagogischen, gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Aspekten), die Darstellung der Rheinland-Kita-Studie und abschließend Ergebnisse und Möglichkeiten der Umsetzung in der Praxis.
Welche zentralen Begriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert zentrale Begriffe wie Behinderung (im Kontext der UN-BRK), Heterogenität, Exklusion, Separation, Integration und Inklusion. Die Definitionen legen die Grundlage für die weitere Analyse und Diskussion.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Rheinland-Kita-Studie?
Die Arbeit fasst die Ergebnisse der Rheinland-Kita-Studie zusammen, sowohl der Online-Befragung als auch der Vertiefungsstudie. Diese Ergebnisse werden genutzt, um die Voraussetzungen und Schwierigkeiten der Inklusion im Elementarbereich zu beleuchten und Handlungsempfehlungen abzuleiten. Konkrete Ergebnisse der Studie werden jedoch nicht explizit in den FAQs aufgeführt, sondern sind im Haupttext der Arbeit nachzulesen.
Welche Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Die Arbeit leitet Handlungsempfehlungen zur Umsetzung von Inklusion in der Praxis ab, die sich auf pädagogische, gesellschaftliche, politische und ökonomische Aspekte beziehen. Konkrete Empfehlungen sind im Haupttext der Arbeit zu finden.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Inklusion, Elementarbereich, Frühpädagogik, Heterogenität, Behinderung, Integration, Exklusion, pädagogische Voraussetzungen, gesellschaftliche Voraussetzungen, politische Voraussetzungen, ökonomische Voraussetzungen, Rheinland-Kita-Studie, Teilhabe, Chancengleichheit.
- Quote paper
- Melanie Wimmer (Author), 2019, Inklusion im Elementarbereich. Pädagogische, gesellschaftliche, politische und ökonomische Voraussetzungen sowie Möglichkeiten der Umsetzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/583403