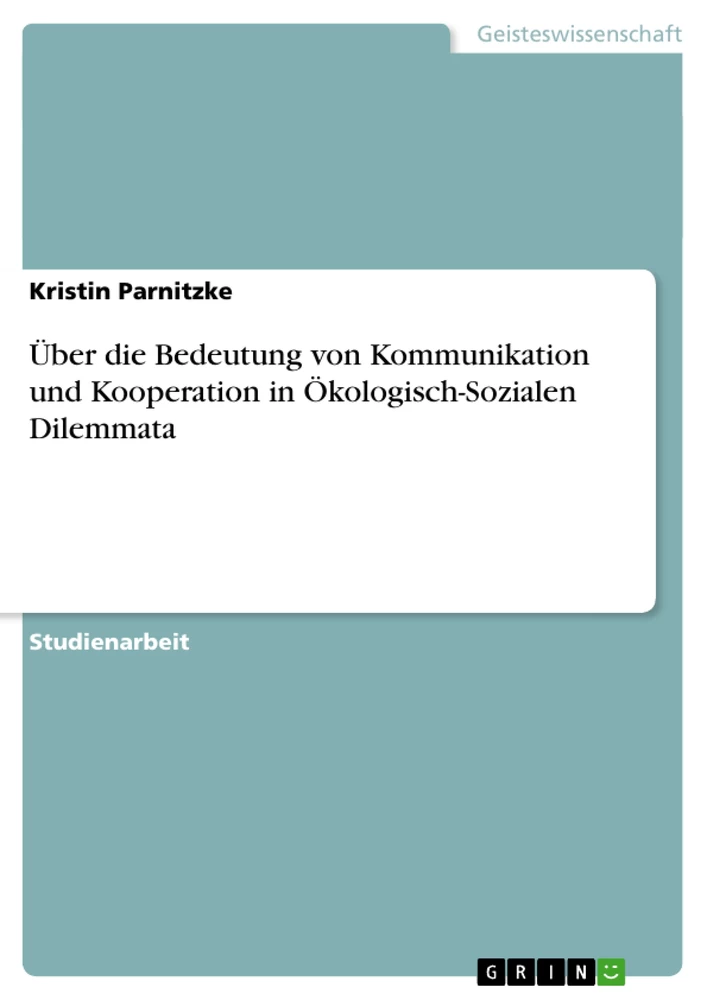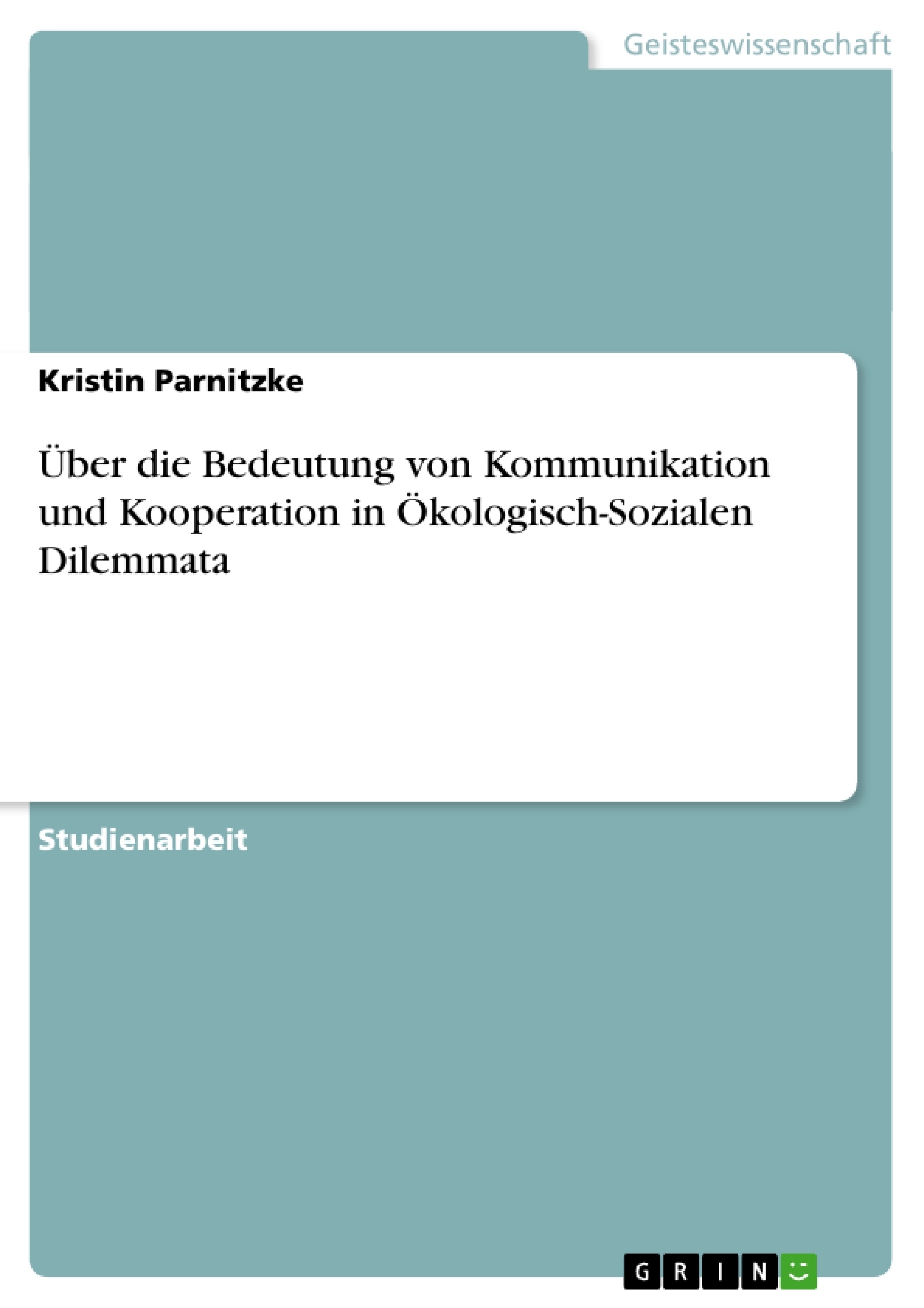n der Ökologischen Psychologie steht die Interdependenz zwischen Mensch und Umwelt im Mittelpunkt. Diese Mensch-Umwelt- Beziehung birgt großes Potential für Konflikte: Oftmals steht den Interessen des Einzelnen ein Schaden, der vor allem die Umwelt und oftmals eine ganze Gemeinschaft trifft, gegenüber. Zahlreiche Umweltprobleme sind Folge einer Situation, in der viele Akteure gemeinsam über eine knappe Ressource verfügen. Unter diesen Umständen ist die Neigung gering, in deren Erhalt zu investieren, und die Neigung groß, sich mehr als "nötig" von der Ressource anzueignen. Die Beispiele reichen von der Überfischung der Weltmeere, der Abholzung der tropischen Regenwälder und der Ausrottung gefährdeter Arten bis hin zum Treibhauseffekt und der damit verbundenen Klimagefährdung. Die Wichtigkeit der Kenntnis ökologischen Handelns bzw. der Folgen nicht-ökologischen Verhaltens zeigt sich an einem eindrucksvollen Beispiel: In einer Umweltbefragung von Diekmann und Preisendörfer (1992) in den Städten Bern und München wurde u.a. das Energiesparverhalten erhoben. Als Indikator für den sparsamen Umgang mit Heizenergie galt die Zustimmung zu der folgenden Frage: "Wenn Sie im Winter Ihre Wohnung für mehr als vier Stunden verlassen, drehen Sie da normalerweise die Heizung ab oder herunter?" Nur 23 Prozent der befragten Schweizer, dagegen aber 69 Prozent der Münchnerinnen und Münchner bejahten die Frage. Sollte diese enorme Differenz ein Zufall sein?
Sind die Bernerinnen und Berner vielleicht weniger umweltbewusst als die Bewohner der bayerischen Metropole? Dies ist nicht der Fall, denn beim Umweltbewusstsein erzielen die Berner keine geringeren Werte als die Münchner. Welche Determinanten bestimmen das Verhalten der Berner Bevölkerung bzw. das Umweltverhalten der Menschen überhaupt? Kann man Umweltverhalten produktiv/ kontraproduktiv beeinflussen? Wann verhalten wir uns kooperativ mit unseren Mitmenschen, unserer Umwelt?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Soziale Dilemmata
- 3. Ökologisch-Soziale Dilemmata
- 4. Das Handeln in ökologisch- sozialen Dilemmata aus handlungstheoretischer Sicht
- 5. Das Handeln in ökologisch-sozialen Dilemmata aus spieltheoretischer Sicht
- 6. Kommunikation und Kooperation als Einflussfaktoren auf umweltschonendes Verhalten in ökologisch- sozialen Dilemmata
- 6.1 Ein Experiment
- 6.2 Der Einfluss von Kommunikation im ökologisch- sozialen Dilemma
- 6.2.1 Kommunikation - Eine Begriffsbestimmung
- 6.2.2 Der Kommunikationseffekt auf Entscheidungsebene
- 6.2.3 Der Kommunikationseffekt auf der Lösungsebene
- 6.3 Der Einfluss von Kooperation im ökologisch-sozialen Dilemma
- 7. Zusammenfassung und Ergebnis
- 7.1 Die Ergebnisse aus handlungstheoretischer Sicht
- 7.2 Die Ergebnisse aus spieltheoretischer Sicht
- 8. Diskussion und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Kommunikation und Kooperation auf umweltgerechtes Verhalten im Kontext ökologisch-sozialer Dilemmata. Sie beleuchtet die Handlungsmotive und psychologischen Faktoren, die kooperatives Handeln in solchen Situationen beeinflussen. Die Arbeit stützt sich dabei auf handlungstheoretische und spieltheoretische Ansätze.
- Ökologisch-soziale Dilemmata und ihre Charakteristika
- Handlungstheoretische und spieltheoretische Perspektiven auf Handeln in Dilemmata
- Der Einfluss von Kommunikation auf umweltschonendes Verhalten
- Der Einfluss von Kooperation auf umweltschonendes Verhalten
- Empirische Befunde und deren Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der ökologisch-sozialen Dilemmata ein und hebt die Bedeutung der Interdependenz zwischen Mensch und Umwelt hervor. Sie präsentiert ein eindrucksvolles Beispiel unterschiedlichen Energiesparverhaltens in Bern und München, um die zentrale Forschungsfrage nach den Determinanten umweltgerechten Verhaltens aufzuwerfen. Die unterschiedlichen Abrechnungssysteme für Heizkosten in beiden Städten werden als mögliche Einflussfaktoren genannt, was die Komplexität des Themas verdeutlicht.
2. Soziale Dilemmata: Dieses Kapitel definiert soziale Dilemmata als Konfliktsituationen, in denen Eigeninteresse und Kollektivinteresse auseinanderklaffen. Es wird die Definition von Dawes (1980) vorgestellt, die die Struktur solcher Dilemmata prägnant beschreibt. Das Kapitel differenziert zwischen Nutzungs- und Beitragsdilemmata, wobei der Fokus auf der Herausforderung liegt, kollektiv günstiges Verhalten trotz individuellem Anreiz zum egoistischen Handeln zu erreichen. Die Komplexität der menschlichen Entscheidungsfindung in solchen Situationen wird herausgestellt.
3. Ökologisch-Soziale Dilemmata: Dieses Kapitel baut auf dem Verständnis sozialer Dilemmata auf und erweitert den Fokus auf ökologische Aspekte. Es werden konkrete Beispiele wie Überfischung, Abholzung und Treibhauseffekt genannt, um die Relevanz und Brisanz ökologisch-sozialer Dilemmata zu verdeutlichen. Der Kapitel vertieft die Herausforderungen, die sich aus der gemeinsamen Nutzung knapper Ressourcen ergeben und wie diese zu langfristigen Schäden für die Umwelt und die Gesellschaft führen können. Die Notwendigkeit, dieses Verhalten zu verstehen und zu beeinflussen, wird betont.
4. Das Handeln in ökologisch- sozialen Dilemmata aus handlungstheoretischer Sicht: Dieses Kapitel analysiert das Handeln in ökologisch-sozialen Dilemmata unter dem Blickwinkel der Handlungstheorie. Es untersucht die zugrundeliegenden Motive und Überzeugungen, die das Verhalten der Akteure beeinflussen. Die Handlungstheorie bietet einen Rahmen, um individuelle Entscheidungen im Kontext sozialer Normen und Werte zu verstehen. Wahrscheinlich wird die Rolle von individuellen Überzeugungen, sozialen Normen und der Wahrnehmung der Situation ausführlich behandelt.
5. Das Handeln in ökologisch-sozialen Dilemmata aus spieltheoretischer Sicht: Dieses Kapitel wendet spieltheoretische Modelle an, um das Handeln in ökologisch-sozialen Dilemmata zu analysieren. Es untersucht die strategischen Interaktionen zwischen den Akteuren und die möglichen Ergebnisse verschiedener Verhaltensweisen. Die spieltheoretische Perspektive beleuchtet die Herausforderungen der Kooperation in Situationen, in denen der individuelle Nutzen kurzfristig durch Defektion maximiert werden kann. Das Kapitel wahrscheinlich die Grenzen der individuellen Rationalität im Kontext kollektiver Handlungserfordernisse.
6. Kommunikation und Kooperation als Einflussfaktoren auf umweltschonendes Verhalten in ökologisch- sozialen Dilemmata: Dieses Kapitel steht im Zentrum der Arbeit und untersucht den Einfluss von Kommunikation und Kooperation auf umweltschonendes Verhalten. Es analysiert, wie Kommunikation auf verschiedenen Ebenen (Entscheidungsebene und Lösungsebene) wirkt und wie Kooperation durch soziale Normen, Anreize, Vertrauen und Attributionen gefördert werden kann. Ein empirisches Experiment wird vorgestellt und dessen Ergebnisse interpretiert, um die Wirksamkeit von Kommunikations- und Kooperationsstrategien zu belegen.
Schlüsselwörter
Ökologisch-soziale Dilemmata, Kommunikation, Kooperation, Umweltverhalten, Handlungstheorie, Spieltheorie, Ressourcenmanagement, soziale Normen, kollektives Handeln, Umweltpsychologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss von Kommunikation und Kooperation auf umweltgerechtes Verhalten in ökologisch-sozialen Dilemmata
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Kommunikation und Kooperation auf umweltgerechtes Verhalten im Kontext ökologisch-sozialer Dilemmata. Sie beleuchtet die Handlungsmotive und psychologischen Faktoren, die kooperatives Handeln in solchen Situationen beeinflussen und stützt sich dabei auf handlungstheoretische und spieltheoretische Ansätze.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt ökologisch-soziale Dilemmata und ihre Charakteristika, handlungstheoretische und spieltheoretische Perspektiven auf Handeln in Dilemmata, den Einfluss von Kommunikation und Kooperation auf umweltschonendes Verhalten sowie empirische Befunde und deren Interpretation.
Welche Arten von Dilemmata werden betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf ökologisch-soziale Dilemmata, die als Konfliktsituationen definiert werden, in denen Eigeninteresse und Kollektivinteresse auseinanderklaffen. Es werden sowohl Nutzungs- als auch Beitragsdilemmata betrachtet, mit konkreten Beispielen wie Überfischung, Abholzung und dem Treibhauseffekt.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit nutzt handlungstheoretische und spieltheoretische Ansätze, um das Handeln in ökologisch-sozialen Dilemmata zu analysieren. Die Handlungstheorie hilft, die zugrundeliegenden Motive und Überzeugungen zu verstehen, während die Spieltheorie die strategischen Interaktionen zwischen den Akteuren und die möglichen Ergebnisse verschiedener Verhaltensweisen beleuchtet.
Welche Rolle spielen Kommunikation und Kooperation?
Das zentrale Thema ist der Einfluss von Kommunikation und Kooperation auf umweltschonendes Verhalten. Die Arbeit analysiert, wie Kommunikation auf verschiedenen Ebenen (Entscheidungsebene und Lösungsebene) wirkt und wie Kooperation durch soziale Normen, Anreize, Vertrauen und Attributionen gefördert werden kann. Ein empirisches Experiment untersucht die Wirksamkeit von Kommunikations- und Kooperationsstrategien.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse aus handlungstheoretischer und spieltheoretischer Sicht, interpretiert die Ergebnisse des empirischen Experiments und diskutiert die Implikationen für das Verständnis und die Beeinflussung umweltgerechten Verhaltens.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zu sozialen und ökologisch-sozialen Dilemmata. Es folgen Kapitel zur handlungstheoretischen und spieltheoretischen Analyse, dem zentralen Kapitel über Kommunikation und Kooperation (inkl. eines Experiments), einer Zusammenfassung der Ergebnisse, Diskussion und einem Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ökologisch-soziale Dilemmata, Kommunikation, Kooperation, Umweltverhalten, Handlungstheorie, Spieltheorie, Ressourcenmanagement, soziale Normen, kollektives Handeln, Umweltpsychologie.
- Quote paper
- Kristin Parnitzke (Author), 2006, Über die Bedeutung von Kommunikation und Kooperation in Ökologisch-Sozialen Dilemmata, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58189