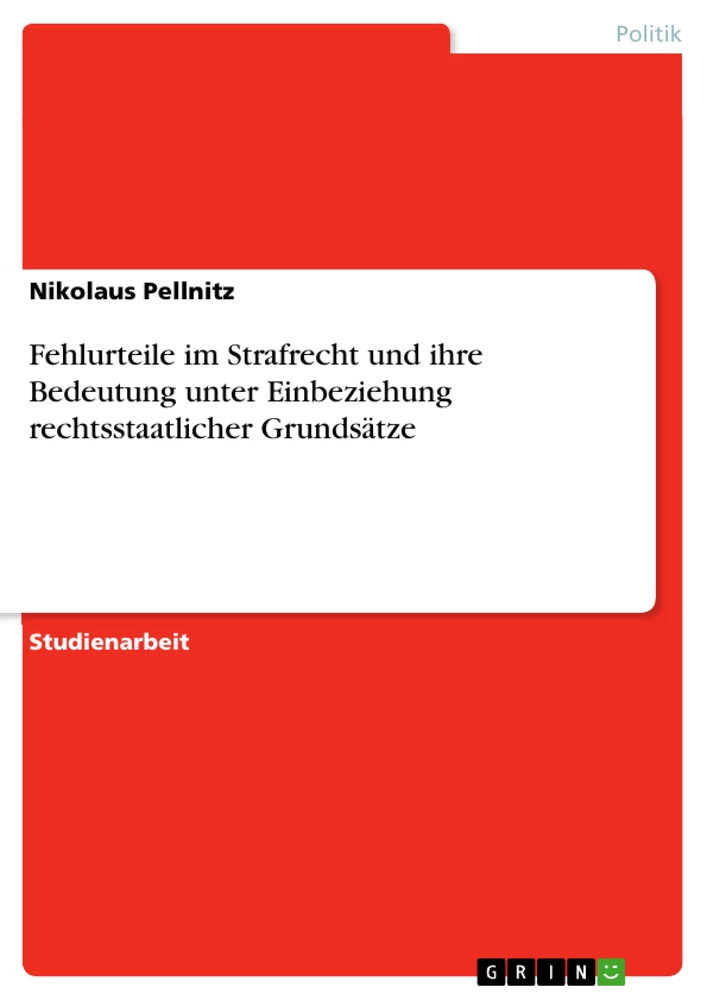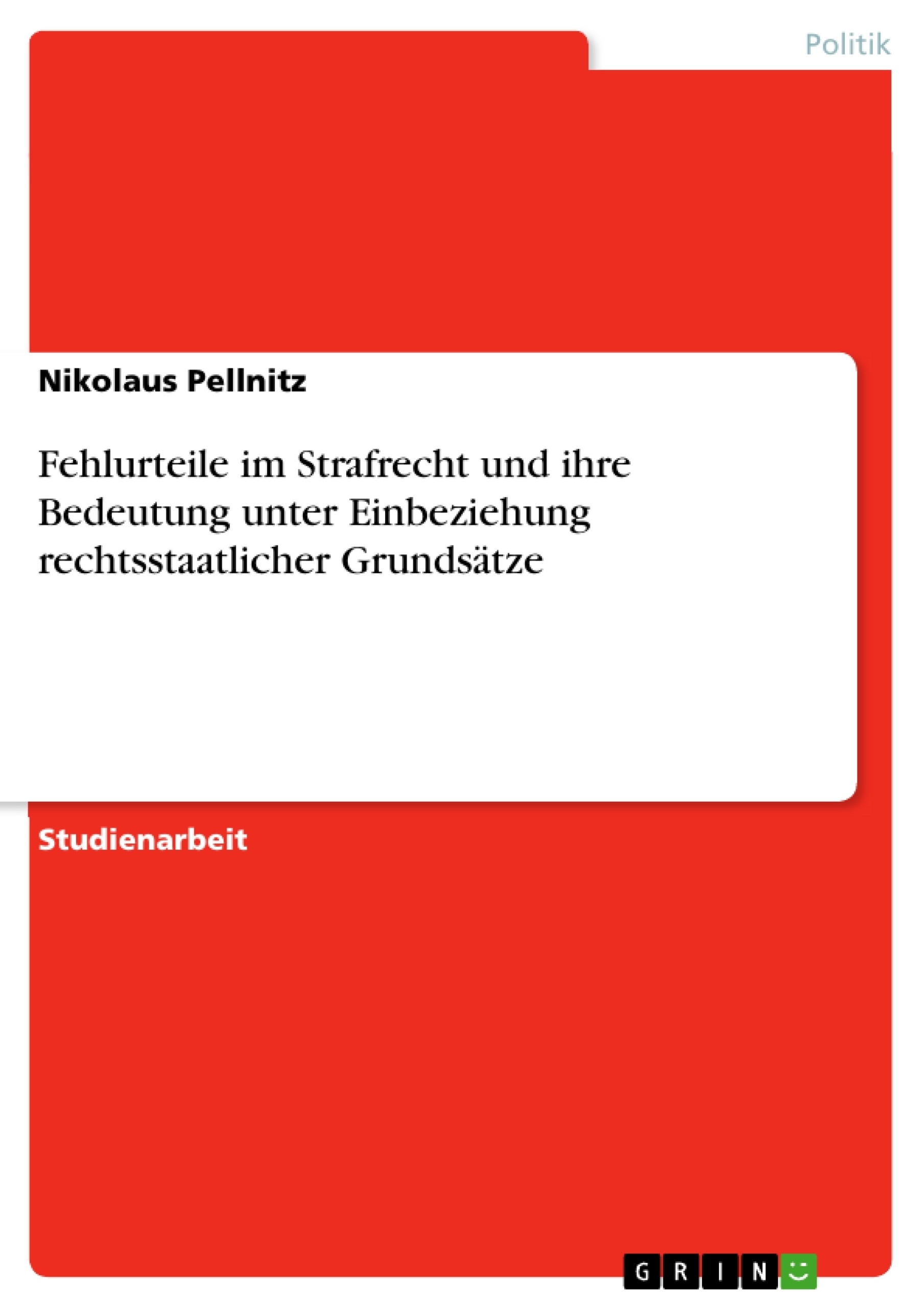Nicht nur wegen der auch in der breiten Medienöffentlichkeit immer wieder thematisierten Verschärfung staatsanwaltschaftlicher und polizeilicher Ermittlungsmethoden stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis Rechtstaatlichkeit und Strafrecht zueinander stehen. Daneben gibt es zahlreiche weitere Gründe, die eine nähere Untersuchung der Konsequenzen der Rechtsstaatlichkeit für das Strafrecht interessant machen. Ein Beispiel ist die immer wieder diskutierte Ungleichbehandlung politischer Straftäter von links und rechts durch die Justiz. Bei näherer Betrachtung ist auffällig, dass die Beachtung strafrechtlicher Fehlurteile durch die Wissenschaft als eher gering einzustufen ist. Dieser Arbeit soll daher genau die Fragestellung „Wo liegt die Bedeutung strafrechtlicher Fehlurteile aus rechtsstaatlicher Sicht?“ zugrunde liegen. Dieser Frage wird mit der Methode der Analyse von Sekundärliteratur nachgegangen. Die letzten ausführlicheren, deutschsprachigen, sekundärliterarischen Veröffentlichungen, die sich mit Gesetzmäßigkeiten und Ursachen strafrechtlicher Justizirrtümer befassen, stammen aus den 1960er und 1970er Jahren - diese Quellen waren daher auch dahingehend, ob ihre Inhalte heute noch Aktualität haben, kritisch zu betrachten. Aussagen, die heute „von der Realität überholt“ sind, sollten schließlich in dieser Arbeit nicht übernommen werden. Zwar gibt es durchaus aktuelle wissenschaftliche Arbeiten zu dem Verhältnis von Rechtsstaatlichkeit und Strafrecht zueinander, konkret der Bedeutung von strafrechtlichen Fehlurteilen aus rechtsstaatlicher Sicht ist in der deutschensprachigen, wissenschaftlichen Literatur der letzten Jahrzehnte jedoch wenig Beachtung geschenkt worden. Minna Hatakkas Dissertation Das Risiko der fehlerhaften Entscheidungaus dem Jahre 1995 bildet hier eine Ausnahme.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fehlurteile im Strafrecht – eine Definition
- Ursachen und Gesetzmäßigkeiten von Fehlurteilen im Strafrecht
- Strafrecht und Rechtsstaatlichkeit
- Die Bedeutung von strafrechtlichen Fehlurteilen im Kontext der Rechtsstaatlichkeit
- Zur derzeitigen Situation in der Bundesrepublik Deutschland
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung strafrechtlicher Fehlurteile aus rechtsstaatlicher Perspektive. Sie analysiert die Ursachen und Gesetzmäßigkeiten solcher Fehlurteile und betrachtet deren Kontext innerhalb des deutschen Rechtssystems. Die Arbeit basiert auf der Analyse bestehender Sekundärliteratur.
- Definition und Abgrenzung strafrechtlicher Fehlurteile
- Ursachen und Muster von Fehlurteilen im Strafprozess
- Zusammenhang zwischen Fehlurteilen und rechtsstaatlichen Prinzipien
- Bewertung der Bedeutung von Fehlurteilen für die Rechtsstaatlichkeit
- Aktuelle Situation in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Fehlurteilen im Strafrecht im Kontext der Rechtsstaatlichkeit. Die geringe wissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Thema in der jüngeren Vergangenheit wird hervorgehoben, und die Arbeit begründet ihre Fokussierung auf die Analyse bestehender Sekundärliteratur, wobei die Aktualität der Quellen kritisch geprüft wird. Die Schwierigkeit, aktuelle deutschsprachige Literatur zum Thema zu finden, wird ebenfalls thematisiert, mit Ausnahme der Dissertation von Minna Hatakka aus dem Jahr 1995.
Fehlurteile im Strafrecht – eine Definition: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Fehlurteil" im Strafrecht. Es betont den Grundsatz "in dubio pro reo" und erklärt, dass nicht jede Entscheidung, die bei Kenntnis des vollständigen Sachverhalts anders ausgefallen wäre, automatisch als Fehlurteil gilt. Der Fokus liegt auf ungerechtfertigten Verurteilungen. Freisprüche und mildere Urteile werden nur in Ausnahmefällen als Fehlurteile betrachtet, nämlich wenn die Unrichtigkeit eine Wiederaufnahme des Verfahrens zulässig macht (Kiwit 1965: 77ff).
Ursachen und Gesetzmäßigkeiten von Fehlurteilen im Strafrecht: Das Kapitel befasst sich mit den Ursachen und Gesetzmäßigkeiten von Fehlurteilen. Es wird betont, dass ein fehlerfreies Rechtssystem unmöglich ist und dass die materielle und formelle Wahrheit selten identisch sind. Die Arbeit diskutiert die Unsicherheit von Richtern und Geschworenen über die Übereinstimmung von materieller und formeller Wahrheit. Weitere Faktoren wie öffentlicher Druck und emotionale Einflüsse werden als begünstigende Faktoren für Justizirrtümer genannt (Hirschberg 1962: 129ff; Peters 1972: 290ff). Schließlich werden Mängel in der Beweisaufnahme, insbesondere falsche Geständnisse und fehlerhafte Zeugenaussagen, als häufige Ursachen für Fehlurteile identifiziert (Peters 1972: 1ff, 5ff, 38ff).
Strafrecht und Rechtsstaatlichkeit: Dieses Kapitel dürfte den Zusammenhang zwischen Strafrecht und Rechtsstaatlichkeit erörtern. Es wird vermutlich den Stellenwert des Schutzes des Einzelnen vor Justizirrtümern im Kontext der Rechtsstaatlichkeit beleuchten und die Spannungsfelder zwischen effektiver Strafverfolgung und dem Schutz der Bürgerrechte diskutieren. Der genaue Inhalt lässt sich aus dem vorliegenden Textausschnitt nicht vollständig erschließen.
Die Bedeutung von strafrechtlichen Fehlurteilen im Kontext der Rechtsstaatlichkeit: Dieser Abschnitt wird die Konsequenzen von Fehlurteilen für das Vertrauen in die Justiz und die Rechtsstaatlichkeit analysieren. Es wird wahrscheinlich die Bedeutung von fehlerfreien Gerichtsentscheidungen für die Legitimität und Akzeptanz des Rechtssystems beleuchten und die Notwendigkeit von Mechanismen zur Vermeidung und Korrektur von Fehlurteilen diskutieren. Der genaue Inhalt lässt sich aus dem vorliegenden Textausschnitt nicht vollständig erschließen.
Zur derzeitigen Situation in der Bundesrepublik Deutschland: Dieses Kapitel wird die aktuelle Situation in Deutschland bezüglich strafrechtlicher Fehlurteile beleuchten. Es wird wahrscheinlich Statistiken und Fallbeispiele betrachten, um die Häufigkeit und Art von Fehlurteilen zu untersuchen, sowie die Maßnahmen zur Vermeidung und Korrektur solcher Fehler im deutschen Rechtssystem bewerten. Der genaue Inhalt lässt sich aus dem vorliegenden Textausschnitt nicht vollständig erschließen.
Schlüsselwörter
Fehlurteile, Strafrecht, Rechtsstaatlichkeit, Justizirrtum, Beweisaufnahme, Zeugenaussagen, Geständnis, in dubio pro reo, materielle Wahrheit, formelle Wahrheit, Rechtsstaatsprinzipien, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Fehlurteile im Strafrecht – eine rechtsstaatliche Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Bedeutung strafrechtlicher Fehlurteile aus rechtsstaatlicher Perspektive. Sie untersucht die Ursachen und Gesetzmäßigkeiten solcher Fehlurteile und deren Kontext innerhalb des deutschen Rechtssystems, basierend auf der Analyse bestehender Sekundärliteratur.
Wie definiert die Arbeit "Fehlurteil" im Strafrecht?
Die Arbeit definiert Fehlurteile als ungerechtfertigte Verurteilungen. Nicht jede Entscheidung, die mit vollständigem Sachverhalt anders ausgefallen wäre, zählt dazu. Der Grundsatz "in dubio pro reo" ist zentral. Freisprüche/mildere Urteile gelten nur ausnahmsweise als Fehlurteile (wenn die Unrichtigkeit eine Wiederaufnahme erlaubt).
Welche Ursachen für Fehlurteile werden behandelt?
Die Arbeit betont, dass ein fehlerfreies Rechtssystem unmöglich ist und die materielle und formelle Wahrheit selten identisch sind. Diskutiert werden Unsicherheit von Richtern/Geschworenen, öffentlicher Druck, emotionale Einflüsse, Mängel in der Beweisaufnahme (falsche Geständnisse, fehlerhafte Zeugenaussagen).
Wie wird der Zusammenhang zwischen Fehlurteilen und Rechtsstaatlichkeit dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet den Stellenwert des Schutzes vor Justizirrtümern im Kontext der Rechtsstaatlichkeit. Es werden die Spannungsfelder zwischen effektiver Strafverfolgung und dem Schutz der Bürgerrechte diskutiert, sowie die Konsequenzen von Fehlurteilen für das Vertrauen in die Justiz und die Akzeptanz des Rechtssystems.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Fehlurteile im Strafrecht – eine Definition, Ursachen und Gesetzmäßigkeiten von Fehlurteilen im Strafrecht, Strafrecht und Rechtsstaatlichkeit, Die Bedeutung von strafrechtlichen Fehlurteilen im Kontext der Rechtsstaatlichkeit, Zur derzeitigen Situation in der Bundesrepublik Deutschland.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fehlurteile, Strafrecht, Rechtsstaatlichkeit, Justizirrtum, Beweisaufnahme, Zeugenaussagen, Geständnis, in dubio pro reo, materielle Wahrheit, formelle Wahrheit, Rechtsstaatsprinzipien, Deutschland.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Analyse bestehender Sekundärliteratur. Die Aktualität der Quellen wird kritisch geprüft. Die Schwierigkeit, aktuelle deutschsprachige Literatur zu finden, wird thematisiert, mit Ausnahme der Dissertation von Minna Hatakka (1995).
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Zusammenfassung der Kapitel beschreibt jeweils den Kerninhalt jedes Kapitels, beginnend mit der Einleitung, die die geringe wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema in der jüngeren Vergangenheit hervorhebt. Die Kapitelzusammenfassungen beschreiben die zentralen Fragestellungen und Ansätze der jeweiligen Kapitel.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung strafrechtlicher Fehlurteile aus rechtsstaatlicher Perspektive, analysiert deren Ursachen und Gesetzmäßigkeiten und betrachtet deren Kontext im deutschen Rechtssystem.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere detaillierte Informationen finden Sie im vollständigen Text der Arbeit.
- Citar trabajo
- Nikolaus Pellnitz (Autor), 2006, Fehlurteile im Strafrecht und ihre Bedeutung unter Einbeziehung rechtsstaatlicher Grundsätze, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58009