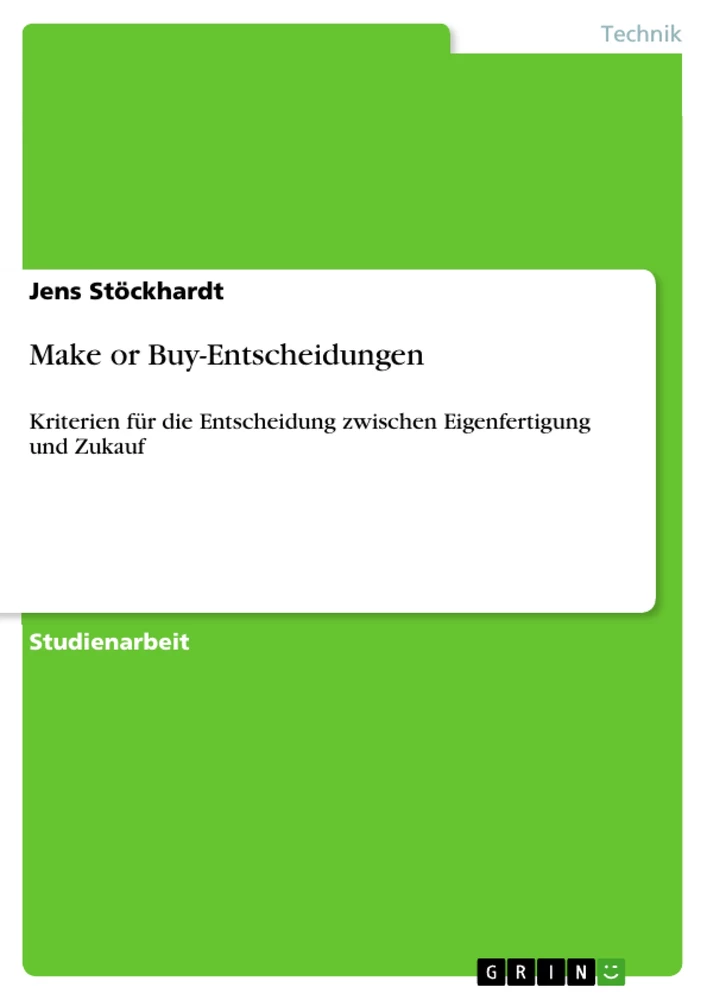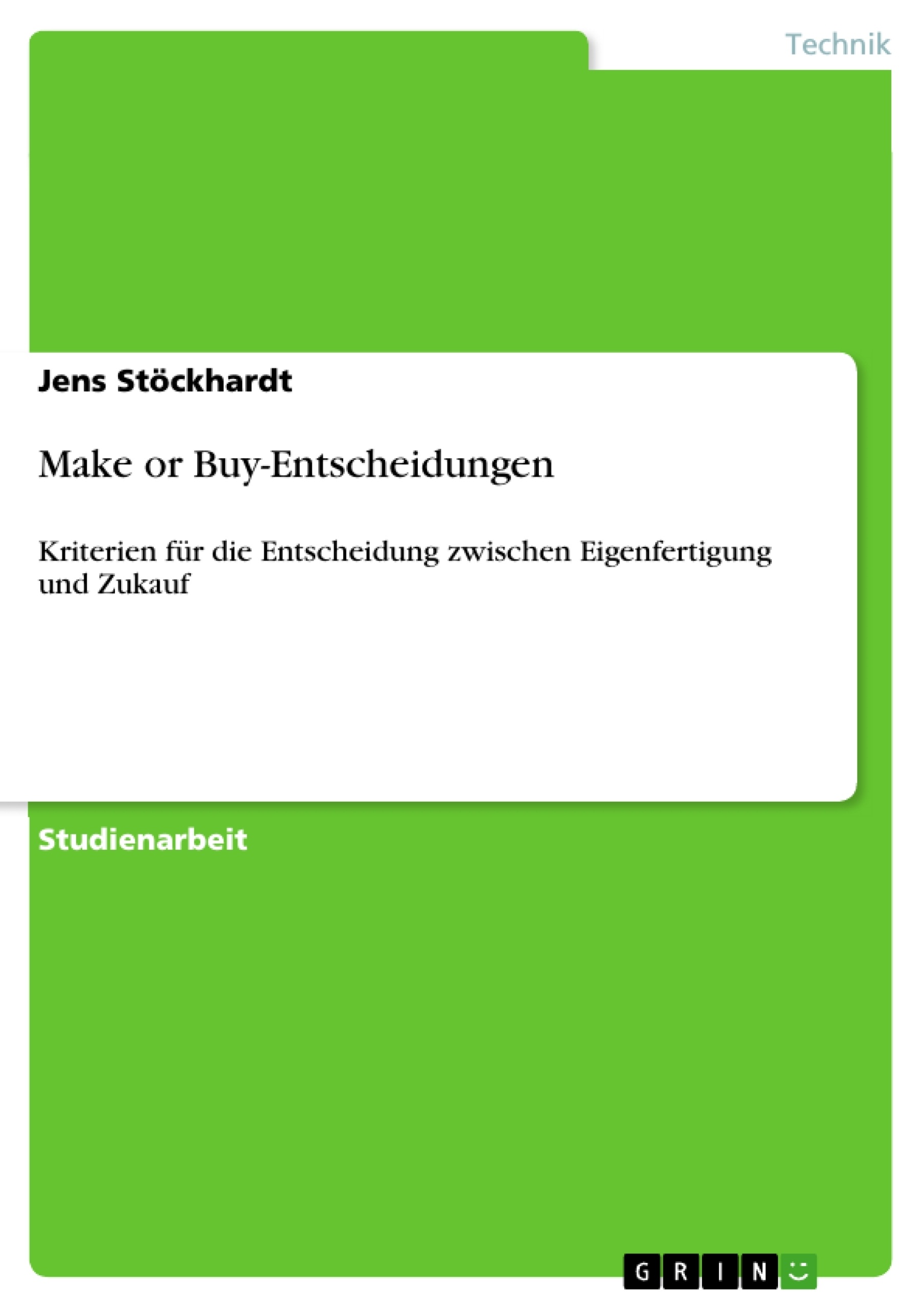Durch immer kürzer werdende Produktlebenszyklen und ständig wachsenden Druck der Konkurrenz, werden Unternehmen gezwungen ihre Fertigungsprozesse immer weiter zu optimieren. Die zunehmende Globalisierung der Märkte spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Auf der einen Seite eröffnen sich dem Produzenten neue Absatzmärkte, andererseits entsteht ein Kostendruck auf den eigenen Betrieb durch Hersteller bzw. Dienstleister, welche gleiche Produkte kostengünstiger herstellen oder Dienstleistungen günstiger anbieten können, als es im eigenen Betrieb möglich wäre. Vor allem Hersteller im osteuropäischen und asiatischen Raum setzen viele Betriebe unter Kostendruck, da der Produktionsfaktor Arbeit und dadurch auch die Produktion in Asien und Osteuropa weitaus günstiger ist. Der Konsument bzw. Bezieher von Produkten oder Teilen kann diesen Effekt jedoch größtenteils zu seinem Vorteil nutzen, da er Teile preiswerter beziehen kann.
Durch diese wirtschaftlichen Gegebenheiten wird eine Reduzierung der Prozesskosten, also der Kosten für die Durchführung der Entwicklung von Produkten, der Herstellung sowie der damit verbundenen Tätigkeiten, für die meisten Betriebe lebensnotwendig, um am globalen Markt zu bestehen.
Als ein Ansatzpunkt wird dabei von vielen Firmen die Fremdvergabe von Dienstleistungen und Produktionsaufträgen innerhalb des Betriebes an auf diese Aufgabe spezialisierte Firmen angesehen. Vor allem betriebszweckfremde Tätigkeiten werden häufig an externe Firmen übertragen. Beispielsweise werden bei den meisten Automobilherstellern Aufgaben wie Reinigung oder Catering durch eigenständige Firmen übernommen.
Ziel dieser Arbeit soll sein, die Begriffe der Selbstherstellung und des Fremdbezugs näher zu betrachten und einen Überblick über die Motive für eine Fremdvergabe – aber auch damit einhergehende Risiken – zu geben. Damit verbunden sollen die Verantwortung des Konstrukteurs sowie das Vertrauensverhältnis zu den Zulieferern betrachtet werden. Weiterhin sollen mögliche Kriterien für eine Entscheidung zwischen den beiden Formen dargestellt werden. Eine Entscheidung ist hierbei natürlich in allen Industriezweigen möglich und auch erforderlich, doch sollen vor allem die „zusammenbauenden“ Industrien im Vordergrund stehen, da hier eine Vielzahl unterschiedlicher Teile in das Produkt eingehen und demzufolge auch die Bedeutung eindeutig höher angesehen werden muss.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 DER BEGRIFF DER MAKE-OR-BUY-ENTSCHEIDUNG
- 2.1 Charakterisierung von Make-or-Buy-Entscheidungen
- 2.2 Make-or-Buy - Entscheidungsobjekte
- 2.2.1 Wirtschaftszweige
- 2.2.2 Unternehmensbereiche in den zusammenbauenden Industrien
- 2.3 Vertikale Integration, Outsourcing und verwandte Begriffe
- 2.4 Schwierigkeiten und Grenzen der Wahlmöglichkeiten
- 2.5 Gründe für Make-or-Buy-Betrachtungen
- 3 KRITERIEN FÜR DIE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG
- 3.1 Entscheidungshilfen aus Kostensicht
- 3.1.1 Kurzfristige Make-or-Buy-Entscheidungen
- 3.1.2 Langfristige Make-or-Buy-Entscheidungen
- 3.2 Entscheidungen aus Sicht der Transaktionskostentheorie
- 3.3 Wertmäßig nicht fassbare Kriterien - strategische Kriterien
- 3.3.1 Beschaffungsmarktbezogene Kriterien
- 3.3.2 Absatzmarktbezogene Kriterien
- 3.3.3 Unternehmensbezogene Kriterien
- 3.4 Strategie zur Entscheidungsfindung
- 4 VERANTWORTUNG DES KONSTRUKTEURS BEI DER PLANUNG
- 5 ENTWICKLUNGSTRENDS
- 6 VERTRAUENSVERHÄLTNIS ZU DEN ZULIEFERERN - ZERTIFIZIERUNG
- 7 FAZIT
- 8 ANHANG
- 8.1 Literaturverzeichnis
- 8.2 Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Entscheidung zwischen Eigenfertigung (Make) und Fremdbezug (Buy) – eine zentrale Frage in der industriellen Produktion. Ziel ist es, die verschiedenen Kriterien für diese Entscheidung zu beleuchten und die Motive für die Fremdvergabe sowie die damit verbundenen Risiken zu analysieren. Des Weiteren wird die Verantwortung des Konstrukteurs und das Vertrauensverhältnis zu Zulieferern im Kontext dieser Entscheidung betrachtet.
- Die Charakterisierung und Bedeutung von Make-or-Buy-Entscheidungen
- Die Analyse von Kosten- und strategischen Kriterien für die Entscheidungsfindung
- Die Rolle des Konstrukteurs bei der Planung und Entscheidungsfindung
- Die Bedeutung von Vertrauen und Zertifizierung im Verhältnis zu Zulieferern
- Die Herausforderungen und Entwicklungstrends im Bereich von Make-or-Buy-Entscheidungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema ein und beleuchtet die wachsende Bedeutung von Make-or-Buy-Entscheidungen in der heutigen globalisierten Wirtschaft. Insbesondere der Druck auf Kostensenkung und Optimierung von Fertigungsprozessen wird hervorgehoben.
- Kapitel 2: Der Begriff der Make-or-Buy-Entscheidung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Make-or-Buy-Entscheidung und erläutert die verschiedenen Entscheidungsobjekte, wie beispielsweise Wirtschaftszweige und Unternehmensbereiche. Weiterhin werden relevante Konzepte wie vertikale Integration und Outsourcing sowie die Herausforderungen und Grenzen der Entscheidungsfindung diskutiert.
- Kapitel 3: Kriterien für die Entscheidungsfindung: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Kriterien, die bei der Entscheidung zwischen Make und Buy berücksichtigt werden sollten. Dabei werden sowohl kostenbasierte als auch strategische Kriterien sowie die Rolle der Transaktionskostentheorie analysiert.
- Kapitel 4: Verantwortung des Konstrukteurs bei der Planung: Dieses Kapitel untersucht die Rolle des Konstrukteurs bei der Planung von Make-or-Buy-Entscheidungen. Es wird auf die Verantwortung des Konstrukteurs im Hinblick auf die Auswahl von Zulieferern und die Sicherstellung von Qualität und Zuverlässigkeit hingewiesen.
- Kapitel 5: Entwicklungstrends: Dieses Kapitel behandelt aktuelle Entwicklungen im Bereich von Make-or-Buy-Entscheidungen. Insbesondere die zunehmende Bedeutung von Outsourcing und die Herausforderungen durch Globalisierung werden angesprochen.
- Kapitel 6: Vertrauensverhältnis zu den Zulieferern - Zertifizierung: Dieses Kapitel beleuchtet die Wichtigkeit von Vertrauen und Zertifizierung im Verhältnis zu Zulieferern. Es wird auf die Bedeutung von Qualitätsmanagement und die Sicherung von Lieferketten hingewiesen.
Schlüsselwörter
Make-or-Buy, Entscheidungskriterien, Kostensicht, strategische Kriterien, Transaktionskostentheorie, Verantwortung des Konstrukteurs, Zulieferer, Zertifizierung, Outsourcing, Globalisierung, Wettbewerb, Produktlebenszyklus, Fertigungsprozess, Wirtschaftlichkeit, Unternehmensziel.
- Quote paper
- Jens Stöckhardt (Author), 2006, Make or Buy-Entscheidungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58004