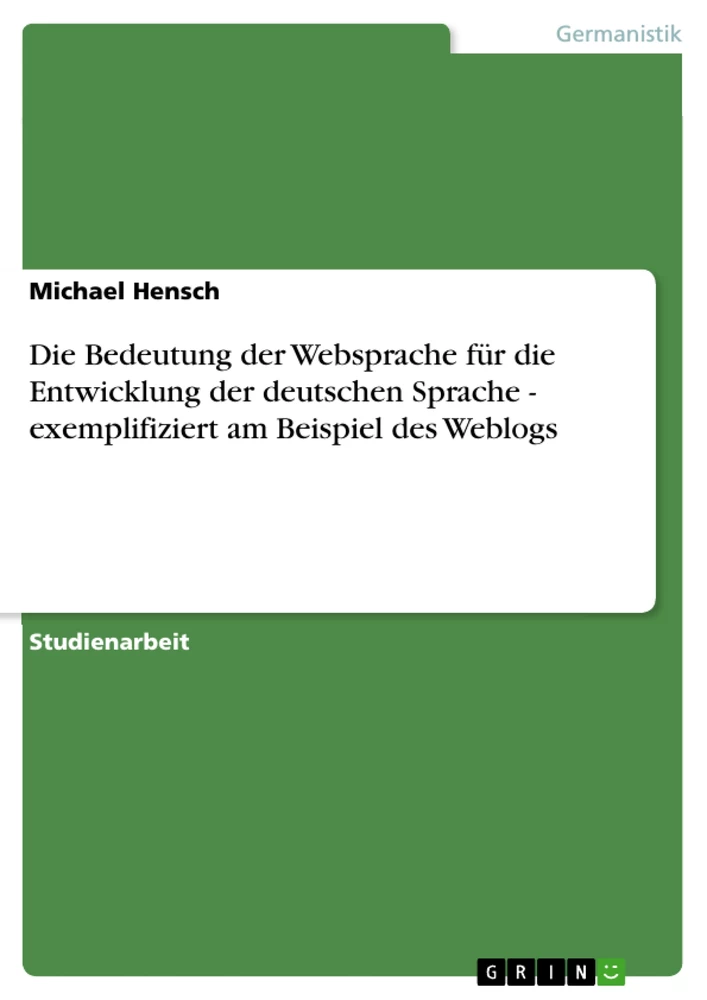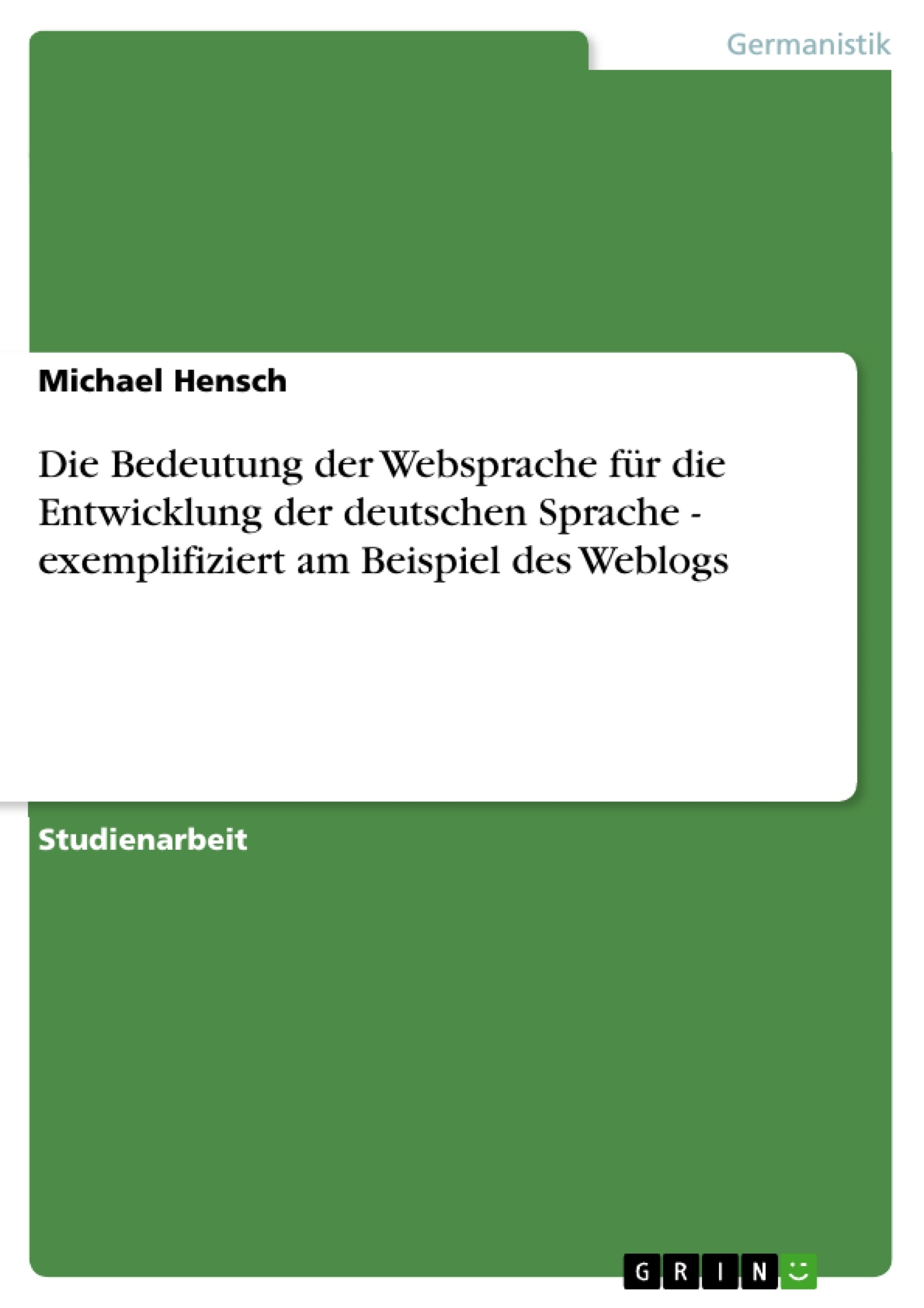Das Internet ist bis dato eines der am schnellsten wachsenden und vor allem eines der dynamischsten Kommunikationsmedien unserer Zeit. Bereits zur Zeit seiner Geburtsstunde als ARPANET 1 vor knapp vierzig Jahren, im Jahre 1969, diente es vorrangig zur Optimierung der Kommunikationsmöglichkeiten: ursprünglich zur Vernetzung von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen. Avanciert wurde die Förderung der zivilen Gesprächskultur jederzeit; sie wurde 1993 erheblich beschleunigt durch die Erfindung des World Wide Webs, des Hypertext-Systems, das sich mithilfe eines geeigneten Programms (Browser) grafisch und somit benutzerfreundlich darstellen ließ. Das vormals nur einem kleinen Expertenkreis zugängliche Medium wurde so auch für Laien zugänglich. Die Popularisierung des Internets wurde unterstützt durch die fortschreitende Entwicklung neuer kostengünstiger Computertechnologien, so dass gegen Ende der 1990er-Jahre weder technische noch finanzielle Aspekte der Nutzung des Internets entgegenwirkten. Im Gegenteil: die Dimension des völlig neuen Mediums führte zur gesellschaftlichen Revolution, zu fundamentalen Veränderungen der sozialen, aber durchaus auch der wirtschaftlichen Verhältnisse. Die Zahl der deutschsprachigen Internetseiten stieg bis 2005 auf über acht Millionen, rund 62 Prozent der Bevölkerung nutzten das neue Medium für seine Bedürfnisse [Schlobinski 2005: S. 1]. Der durch die medial bedingte Erschließung neuer Möglichkeiten hervorgerufene inflationäre Aufschwung des Neuen Marktes Ende der 1990iger-Jahre und sein aus wirtschaftlicher Sicht katastrophaler Zusammenbruch im Jahr 2000 können als unmissverständliche Chiffre dafür angesehen werden, wieweit sich Großteile der Bevölkerung das Internet verfügbar machten, wie emotional und ungezwungen sich der Umgang mit dem neuen Medium gestaltete [Möller 2005: S. 41]. Euphorie und Entdeckertrieb erstreckten sich hierbei nämlich nicht nur auf das wirtschaftliche Ressort, sondern spiegelten sich auch im nichtökonomischen Gebrauch der neuen Möglichkeiten, beispielsweise in der privaten Kommunikation, die sich von Telefongesprächen und Briefen verstärkt auf elektronische Post (eMails) und virtuelle Gespräche mit realem Gesprächspartner (Chats), aber auch auf themenspezifische, problemorientierte Diskussionen, [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Faktoren für den Wandel des Diasystems Sprache
- 2.1 Darstellung der Theorie
- 2.2 Quintessenz der Theorie
- 3. Sprachgemeinschaften und mediale Spezifika des Internets
- 3.1 Charakteristik der Blogautoren
- 3.2 Mediale Spezifika des Internets, der Textsorte „Weblog“
- 4. Stilistische Charakteristika der Sprache des Blogs
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Sprachwandelpotential der Websprache am Beispiel der Textsorte „Weblog“. Sie analysiert, ob und wie die Sprache des Internets zur Evolution der deutschen Sprache beiträgt. Dazu werden die medialen Spezifika des Internets und der Textsorte „Weblog“ sowie die stilistischen Charakteristika der Websprache betrachtet. Die Arbeit verwendet den Ansatz von Peter von Polenz, der Ökonomie, Innovation, Variation und Evolution als Faktoren des Sprachwandels identifiziert.
- Sprachwandelpotential der Websprache
- Einfluss des Internets auf die deutsche Sprache
- Mediale Spezifika des Internets und der Textsorte „Weblog“
- Stilistische Charakteristika der Websprache
- Theorie des Sprachwandels nach Peter von Polenz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die rasante Entwicklung des Internets als Kommunikationsmedium. Sie stellt dar, wie das Internet von einem ursprünglich wissenschaftlichen Netzwerk zu einem Massenmedium avanciert ist und welche Auswirkungen diese Entwicklung auf die Gesellschaft und die Sprache hat.
2. Faktoren für den Wandel des Diasystems „Sprache“
2.1 Darstellung der Theorie
Dieser Abschnitt stellt die Theorie von Peter von Polenz zum Sprachwandel vor. Von Polenz identifiziert Ökonomie, Innovation, Variation und Evolution als Schlüsselfaktoren des Sprachwandels. Der Fokus liegt auf dem Faktor „Ökonomie“, der die Tendenz beschreibt, sprachliche Ressourcen zu sparen.
2.2 Quintessenz der Theorie
Die Quintessenz der Theorie von Polenz ist, dass Sprachwandel durch menschliches Handeln und Verhalten beeinflusst wird. Sprachliche Ökonomie, Innovation, Variation und Evolution sind Prozesse, die das Sprachsystem verändern können. Der Abschnitt diskutiert die Auswirkungen dieser Faktoren auf das Sprachsystem und die kommunikative Praxis.
Schlüsselwörter
Die vorliegenden Arbeit befasst sich mit dem Einfluss des Internets auf die Entwicklung der deutschen Sprache, insbesondere mit der Frage, ob die Sprache des Internets (Websprache) zum Sprachwandel beiträgt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Textsorte „Weblog“ und analysiert die medialen Spezifika und stilistischen Charakteristika dieser Textsorte. Weitere zentrale Begriffe sind Sprachwandel, Sprachsystem, Ökonomie, Innovation, Variation und Evolution. Die Arbeit stützt sich auf die Theorie von Peter von Polenz, die die Faktoren des Sprachwandels beleuchtet.
- Quote paper
- Michael Hensch (Author), 2006, Die Bedeutung der Websprache für die Entwicklung der deutschen Sprache - exemplifiziert am Beispiel des Weblogs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57992