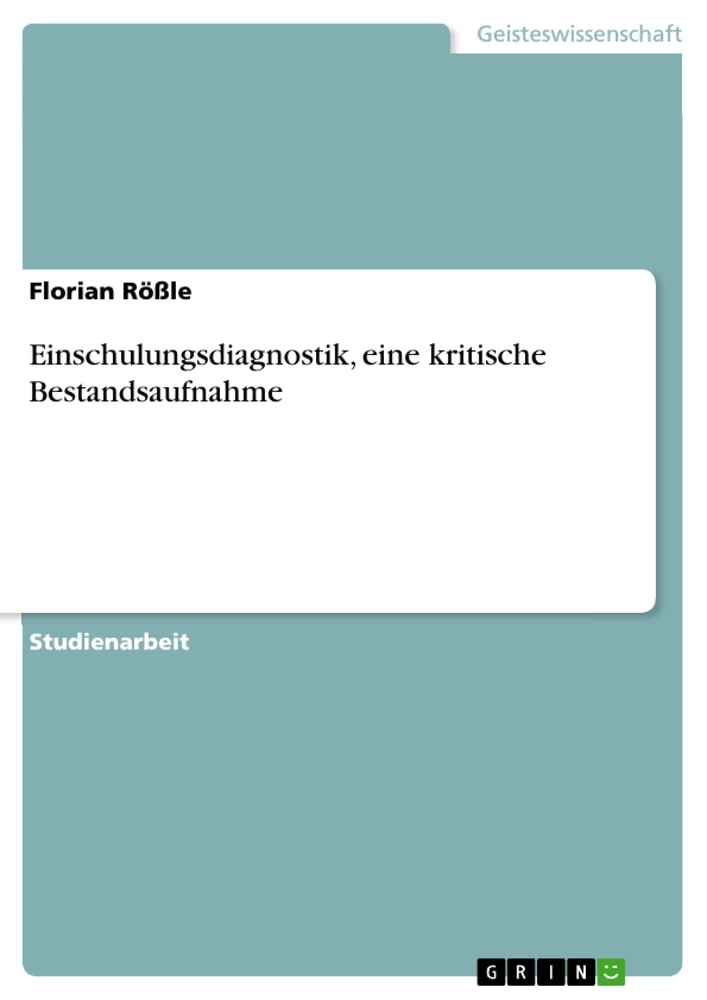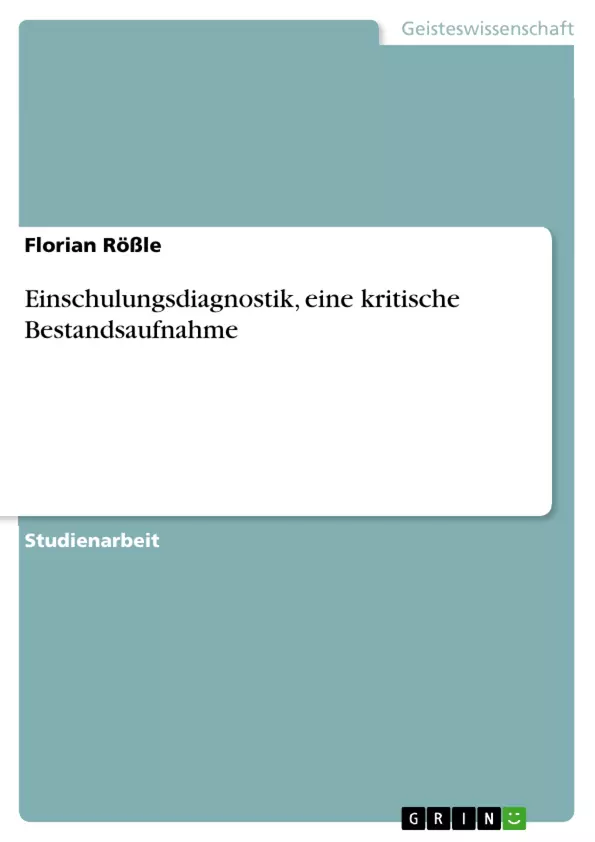„Ist mein Kind bereits so weit um eingeschult zu werden?“ Dies ist eine zentrale Frage die oft an Pädagogen in den Arbeitsfeldern Grundschule oder Kindergarten gestellt wird. Die Antwort auf diese Frage zu finden, insofern es überhaupt eine einzige, richtige geben kann, ist mehr als schwierig und fordert viel Sachverstand, Fingerspitzengefühl und persönliche Erfahrung. Den Pädagogen hier eine Hilfestellung zu geben, um zutreffende Prognosen erstellen zu können, ist die Aufgabe der pädagogischen Diagnostik. Der richtige Start in die Schullaufbahn und die frühzeitige Erkennung eventuell vorhandener Defizite aber auch von vorhandenen Stärken, kann meiner Einschätzung nach gar nicht wichtig genug angesehen werden. Sicher ist auch die Phase des Übertritts an weiterführende Schulen oder in das Berufsleben von großer Bedeutung, doch der Grundstein hierfür wird zu Beginn gelegt. Deshalb möchte ich mich im Folgenden mit der Frage auseinandersetzen welche Hilfsmittel die pädagogische Diagnostik den Menschen an die Hand gibt die zuverlässige Prognosen abgeben sollen und wie sich diese Hilfsmittel im Laufe der Zeit verändert haben. Außerdem möchte ich mich der Frage zuwenden, inwiefern zuverlässige Prognosen überhaupt möglich sind und auch die meiner Meinung nach wichtigere Frage, ob diese Prognosen überhaupt wünschenswert sind soll nicht ausgeblendet werden. Doch noch einmal zurück zur Eingangs gestellten Frage: Schulreife oder Schulfähigkeit? Diese beiden Begrifflichkeiten spiegeln bereits die Entwicklung des theoretischen und gesellschaftlichen Hintergrundes der zugehörigen diagnostischen Methoden wieder. Während das Wort „reife“ einen Zustand meint, der eigentlich nicht aktiv erworben werden kann, sondern den man mehr oder weniger passiv mit der Zeit erhält, meint das Wort „fähig“ im allgemeinen Sprachverständnis eine erlernte, erworbene kognitive Funktion oder Handlungsmöglichkeit. Es spiegelt sich also bereits ein fundamentaler Unterschied in den Begrifflichkeiten wieder, selbst wenn man sie vom alltäglichen Sprachverständnis her beleuchtet. Doch der theoretische Hintergrund soll nicht unbeachtet bleiben, weshalb ich mich nunmehr zwei älteren diagnostischen Aspekten zuwenden möchte, bevor ich mich einem neueren Ansatz widmen werde. Zunächst also zu älteren diagnostischen Ansätzen deren Zweck in der selektiven Aufnahmeentscheidung liegt und damit zum Schulreifekonzept von Kern.
Inhaltsverzeichnis
- Schulreife oder Schulfähigkeit?
- Das Schulreifekonzept von Kern
- Didaktische Differenzierungsentscheidung
- Neuere Annahmen zur Schulfähigkeit
- Das Kieler Einschulungsverfahren
- Schwächen erkennen und Stärken fördern
- Kritische Überlegungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Einschulungsdiagnostik und setzt sich kritisch mit ihrer Entwicklung und den verwendeten Methoden auseinander. Sie beleuchtet die Veränderungen im Verständnis von Schulreife und Schulfähigkeit und analysiert die Stärken und Schwächen verschiedener diagnostischer Ansätze.
- Entwicklung des Schulreifekonzepts und dessen Kritik
- Die Bedeutung der didaktischen Differenzierung
- Aktuelle Einschulungsverfahren und ihre Wirksamkeit
- Die Rolle von Stärken und Schwächen in der Einschulungsdiagnostik
- Die Frage nach der Wünschbarkeit von Prognosen in der Einschulungsdiagnostik
Zusammenfassung der Kapitel
Schulreife oder Schulfähigkeit?
Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung des Schulreifekonzepts und die damit verbundenen diagnostischen Methoden. Es beleuchtet die Unterschiede zwischen den Begriffen Schulreife und Schulfähigkeit und deren Implikationen für die Einschulungsdiagnostik.
Das Schulreifekonzept von Kern
Das Kapitel geht auf Kerns Schulreifekonzept ein, welches auf eine selektive Aufnahmeentscheidung basiert und die Reife des Schülers als entscheidenden Faktor für den Schulerfolg betrachtet. Der GLT (Grundleistungstest zur Ermittlung der Schulreife) als Instrument zur Messung der Schulreife wird vorgestellt und kritisch beleuchtet.
Didaktische Differenzierungsentscheidung
Im Gegensatz zur selektiven Aufnahmeentscheidung strebt die didaktische Differenzierung die Kompensation von unterschiedlichen Lernvoraussetzungen durch individualisiertes Lernen an. Das Kapitel erläutert die verschiedenen Formen der Differenzierung und ihren Einfluss auf die Einschulungsdiagnostik.
Neuere Annahmen zur Schulfähigkeit
Dieses Kapitel stellt neuere Ansätze zur Schulfähigkeit vor, die von den Begrenzungen des Schulreifekonzepts abweichen und die individuelle Entwicklung des Kindes in den Vordergrund stellen. Das Kieler Einschulungsverfahren wird als Beispiel für eine moderne Methode zur Erfassung von Schulfähigkeit vorgestellt.
Schwächen erkennen und Stärken fördern
Das Kapitel beschäftigt sich mit der Wichtigkeit der Erkennung von Schwächen und der Förderung von Stärken im Rahmen der Einschulungsdiagnostik. Es betont den zentralen Aspekt der individuellen Bedürfnisse des Kindes und die Bedeutung einer ganzheitlichen Perspektive auf die Entwicklung und das Lernen.
Schlüsselwörter
Einschulungsdiagnostik, Schulreife, Schulfähigkeit, Selektion, Didaktische Differenzierung, Individualisierung, Lernwegdifferenzierung, Methodendifferenzierung, Kieler Einschulungsverfahren, Stärken und Schwächen, Prognose, Entwicklung, Lernen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Schulreife und Schulfähigkeit?
Schulreife suggeriert einen biologischen Reifeprozess, der passiv abgewartet wird. Schulfähigkeit hingegen meint erlernte kognitive Funktionen und soziale Kompetenzen, die aktiv gefördert werden können.
Was war das Ziel von Kerns Schulreifekonzept?
Kerns Konzept zielte auf eine selektive Aufnahmeentscheidung ab. Nur Kinder, die eine bestimmte "Reife" aufwiesen, sollten eingeschult werden, um den Schulerfolg sicherzustellen.
Was ist das Kieler Einschulungsverfahren?
Es handelt sich um ein moderneres Verfahren, das die individuelle Entwicklung des Kindes in den Vordergrund stellt und darauf abzielt, Stärken zu fördern und Schwächen frühzeitig durch Förderung zu kompensieren.
Was bedeutet didaktische Differenzierung bei der Einschulung?
Anstatt Kinder auszusortieren (Selektion), versucht die didaktische Differenzierung, den Unterricht an die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder anzupassen (Individualisierung).
Sind Prognosen über den Schulerfolg bei der Einschulung zuverlässig?
Die pädagogische Diagnostik zeigt, dass starre Prognosen schwierig sind. Moderne Ansätze fordern daher eher eine ganzheitliche Perspektive und kontinuierliche Begleitung statt einer einmaligen Entscheidung.
- Quote paper
- Florian Rößle (Author), 2006, Einschulungsdiagnostik, eine kritische Bestandsaufnahme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57958