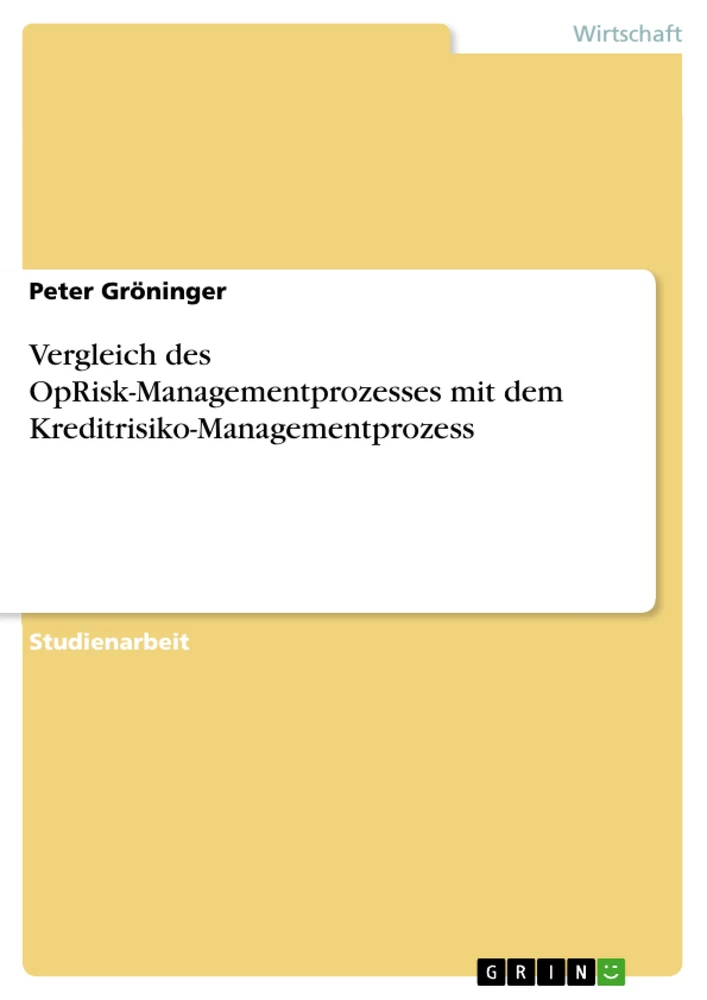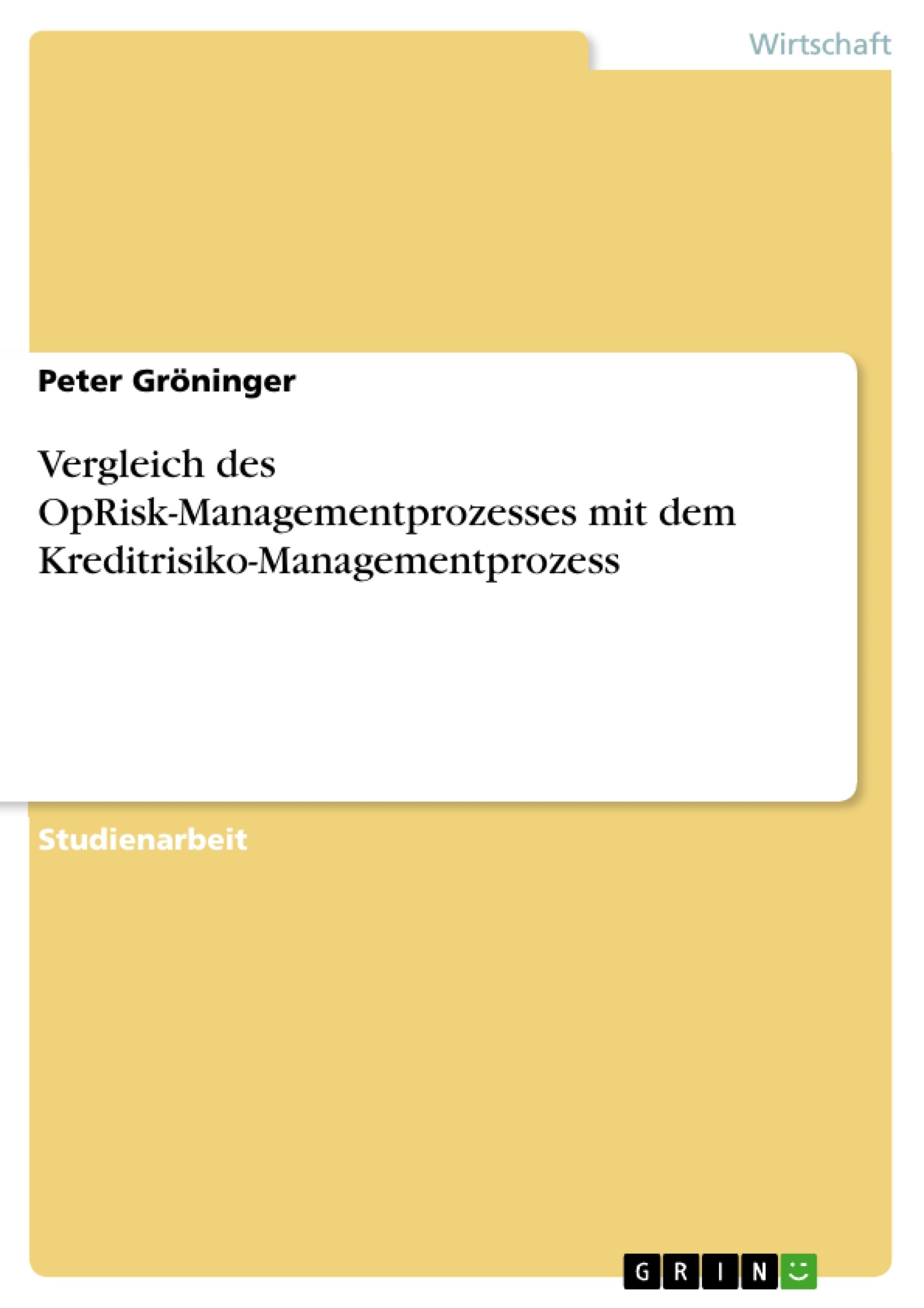Im Rahmen von Basel 2 wurden verbindliche Anforderungen zur Behandlung von Risiken erlassen. Ziel ist es, Bankenkrisen zu verhindern, so dass die übrigen Wirtschaftsabläufe auf nationaler und internationaler Ebene sichergestellt sind. Zur Erfüllung dieser Anforderungen muss ein Kreditinstitut im Rahmen der Mindestkapitalanforderungen (Säule 1) die Risiken mit Eigenkapital unterlegen. Ferner sollen Kreditinstitute durch das aufsichtliche Überprüfungsverfahren (Säule 2) ermutigt werden, die internen Verfahren zur Beurteilung der individuellen Risikoposition sowie einer angemessenen Kapitalausstattung permanent zu verbessern. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung von Methoden des Risikomanagements und interner Kontrollen. Auf nationaler Ebene wird dies durch das Gesetz über das Kreditwesen (KWG) konkretisiert. Gemäß § 25a KWG muss ein Kreditinstitut „über eine Geschäftsorganisation verfügen, die die Einhaltung der von den Instituten zu beachtenden gesetzlichen Bestimmungen gewährleistet.“ Demzufolge müssen „geeignete Regelungen zur Steuerung, Überwachung und Kontrolle der Risiken“ vorhanden sein. Die dritte Säule (Marktdisziplin) fordert die Offenlegung der Anwendung der Eigenkapitalvorschriften, der Ausstattung und Struktur des Eigenkapitals sowie die qualitative und quantitative Darstellung des eingegangenen Risikos. Durch die Offenlegung sollen die Kreditinstitute zusätzlich angereizt werden, ihre Risiken zu kontrollieren und zu steuern. Die Sound Practices bzw. die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) gehen auf die Anforderungen der drei Säulen für das operationelle bzw. das Kreditrisiko ein. Der Fokus dieser Arbeit liegt dabei auf der Herausarbeitung wesentlicher Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Managementprozess, bzw. der Übertragbarkeit von etablierten Steuerungskomponenten des Kreditrisikos auf das operationelle Risiko. Abschießend wird im Zuge einer kritischen Analyse herausgearbeitet, ob die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bzw. die Übertragbarkeit einzelner Managementkomponenten gerechtfertigt sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG UND ZIELSETZUNG
- 2 MANAGEMENT DER KREDITRISIKEN
- 2.1 Definition des Kreditrisikobegriffs und Überblick
- 2.2 Managementprozess der Kreditrisiken
- 2.2.1 Risikoidentifikation und Risikoklassifizierung
- 2.2.2 Risikobewertung und Steuerung
- 3 MANAGEMENT OPERATIONELLER RISIKEN
- 3.1 Definition operationelle Risiken und Überblick
- 3.2 Managementprozess operationeller Risiken
- 3.2.1 Risikoidentifikation
- 3.2.2 Risikobewertung und Steuerung
- 4 ANALYSE DER GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE
- 4.1 Grundsätzliche Unterschiede
- 4.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Rahmenbedingungen
- 4.2.1 Geschäftsleitungsebene
- 4.2.2 Organisationsstruktur
- 4.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Managementprozess
- 4.3.1 Wissensmanagement
- 4.3.2 Risikoidentifikation, Risikoklassifizierung und Datenerfassung
- 4.3.2.1 Risikoidentifikation und Klassifizierung
- 4.3.2.2 Datenerfassung
- 4.3.3 Prüfungs- und Berichtswesen
- 4.3.4 Risikosteuerung
- 4.3.4.1 Steuerung auf Einzelkredit und Event-Typ-Ebene
- 4.3.4.1.1 Risikovorsorge
- 4.3.4.1.2 Risikominderung
- 4.3.4.1.3 Krisenbewältigung
- 4.3.4.2 Steuerung auf Portfolioebene
- 4.3.4.2.1 Diversifikationseffekt
- 4.3.4.2.2 Derivate und Hedging
- 4.3.5 Bewertung
- 4.3.5.1 Bewertung des Kreditrisikos
- 4.3.5.2 Bewertung des operationellen Risikos
- 4.3.5.2.1 Grundlegende Voraussetzungen AMA-Ansätze
- 4.3.5.2.2 Loss Distribuion Approach (LDA)
- Definition und Abgrenzung der Risikobereiche
- Vergleich der Managementprozesse und ihrer Elemente
- Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Risikosteuerung
- Bewertung des OpRisk-Managements im Vergleich zum Kreditrisikomanagement
- Bewertung des OpRisk-Managements im Kontext der Regulierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert und vergleicht den OpRisk-Management-Prozess mit dem Kreditrisikomanagementprozess. Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Prozesse herauszuarbeiten und die Besonderheiten des OpRisk-Managements im Vergleich zum traditionellen Kreditrisikomanagement aufzuzeigen. Die Arbeit fokussiert auf die verschiedenen Aspekte der Risikosteuerung, insbesondere auf die Risikoidentifikation, -bewertung und -steuerung.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in das Thema und definiert die Zielsetzung der Arbeit. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Management des Kreditrisikos. Es beschreibt den Kreditrisikobegriff, die wichtigsten Elemente des Kreditrisikomanagementprozesses, die Risikoidentifikation und -klassifizierung sowie die Risikobewertung und -steuerung. Das dritte Kapitel widmet sich dem Management operationeller Risiken. Es definiert die verschiedenen Typen operationeller Risiken und stellt den Managementprozess operationeller Risiken vor.
Schlüsselwörter
Operationelle Risiken, Kreditrisiken, Risikomanagement, Risikoidentifikation, Risikobewertung, Risikosteuerung, AMA-Ansätze, Loss Distribuion Approach (LDA), Basel II, Regulierung
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Kreditrisiko und operationellem Risiko (OpRisk)?
Kreditrisiko ist die Gefahr eines Zahlungsausfalls eines Kreditnehmers. OpRisk bezeichnet die Gefahr von Verlusten durch menschliches Versagen, Systemfehler oder externe Ereignisse.
Welche Rolle spielt Basel II für das Risikomanagement?
Basel II führte verbindliche Anforderungen zur Unterlegung von Risiken mit Eigenkapital ein, um die Stabilität des internationalen Bankensystems zu sichern.
Was ist der 'Loss Distribution Approach' (LDA)?
Es ist eine fortgeschrittene Methode (AMA-Ansatz) zur Bewertung operationeller Risiken, die auf der statistischen Verteilung von Schadenhäufigkeit und Schadenshöhe basiert.
Können Steuerungskomponenten des Kreditrisikos auf OpRisk übertragen werden?
Die Arbeit untersucht diese Übertragbarkeit kritisch und zeigt, dass grundlegende Prozesse wie Identifikation und Bewertung zwar ähnlich sind, OpRisk aber spezifischere Daten benötigt.
Was sind MaRisk?
Die 'Mindestanforderungen an das Risikomanagement' sind nationale Richtlinien, die die Anforderungen von Basel II für deutsche Kreditinstitute konkretisieren.
- Quote paper
- Peter Gröninger (Author), 2006, Vergleich des OpRisk-Managementprozesses mit dem Kreditrisiko-Managementprozess, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57955