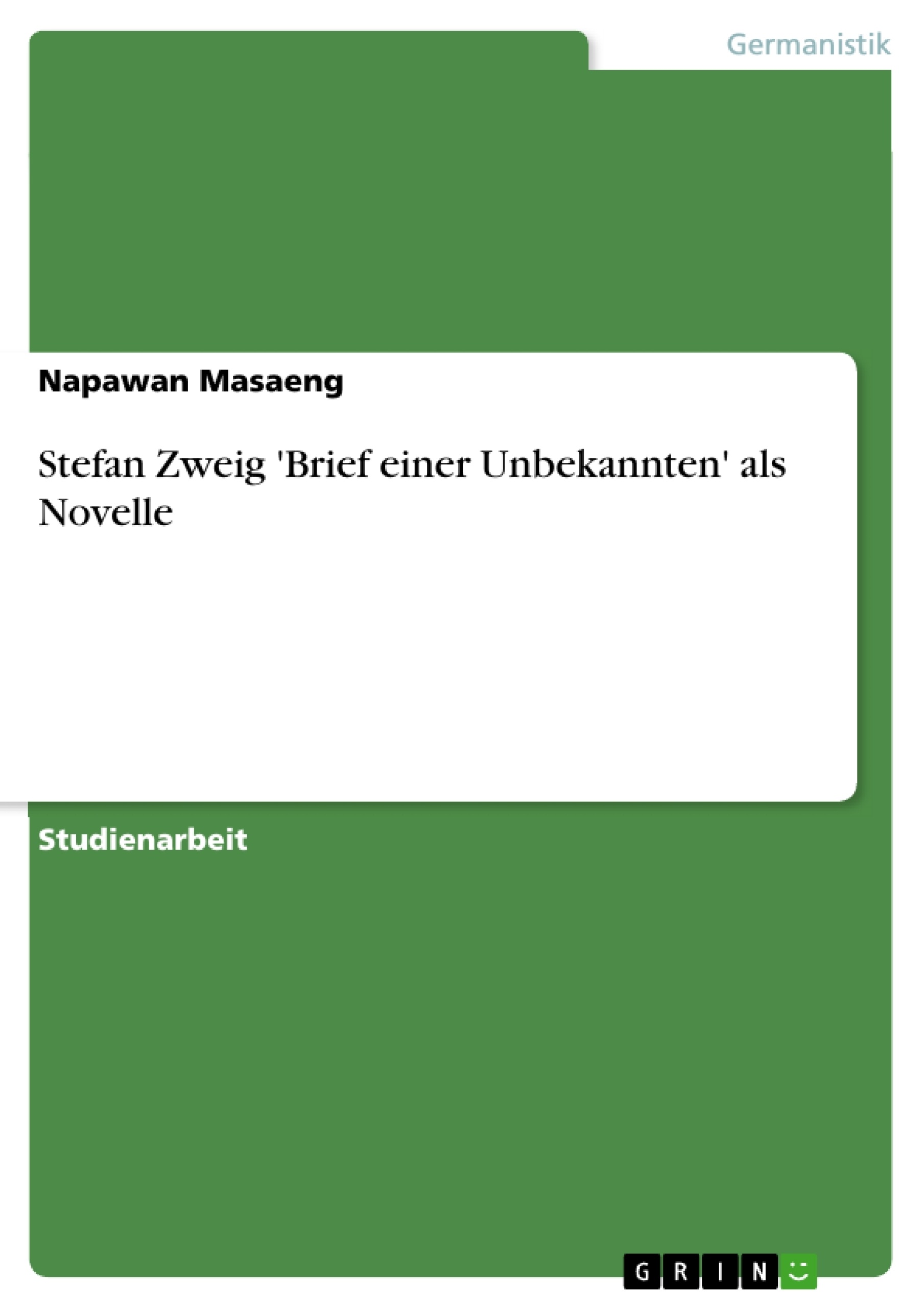Über den Begriff „Novelle“ wird immer wieder diskutiert, um sowohl die Form als auch die Definition der Novelle zu fixieren. Der Begriff stammt aus dem Italienischen und ist erst seit dem 18. Jahrhundert im Deutschen gebräuchlich.
Christoph Martin Wieland übernimmt erstmals die Form und den Begriff der Novelle in die deutsche Literatur. In der Anmerkung seines RomansDie Abenteuer des Don Sylvio von Rosalvavon 1772 versucht er den Begriff zu bestimmen: „Novellen werden vorzüglich eine Art von Erzählungen genannt, welche sich von den großen Romanen durch die Simplizität des Plans und den kleinen Umfang der Fabel unterscheiden, oder sich zu denselben verhalten wie die kleinen Schauspiele zu der großen Tragödie und Komödie“. Später hat er seine Definition gegen die märchenhafte Erzählung der Romantik abgegrenzt: „ Bei einer Novelle (...) werde vorausgesetzt, dass sie sich (...) in unserer wirklichen Welt begeben habe, wo alles natürlich und begreiflich zugeht, und die Begebenheiten zwar nicht alltäglich sind, aber sich doch, unter denselben Umständen, alle Tage allenthalben zutragen könnten“. Das war der erste Versuch einer Abgrenzung und Definition einer Novellentheorie. In der Folge wurden zahlreiche Ansätze unternommen, eine Kunstform Novelle zu entwickeln.
Eine klare Definition der Novelle, die man immerhin als zentrales Merkmal novellistischen Erzählens begreift, ist von Goethe aus einem Gespräch mit Eckermann vom 25. Januar 1827. Er sah im Zentrum der Novelle „ eine sich ereignete unerhörte Begebenheit“. In der Romantik tritt die Novelle anfangs zwar in ihrer Funktion als gehobene gesellschaftliche Unterhaltung zurück, aber auch das Thema der Form und des Inhalts wird erweitert. Für die Form der Novelle verlangt Ludwig Tieck einen „Wendepunkt“: „Diese Wendung der Geschichte, dieser Punkt, von welchem aus sie sich unerwartet völlig umkehrt, und doch natürlich, dem Charakter und den Umständen angemessen, die Folge entwickelt“. Während in der Romantik die Form der Novelle einerseits aufblüht, werden andererseits märchenhafte und symbolhafte Züge in die Novellenform eingebracht. Im 19. Jahrhundert, die Zeit des Biedermeier und Realismus, gewinnt die Novelle zunehmend an Bedeutung. Die Literaturwissenschaft bevorzugt die Novelle mehr für die Darstellung der Lebenswelt und der Probleme des Individuums. [...]
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Haupttitel
- I. Das novellistische Profil von „Brief einer Unbekannten“
- II. Inhaltsangabe
- III. Silhouette der Novelle „Eigentümlichkeit der Charaktere“ und „Unerhörte Begebenheit“
- a) Die Unbekannte
- b) Der Schriftsteller
- c) Der Konflikt
- d) Die unerhörte Begebenheit als Resultat des Konfliktes der eigentümlichen Charaktere
- C. Schluss „Die neue Seite der Menschennatur“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Stefan Zweigs Novelle „Brief einer Unbekannten“ im Kontext verschiedener Novellentheorien. Ziel ist es, die Charakteristika der Novelle anhand der Definitionen von Goethe, Hebbel, Heyse und Spielhagen zu untersuchen und deren Übereinstimmung mit dem Werk zu belegen. Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Merkmalen der Novelle, insbesondere der „unerhörten Begebenheit“ und der „Eigentümlichkeit der Charaktere“, und beleuchtet deren Bedeutung für den Verlauf und die Aussagekraft der Erzählung.
- Definition und Entwicklung der Novelle
- Analyse der „unerhörten Begebenheit“ in „Brief einer Unbekannten“
- Charakterisierung der Hauptfiguren und deren Konflikt
- Die Rolle des Zufalls und der Schicksalhaftigkeit
- Der Einfluss verschiedener Novellentheorien auf die Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Debatte um die Definition und die Form der Novelle, beginnend mit Wielands Versuch einer Abgrenzung vom Roman. Sie skizziert die unterschiedlichen Ansätze verschiedener Autoren wie Goethe, der die „unerhörte Begebenheit“ als zentrales Element sieht, Tieck mit seinem Konzept des „Wendepunktes“, Hebbel, der die „unerhörte Begebenheit“ und das neue Verhältnis des Menschen zur Welt betont, sowie Heyse mit seiner „Silhouette“ und „Falkentheorie“. Die Einleitung führt schließlich zur Zielsetzung der Arbeit, die Charakteristika von Zweigs „Brief einer Unbekannten“ im Lichte dieser Theorien zu untersuchen.
B. Haupttitel: Dieser Kapitelteil analysiert das novellistische Profil von „Brief einer Unbekannten“. Es bietet eine Inhaltsangabe und untersucht die „Silhouette“ der Novelle, die „Eigentümlichkeit der Charaktere“ sowie den „unerhörten Begebenheit“. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Unbekannten, des Schriftstellers, des Konflikts zwischen ihnen und wie die unerhörte Begebenheit aus diesem Konflikt resultiert. Dieser Teil integriert die Definitionen verschiedener Novellentheoretiker um die spezifischen Merkmale des Textes zu erläutern und zu belegen, wie Zweig die Prinzipien der Novelle erfolgreich nutzt. Die Analyse veranschaulicht wie die Charaktere und der Konflikt in der Geschichte zusammenspielen um zum zentralen Ereignis der Erzählung zu führen.
Häufig gestellte Fragen zu Stefan Zweigs „Brief einer Unbekannten“
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert Stefan Zweigs Novelle „Brief einer Unbekannten“. Sie untersucht die Charakteristika der Novelle im Kontext verschiedener Novellentheorien (Goethe, Hebbel, Heyse, Spielhagen), fokussiert auf die „unerhörte Begebenheit“ und die „Eigentümlichkeit der Charaktere“, und beleuchtet deren Bedeutung für den Verlauf und die Aussagekraft der Erzählung. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine detaillierte Analyse der Novelle mit Inhaltsangabe und Charakterisierung der Hauptfiguren, und einen Schluss, der die Ergebnisse zusammenfasst.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Definition und Entwicklung der Novelle, der Analyse der „unerhörten Begebenheit“ in „Brief einer Unbekannten“, der Charakterisierung der Hauptfiguren (die Unbekannte und der Schriftsteller) und deren Konflikt, der Rolle des Zufalls und der Schicksalhaftigkeit, und dem Einfluss verschiedener Novellentheorien auf die Interpretation des Werks. Die verschiedenen Novellentheorien dienen als analytisches Werkzeug zur Bewertung von Zweigs Erzählweise.
Welche Novellentheorien werden herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf die Novellentheorien von bedeutenden Autoren wie Goethe (mit seinem Fokus auf die „unerhörte Begebenheit“), Tieck (mit seinem Konzept des „Wendepunktes“), Hebbel (mit der Betonung der „unerhörten Begebenheit“ und des neuen Verhältnisses des Menschen zur Welt), und Heyse (mit seiner „Silhouette“ und „Falkentheorie“). Diese Theorien bilden die Grundlage für die Analyse von Zweigs Novelle.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Die Einleitung diskutiert die Definition der Novelle und führt in die verwendeten Theorien ein. Der Hauptteil analysiert „Brief einer Unbekannten“ detailliert, inklusive Inhaltsangabe, Charakterisierung der Figuren, und der Untersuchung des Konflikts und der „unerhörten Begebenheit“. Der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen und bietet eine abschließende Betrachtung der Ergebnisse im Lichte der analysierten Novellentheorien.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Hauptziel der Arbeit ist es, die Charakteristika von Stefan Zweigs „Brief einer Unbekannten“ anhand etablierter Novellentheorien zu untersuchen und zu belegen, inwiefern Zweigs Novelle diese Kriterien erfüllt. Es geht darum, die spezifischen Merkmale des Werkes zu identifizieren und zu analysieren, wie Zweig die Prinzipien der Novelle in seinem Werk einsetzt.
Welche Aspekte der Novelle werden besonders untersucht?
Die Analyse konzentriert sich insbesondere auf die „unerhörte Begebenheit“ als zentrales Element der Novelle, die „Eigentümlichkeit der Charaktere“ (der Unbekannten und des Schriftstellers), den Konflikt zwischen ihnen, und die Rolle, die Zufall und Schicksal im Geschehen spielen. Die Interaktion dieser Elemente wird detailliert untersucht.
- Quote paper
- Napawan Masaeng (Author), 2003, Stefan Zweig 'Brief einer Unbekannten' als Novelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57865