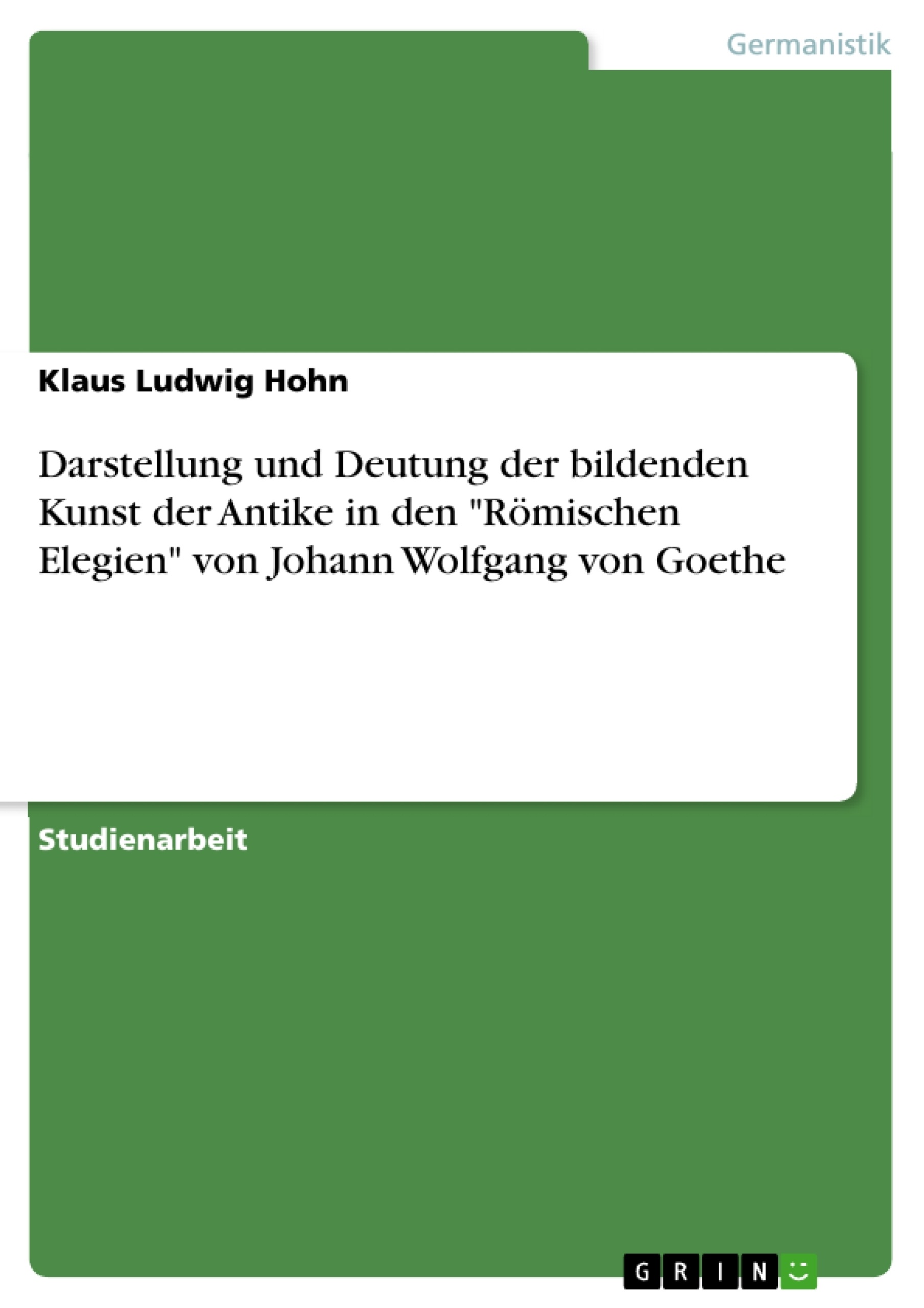Sich einmal mit der Frage auseinanderzusetzen, inwieweit die bildende Kunst der Antike in Goethes Römischen Elegien an verschiedenen Stellen thematisiert wird, ob und welche bedeutungstragende Funktion sie in diesem Gedichtzyklus übernimmt, dürfte sich als interessant und aufschlussreich erweisen, da dieser Aspekt in der germanistischen Forschung bislang nur wenig Beachtung fand.
Horst Rüdiger beispielsweise bemerkt in seinem Aufsatz "Goethes "Römische Elegien" und die antike Tradition", dass bislang viele Untersuchungen sich einerseits den Einflüssen widmen, die von den römischen Dichtern - insbesondere von Ovid, Properz und Tibull - auf Goethes Elegiendichtung ausgegangen sind , andererseits sich um eine "Analyse der zyklischen Anordnung" der Elegien bemühen. Darüber hinaus liefert er, ebenso wie Walther Killy, eine recht umfassende Interpretation der verschiedenen mythologischen Gesichtspunkte in den Elegien. Gegen Ende skizziert Rüdiger noch knapp die Rolle der bildenden Kunst in den Elegien, was aber vorwiegend darstellenden Überblickscharakter hat. Herbert Zeman dagegen setzt in seinem Aufsatz "Goethes Elegiendichtung in der Tradition der Liebeslyrik des 18. Jahrhunderts" den Schwerpunkt auf Aspekte der Veränderungen in Goethes lyrischem Schaffen und betont die Positionen, die den Römischen Elegien dabei zukommen. Die bildende Kunst wird hier an keiner Stelle thematisiert. Walter Wimmel hingegen geht in seiner Publikation "Rom in Goethes Römischen Elegien und im letzten Buch des Properz" unter anderem der Frage nach, wie die Stadt Rom in den Gedichten erscheint und ob, bzw. inwiefern dadurch der Aufbau der einzelnen Elegien sowie des gesamten Zyklus bestimmt wird; eine fundierte Auseinandersetzung, die man bei der hier zu untersuchenden Fragestellung durchaus heranziehen kann. Eine äußerst eingehende Untersuchung von "Goethes "Römischen Elegien"" bietet Dominik Jost, bei dem sich auch eine ausführliche Bibliographie findet. Ein ebenfalls brauchbares Publikationsverzeichnis, das neben vielen deutschen auch englisch-sprachige Titel aufweist, findet man in der Dissertation "Goethe´s "Römische Elegien": The Lover and the Poet" von Eva Dessau Bernhardt. Eine der neuesten Veröffentlichungen ist die Dissertation von Ute Lieber "Dichtung als Lebensform. Goethes Römische Elegien als Paradigma der Weimarer Klassik". [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einführende Vorbemerkungen und Forschungsüberblick
- Entstehungsgeschichte und -zusammenhänge von Goethes "Römischen Elegien" unter Berücksichtigung der Auseinandersetzung mit der bildenden Kunst
- Die Rolle der antiken bildenden Kunst in Goethes "Römischen Elegien"
- Inhaltliche Übersicht über die "Römischen Elegien" unter Berücksichtigung der Darstellung antiker Kunst
- Darstellung und Formen der Begegnung mit der antiken bildenden Kunst in den einzelnen Elegien im Überblick
- Stellenwert und Funktion der bildenden Kunst
- Bedeutung in den einzelnen Elegien (Elegie I, V, XI, XIII, XV)
- Bedeutung für den gesamten Zyklus
- Stellenwert und Funktion der bildenden Kunst
- Literaturverzeichnis
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Stellenwert und die Funktion der antiken bildenden Kunst in Goethes "Römischen Elegien". Bisherige Forschung konzentrierte sich auf andere Aspekte, wie z.B. die Einflüsse römischer Dichter oder die zyklische Anordnung der Elegien. Diese Arbeit will diese Forschungslücke schließen und die Rolle der Kunst im Kontext des gesamten Gedichtzyklus beleuchten.
- Die Darstellung antiker Kunst in den einzelnen Elegien
- Die Funktion der Kunst als Gestaltungsmittel in Goethes "Römischen Elegien"
- Der Einfluss antiker Kunst auf die inhaltliche und formale Gestaltung der Elegien
- Der Vergleich der Behandlung der antiken Kunst in den "Römischen Elegien" mit anderen Werken Goethes
- Die Bedeutung der "Römischen Elegien" im Kontext der Rezeption antiker Kunst im 18. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Einführende Vorbemerkungen und Forschungsüberblick: Die Arbeit untersucht die bislang wenig beachtete Rolle der antiken bildenden Kunst in Goethes "Römischen Elegien". Der Forschungsüberblick zeigt, dass existierende Studien sich vorwiegend mit Einflüssen römischer Dichter, der zyklischen Anordnung oder mythologischen Aspekten befassen. Die vorliegende Arbeit soll diese Lücke schließen und den Stellenwert der Kunst in den Elegien herausarbeiten, den bisherigen Forschungsansätzen eine eigenständige Interpretation entgegensetzend.
Entstehungsgeschichte und -zusammenhänge von Goethes "Römischen Elegien" unter Berücksichtigung der Auseinandersetzung mit der bildenden Kunst: Dieses Kapitel würde die Entstehungsgeschichte der "Römischen Elegien" im Kontext von Goethes Begegnung mit der antiken Kunst in Rom beleuchten. Es würde die Einflüsse, die die antike Kunst auf Goethes Schreibprozess hatte, analysieren, möglicherweise durch den Vergleich von Skizzen, Entwürfen und dem Endprodukt der Elegien. Die Analyse würde zeigen, wie Goethes persönliche Erfahrungen und sein ästhetisches Verständnis antiker Kunst in die Gestaltung der Gedichte eingeflossen sind.
Die Rolle der antiken bildenden Kunst in Goethes "Römischen Elegien": Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es analysiert die verschiedenen Formen der Darstellung und die Bedeutung antiker Kunst innerhalb der Elegien. Die einzelnen Elegien würden daraufhin untersucht, wie und wo die antike Kunst vorkommt. Der Stellenwert der Kunst als zentrales Thema oder als nebensächliches Detail in den verschiedenen Elegien würde differenziert betrachtet. Die Untersuchung würde zeigen, ob und wie die antike Kunst die Thematik, die Stimmung oder die Botschaft der einzelnen Gedichte beeinflusst.
Schlüsselwörter
Römische Elegien, Goethe, Antike, Bildende Kunst, Rezeption, Interpretation, Mythologie, Liebeslyrik, Form, Inhalt, zyklische Anordnung, germanistische Forschung.
Häufig gestellte Fragen zu Goethes "Römischen Elegien" und der antiken bildenden Kunst
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle der antiken bildenden Kunst in Goethes "Römischen Elegien". Im Gegensatz zu bisherigen Forschungsarbeiten, die sich auf andere Aspekte wie z.B. die Einflüsse römischer Dichter oder die zyklische Anordnung konzentrierten, fokussiert diese Arbeit auf den Stellenwert und die Funktion der Kunst im Kontext des gesamten Gedichtzyklus.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Darstellung antiker Kunst in den einzelnen Elegien; die Funktion der Kunst als Gestaltungsmittel; den Einfluss antiker Kunst auf die inhaltliche und formale Gestaltung; einen Vergleich der Behandlung antiker Kunst in den "Römischen Elegien" mit anderen Werken Goethes; und die Bedeutung der "Römischen Elegien" im Kontext der Rezeption antiker Kunst im 18. Jahrhundert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einführende Vorbemerkungen und Forschungsüberblick (mit einem Überblick über den aktuellen Forschungsstand); Entstehungsgeschichte und -zusammenhänge von Goethes "Römischen Elegien" unter Berücksichtigung der Auseinandersetzung mit der bildenden Kunst (Analyse der Entstehung im Kontext von Goethes Begegnung mit antiker Kunst in Rom); Die Rolle der antiken bildenden Kunst in Goethes "Römischen Elegien" (Kern der Arbeit, detaillierte Analyse der Darstellung und Bedeutung antiker Kunst in den einzelnen Elegien); und ein Literaturverzeichnis (aufgeteilt in Primär- und Sekundärliteratur).
Wie wird die Rolle der antiken Kunst in den "Römischen Elegien" untersucht?
Die Arbeit analysiert die verschiedenen Formen der Darstellung und die Bedeutung antiker Kunst in den Elegien. Es wird untersucht, wie und wo antike Kunst in den einzelnen Elegien vorkommt, und welcher Stellenwert ihr als zentrales Thema oder nebensächliches Detail zukommt. Die Analyse beleuchtet den Einfluss der antiken Kunst auf die Thematik, die Stimmung und die Botschaft der Gedichte.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die bislang wenig beachtete Rolle der antiken bildenden Kunst in Goethes "Römischen Elegien" aufzuzeigen und eine eigenständige Interpretation zu liefern, die die bisherigen Forschungsansätze ergänzt und erweitert. Sie schließt eine Forschungslücke und beleuchtet den Stellenwert der Kunst in den Elegien im Detail.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Römische Elegien, Goethe, Antike, Bildende Kunst, Rezeption, Interpretation, Mythologie, Liebeslyrik, Form, Inhalt, zyklische Anordnung, germanistische Forschung.
- Quote paper
- Klaus Ludwig Hohn (Author), 1999, Darstellung und Deutung der bildenden Kunst der Antike in den "Römischen Elegien" von Johann Wolfgang von Goethe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5785