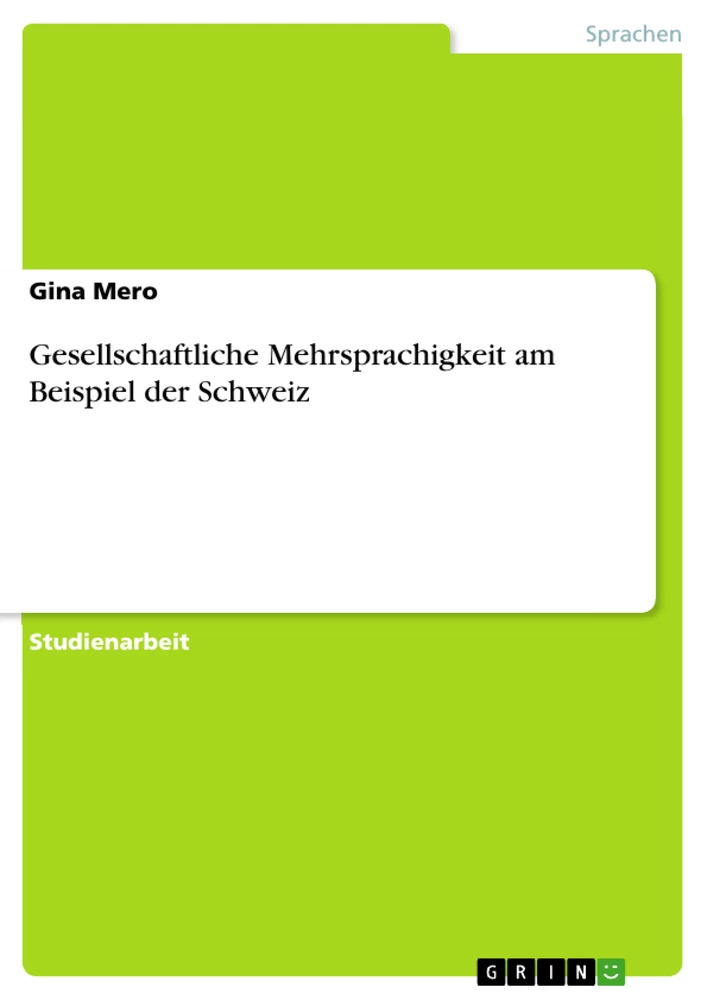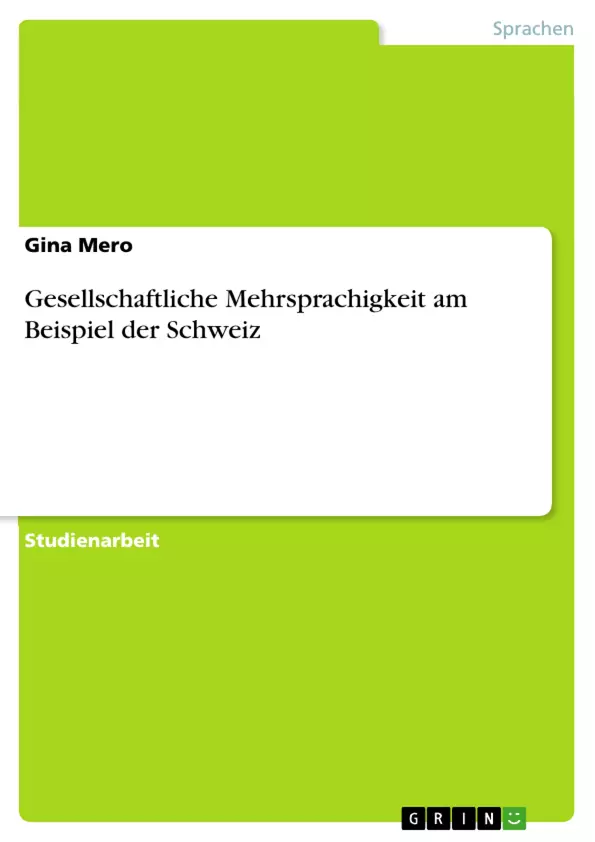Die vorliegende Seminararbeit ist im Rahmen des Hauptseminars „Mehrsprachigkeitsforschung“ entstanden und untersucht die gesellschaftliche Mehrsprachigkeit in der vielsprachigen Schweiz. Zu Beginn dieser Arbeit werden die geschichtlichen Hintergründe und die sprachlichen Entwicklungen des Landes kurz untersucht. Dabei bildet die schweizerische Sprachgeschichte ab dem 13. Jahrhundert den Schwerpunkt. Auf eine umfassendere Untersuchung wird verzichtet, da diese nicht wesentlich zum Verständnis des Themas beiträgt. In einem zweiten Schritt behandelt diese Seminararbeit die Darstellung der aktuellen Sprachlandschaft der Schweiz. Die aus diesem Schritt gewonnenen Ergebnisse liefern die Grundlage für die Erklärung des auf schweizerischen Kontext bezogenen Begriffes der Mehrsprachigkeit. Dabei wird untersucht, inwieweit die Schweiz hinsichtlich der vier offiziellen Landessprachen als tatsächlich mehrsprachig bezeichnet werden kann. Der Einfluss neuer Sprachen in der Schweiz wird dabei ebenfalls berücksichtigt.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die historische und zeitgenössische schweizerische Sprachenpolitik. Zunächst werden das Prinzip der „Sprachenfreiheit“ und das „Territorialitätsprinzip“ erläutert. Anschließend werden einige Beispiele der Förderung von Mehrsprachigkeit auf nationaler und europäischer Ebene aufgezeigt. Zuletzt wird der Versuch unternommen, das Problem der Nationalsprachenbildung und der Identitätsfrage zu erörtern, der sich aus pragmatischen Gründen auf das Schweizerdeutsch beschränkt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprachgeschichtlicher Hintergrund
- Aktuelle Sprachlandschaft
- Sprachenpolitik
- Sprachenfreiheit
- Territorialitätsprinzip
- Förderung der Mehrsprachigkeit
- Nationalsprache und Identität am Beispiel des Schweizerdeutschen
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die gesellschaftliche Mehrsprachigkeit in der Schweiz. Sie beleuchtet die sprachgeschichtlichen Entwicklungen, die aktuelle Sprachlandschaft, die Sprachenpolitik und die Frage nach Nationalsprache und Identität, wobei der Fokus auf dem Schweizerdeutschen liegt. Die Arbeit analysiert, inwieweit die Schweiz angesichts ihrer vier offiziellen Landessprachen als mehrsprachig bezeichnet werden kann.
- Sprachgeschichtliche Entwicklung der Schweiz
- Analyse der aktuellen Sprachlandschaft und des Begriffs der Mehrsprachigkeit im Schweizer Kontext
- Schweizer Sprachenpolitik: Sprachenfreiheit, Territorialitätsprinzip und Förderung der Mehrsprachigkeit
- Nationalsprache und Identität am Beispiel des Schweizerdeutschen
- Der Einfluss neuer Sprachen auf die Schweizer Sprachlandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der gesellschaftlichen Mehrsprachigkeit in der Schweiz ein und umreißt den Aufbau der Arbeit. Sie skizziert die Untersuchung der sprachgeschichtlichen Hintergründe und der aktuellen Sprachlandschaft als Grundlage für die Analyse des Begriffs der Mehrsprachigkeit im Schweizer Kontext. Die Arbeit fokussiert auf die Schweizer Sprachenpolitik, insbesondere auf die Prinzipien der Sprachenfreiheit und des Territorialitätsprinzips, sowie auf die Förderung der Mehrsprachigkeit. Schließlich wird die Problematik der Nationalsprachenbildung und der Identitätsfrage am Beispiel des Schweizerdeutschen behandelt. Die Einleitung legt den Grundstein für die tiefergehende Auseinandersetzung mit den folgenden Kapiteln.
Sprachgeschichtlicher Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet die sprachliche Entwicklung der Schweiz ab dem Jahr 1291, dem Entstehen der Alten Eidgenossenschaft. Es beschreibt die anfängliche Einsprachigkeit (Deutsch) und die sukzessive Angliederung französisch-, italienisch- und rätoromanischsprachiger Gebiete, wobei die unterworfenen Sprachen nicht gleichberechtigt waren. Der Kapitelverlauf beschreibt die Entstehung der sprachlichen Gleichberechtigung erst mit der Helvetischen Republik (1789-1815) und die Festlegung der Nationalsprachen in der Bundesverfassung von 1848. Das Kapitel unterstreicht die lange und komplexe Geschichte der Sprachentwicklung und -gleichberechtigung in der Schweiz.
Aktuelle Sprachlandschaft: Dieses Kapitel erklärt den Begriff der Mehrsprachigkeit im schweizerischen Kontext als territoriale, nicht individuelle Mehrsprachigkeit. Es beschreibt die Aufteilung der Schweiz in vier Haupsprachgebiete (Deutschschweiz, Romandie, Tessin, rätoromanisches Gebiet), die im Wesentlichen einsprachig sind. Es werden aktuelle statistische Daten zur prozentualen Verteilung der vier Landessprachen präsentiert und der geringe Anteil tatsächlich mehrsprachiger Schweizer hervorgehoben. Deutsch als dominierende Sprache wird detailliert beschrieben, während der Anteil von Französisch, Italienisch und Rätoromanisch ebenfalls analysiert wird. Das Kapitel unterstreicht den Kontrast zwischen der offiziellen Mehrsprachigkeit der Schweiz und der Realität der vorwiegend einsprachigen Bevölkerung.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Schweiz, Sprachgeschichte, Sprachenpolitik, Sprachenfreiheit, Territorialitätsprinzip, Nationalsprache, Schweizerdeutsch, Identität, Sprachlandschaft, Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Gesellschaftliche Mehrsprachigkeit in der Schweiz
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die gesellschaftliche Mehrsprachigkeit in der Schweiz. Sie beleuchtet die sprachgeschichtlichen Entwicklungen, die aktuelle Sprachlandschaft, die Sprachenpolitik und die Frage nach Nationalsprache und Identität, wobei der Fokus auf dem Schweizerdeutschen liegt. Die Arbeit analysiert, inwieweit die Schweiz angesichts ihrer vier offiziellen Landessprachen als mehrsprachig bezeichnet werden kann.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Sprachgeschichtliche Entwicklung der Schweiz, Analyse der aktuellen Sprachlandschaft und des Begriffs der Mehrsprachigkeit im Schweizer Kontext, Schweizer Sprachenpolitik (Sprachenfreiheit, Territorialitätsprinzip und Förderung der Mehrsprachigkeit), Nationalsprache und Identität am Beispiel des Schweizerdeutschen und den Einfluss neuer Sprachen auf die Schweizer Sprachlandschaft.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Sprachgeschichtlicher Hintergrund, Aktuelle Sprachlandschaft, Sprachenpolitik (mit Unterkapiteln zu Sprachenfreiheit, Territorialitätsprinzip und Förderung der Mehrsprachigkeit), Nationalsprache und Identität am Beispiel des Schweizerdeutschen und Schlusswort.
Was wird im Kapitel "Sprachgeschichtlicher Hintergrund" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die sprachliche Entwicklung der Schweiz ab 1291. Es beschreibt die anfängliche Einsprachigkeit (Deutsch) und die sukzessive Angliederung französisch-, italienisch- und rätoromanischsprachiger Gebiete, die anfängliche Ungleichberechtigung der unterworfenen Sprachen, die Entstehung der sprachlichen Gleichberechtigung mit der Helvetischen Republik (1789-1815) und die Festlegung der Nationalsprachen in der Bundesverfassung von 1848.
Was wird im Kapitel "Aktuelle Sprachlandschaft" behandelt?
Dieses Kapitel erklärt den Begriff der Mehrsprachigkeit im schweizerischen Kontext als territoriale, nicht individuelle Mehrsprachigkeit. Es beschreibt die Aufteilung der Schweiz in vier Haupsprachgebiete und präsentiert aktuelle statistische Daten zur prozentualen Verteilung der vier Landessprachen. Es wird der geringe Anteil tatsächlich mehrsprachiger Schweizer hervorgehoben und der Kontrast zwischen der offiziellen Mehrsprachigkeit und der Realität der vorwiegend einsprachigen Bevölkerung unterstrichen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Seminararbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Mehrsprachigkeit, Schweiz, Sprachgeschichte, Sprachenpolitik, Sprachenfreiheit, Territorialitätsprinzip, Nationalsprache, Schweizerdeutsch, Identität, Sprachlandschaft, Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch.
Wie ist die Zielsetzung der Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, die gesellschaftliche Mehrsprachigkeit in der Schweiz zu untersuchen und den Begriff der Mehrsprachigkeit im Schweizer Kontext zu analysieren. Ein besonderer Fokus liegt auf der sprachgeschichtlichen Entwicklung, der aktuellen Sprachlandschaft, der Sprachenpolitik und der Frage nach Nationalsprache und Identität, insbesondere am Beispiel des Schweizerdeutschen.
Wie wird der Begriff der Mehrsprachigkeit in der Schweiz definiert?
In der Seminararbeit wird die Mehrsprachigkeit in der Schweiz als territoriale und nicht individuelle Mehrsprachigkeit definiert. Dies bedeutet, dass die Mehrsprachigkeit auf der Ebene der Regionen und nicht unbedingt auf der Ebene des einzelnen Individuums betrachtet wird.
- Arbeit zitieren
- Gina Mero (Autor:in), 2005, Gesellschaftliche Mehrsprachigkeit am Beispiel der Schweiz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57804