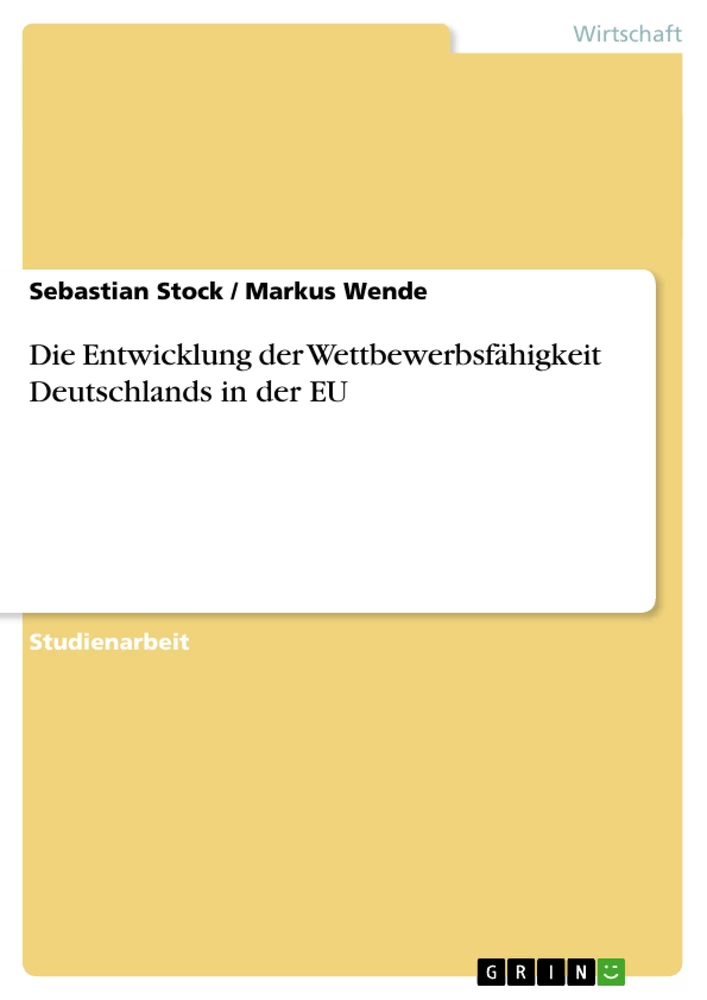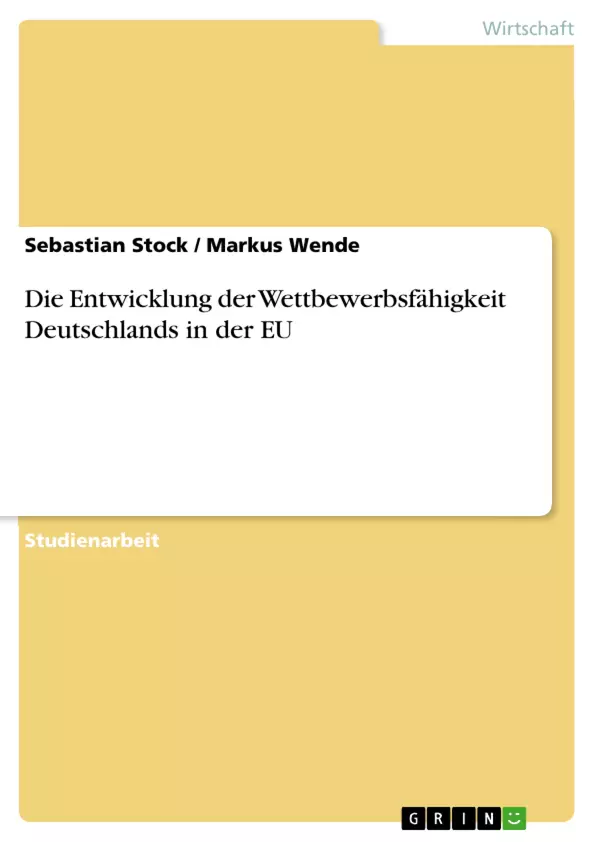Das Kernstück der EU, der Europäischen Union, ist der europäische Binnenmarkt, der nach achtjähriger Vorbereitung im Januar 1993 realisiert wurde. Seitdem wurden und werden bis heute Richtlinien und Verordnungen in Kraft gesetzt um den Binnenmarkt sukzessive auszubauen. Neben den 15 Mitgliedsländern nehmen auch Norwegen, Island und Liechtenstein an diesem Zusammenschluss von nationalen Einzelmärkten teil.1 Die Erwartungen an den europäischen Binnenmarkt waren schon zu Beginn hoch, er sollte Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Lebensstandard in allen beteiligten Ländern nachhaltig steigern.2
Die vorliegende Arbeit soll zeigen, wie sich Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern im Welthandel behauptet. Hierbei ist speziell für Deutschland der europäische Binnenmarkt von großer Bedeutung, da 71% der deutschen Exporte und 78% der Direktinvestitionen in der EU verbleiben.3
Dabei werden Vor- und Nachteile gegenüber anderen Mitgliedsstaaten der EU diskutiert. Gleichzeitig wird kritisch hinterfragt, was das Ziel einer Volkswirtschaft sein kann und wem gegenüber ein Staat zu welcher „Leistung“ verpflichtet ist. Dabei erhebt diese Abhandlung keinen Anspruch auf Vollständigkeit, was auch unmöglich wäre, da dieses Thema bis heute kontrovers diskutiert wird. Vielmehr soll aus der Fülle von Argumenten und Konzeptvorschlägen ein Überblick gegeben werden, um anschließend einen Eindruck zu vermitteln, ob und wie sich die Position Deutschlands in der EU verändert hat. Dies kann nicht durch absolute Ergebnisse erfolgen, sondern muss vielmehr anhand von Größenordnungen und Proportionen in Form einer Rangordnung dargestellt werden.4 Zu diesem Zweck wird im folgenden Teil zunächst auf den Begriff „internationale Wettbewerbsfähigkeit“ von Nationen eingegangen, wobei in diesem Zusammenhang die drei ökonomischen Aggregationsebenen (Mikro-, Meso- und Makroebene) beleuchtet werden. Im Anschluss erfolgt eine Untersuchung von Faktoren, die die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes determinieren. Anschließend werden einige Indikatoren dargestellt, bevor auf die Problematik eingegangen wird, ob die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Nationen messbar ist und welches Maß dafür in Frage kommt. Damit sind die theoretischen Grundlagen für eine Analyse Deutschlands in diesem Kontext abgeschlossen. In Teil drei erfolgt zunächst ein Vergleich Deutschlands mit anderen Volkswirtschaften der EU.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wettbewerbsfähigkeit
- 2.1. Aggregationsebenen
- 2.1.1. Mikroebene
- 2.1.2. Mesoebene
- 2.1.3. Makroebene
- 2.1.4. Zwischenfazit
- 2.2. Determinanten
- 2.2.1. Preislich
- 2.2.2. Nicht-preislich
- 2.3. Indikatoren
- 2.3.1. Determinantenorientiert
- 2.3.2. Ergebnisorientiert
- 2.4. Messmethoden
- 2.4.1. Alternative
- 2.4.2. RCA-Analyse (Revealed-Comparative-Advantage-Analyse)
- 2.4.3. Zwischenfazit
- 2.1. Aggregationsebenen
- 3. Analyse
- 3.1. Ländervergleich
- 3.2. Vergleich deutscher Industriebranchen
- 3.3. Branchen im EU-Vergleich
- 3.3.1. Analyse der Warengruppe 851 „Schuhe“
- 3.3.2. Analyse der Warengruppe 664 „Glas“
- 3.3.3. Analyse der Warengruppe 793 „Schiffe“
- 3.3.4. Analyse der Warengruppe 761 „Fernsehgeräte“
- 3.3.5. Analyse der Warengruppe 872 „Medizinische Instrumente“
- 3.3.6. Analyse der Warengruppe 724 „Textilmaschinen“
- 3.3.7. Analyse der Warengruppe 752 „EDV-Anlagen“
- 3.3.8. Analyse der Warengruppe 541 „Pharmazeutische Erzeugnisse“
- 3.3.9. Analyse der Warengruppe 871 „Optische Instrumente“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands innerhalb der Europäischen Union. Sie analysiert die verschiedenen Dimensionen und Determinanten der Wettbewerbsfähigkeit auf Mikro-, Meso- und Makroebene, sowie die relevanten Indikatoren und Messmethoden. Im Fokus stehen die Entwicklung der RCA-Werte im EU-Vergleich für ausgewählte Warengruppen, um die Wettbewerbsposition Deutschlands in verschiedenen Branchen zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Wettbewerbsfähigkeit“
- Analyse der verschiedenen Ebenen und Determinanten der Wettbewerbsfähigkeit
- Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im internationalen Vergleich
- Untersuchung der Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit in ausgewählten Branchen
- Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Stärkung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema Wettbewerbsfähigkeit und erläutert den Fokus der Arbeit auf die Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands innerhalb der EU. Kapitel zwei beleuchtet die verschiedenen Ebenen und Determinanten der Wettbewerbsfähigkeit, darunter Mikro-, Meso- und Makroebene. Zudem werden verschiedene Indikatoren und Messmethoden zur Beurteilung der Wettbewerbsfähigkeit vorgestellt, wie beispielsweise die RCA-Analyse.
Im dritten Kapitel erfolgt die Analyse der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im EU-Vergleich. Es werden verschiedene Ländervergleiche und Branchenanalysen durchgeführt, die den Fokus auf die Entwicklung der RCA-Werte für ausgewählte Warengruppen legen. Diese Analysen beleuchten die Wettbewerbsposition Deutschlands in verschiedenen Branchen und erlauben Rückschlüsse auf die Stärken und Schwächen des deutschen Wirtschaftsstandorts.
Schlüsselwörter
Wettbewerbsfähigkeit, EU, Deutschland, RCA-Analyse, Warengruppen, Branchenvergleich, Indikatoren, Determinanten, Messmethoden, Ländervergleich.
Häufig gestellte Fragen
Was misst die RCA-Analyse (Revealed Comparative Advantage)?
Die RCA-Analyse misst die Spezialisierung eines Landes im Außenhandel und zeigt auf, in welchen Warengruppen ein Land einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen hat.
Auf welchen Ebenen wird Wettbewerbsfähigkeit untersucht?
Man unterscheidet die Mikroebene (Unternehmen), die Mesoebene (Branchen) und die Makroebene (die gesamte Volkswirtschaft eines Staates).
Warum ist der EU-Binnenmarkt für Deutschland so wichtig?
Über 70 % der deutschen Exporte verbleiben in der EU, was den Binnenmarkt zum wichtigsten Absatzmarkt für die deutsche Industrie macht.
Welche Branchen in Deutschland sind international besonders wettbewerbsfähig?
Traditionell gehören der Maschinenbau, die Pharmaindustrie, die Optik und die Medizintechnik zu den Branchen mit hohen Wettbewerbsvorteilen.
Was sind nicht-preisliche Determinanten der Wettbewerbsfähigkeit?
Dazu zählen Faktoren wie Produktqualität, Innovationskraft, Markenimage, Lieferzuverlässigkeit und der Kundenservice.
- Quote paper
- Diplom Kaufmann Sebastian Stock (Author), Markus Wende (Author), 2001, Die Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in der EU, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5776