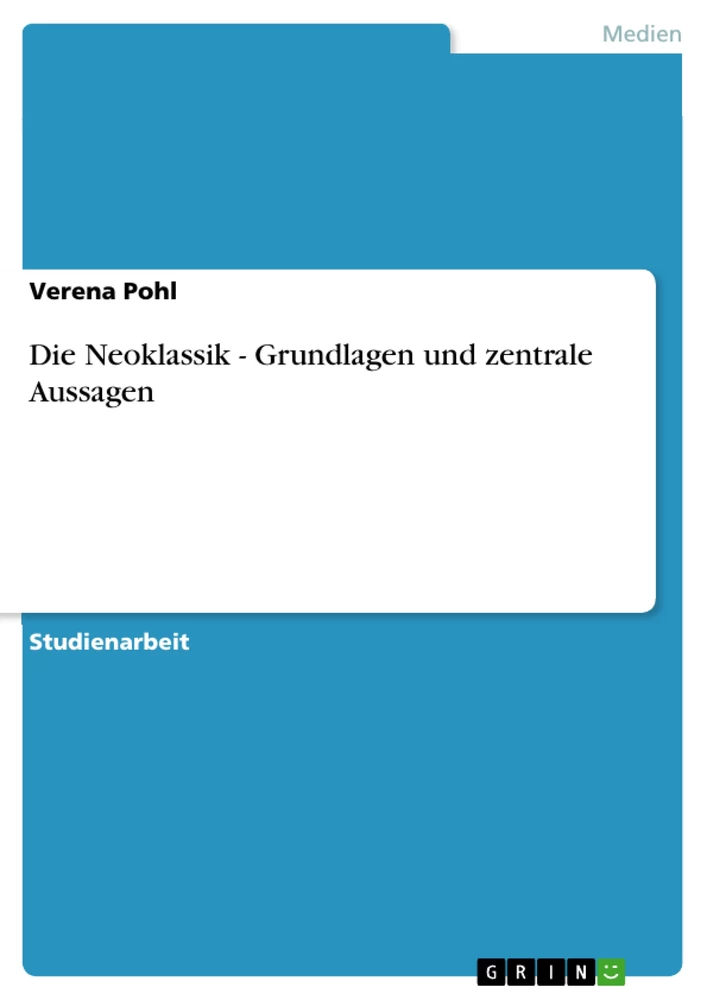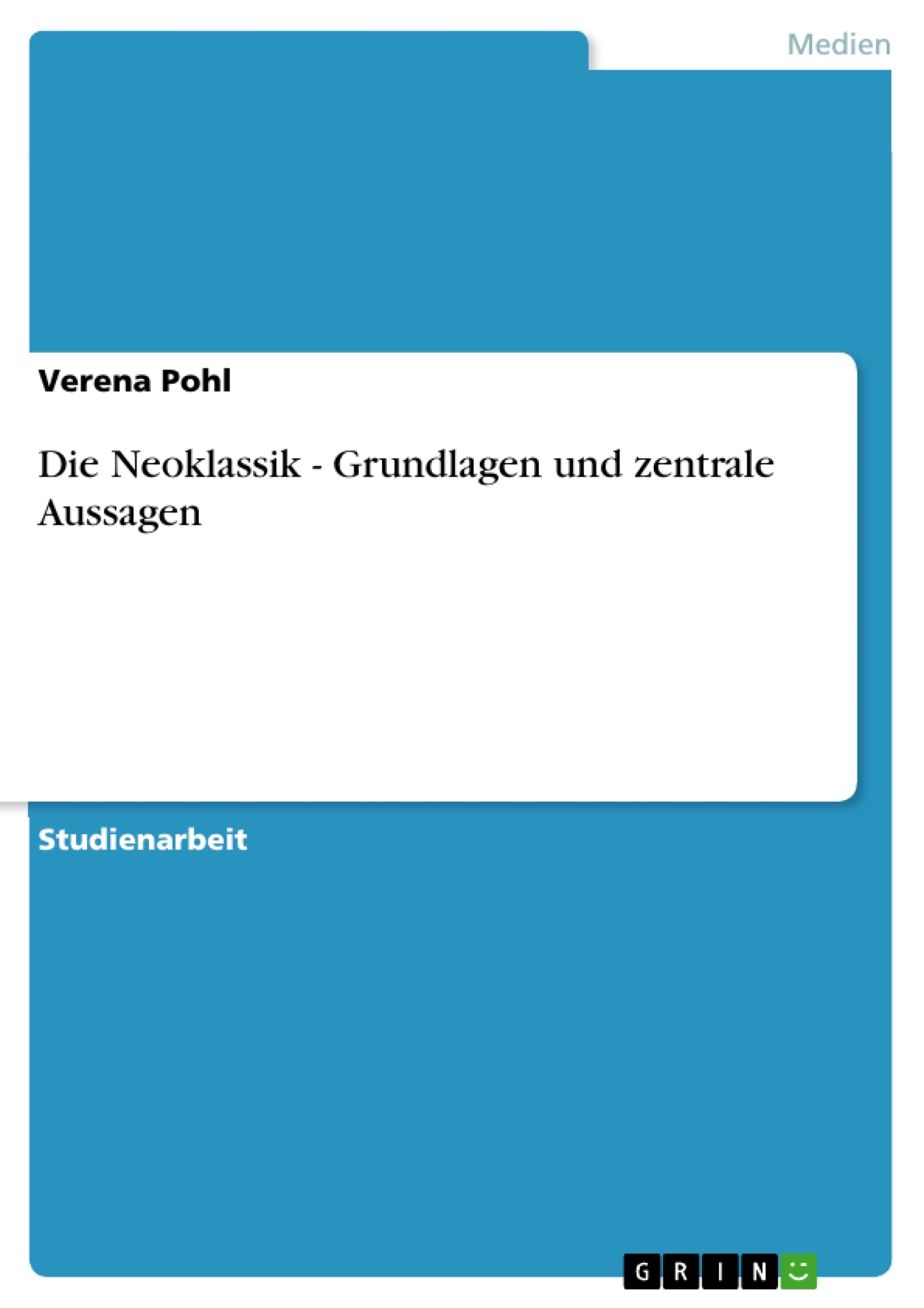Betrachtet man den Mediensektor, so finden sich auf den ersten Blick keine grundlegenden Unterschiede im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen. Es werden Güter hergestellt und gehandelt und die produzierenden Unternehmen streben nach Gewinnmaximierung. Dennoch haben Medienprodukte gewisse Eigenschaften, die sie von anderen Wirtschaftsgütern unterscheiden. So erfüllen Medien neben der ökonomischen Aufgabe der Gewinnerzielung auch gesellschaftliche Aufgaben, wie etwa die öffentliche Meinungsbildung. Außerdem ist die Qualität eines Medienprodukts im Voraus nicht festzustellen. Medien sind als Güter zu verstehen, deren Kauf stark vom Vertrauen der Konsumenten abhängt. In der Ökonomie werden zahlreiche verschiedene Ansätze diskutiert, die versuchen, das Verhalten von Wirtschaftssubjekten zu erklären. Dabei ist die Neoklassik eine der dominierenden Theorien. In dieser Arbeit soll untersucht werden, wie aussagekräftig die neoklassische Theorie für das Mediensystem ist. Beispielsweise ist zu diskutieren, ob die neoklassische Annahme des „homo oeconomicus“, des rational handelnden Individuums, auf den Medienkonsum übertragbar ist. Die neoklassische Schule ist, wie der Name schon erahnen lässt, eine Weiterentwicklung des klassischen Ansatzes. Betrachtet man die Hauptdiskussionen in der Volkswirtschaftslehre, so wird deutlich, dass meist die Frage im Mittelpunkt steht, ob sich die Volkswirtschaft im wesentlichen spontan in Richtung eines langfristigen Vollbeschäftigungsgleichgewichts entwickelt oder ob dazu staatliche Eingriffe nötig sind. Ansätze, die von starken selbstregulierenden Kräften einer Volkswirtschaft ausgehen, werden als klassisch bezeichnet. In dieser Arbeit sollen zunächst Grundlagen klassischen Theorie vorgestellt werden. Im Anschluss sollen die zentralen Aussagen der neoklassischen Theorie aufgezeigt werden. Ob sich die Annahmen der Neoklassik auch auf das Mediensystem anwenden lassen, soll schließlich in Kapitel 5 überprüft werden. Abschließend soll eine Kritik des neoklassischen Ansatzes erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der klassische Ansatz
- Annahmen der Neoklassik
- Allokation von Ressourcen
- Marktversagen im Mediensektor
- Öffentliche Güter
- Externe Effekte
- Strukturprobleme des Wettbewerbs
- Informationsmängel auf Seiten der Konsumenten
- Nichtrationalität der Konsumenten
- Kritik an der Neoklassik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit der neoklassischen Theorie auf das Mediensystem. Die Hauptfrage ist, wie aussagekräftig die neoklassische Theorie zur Erklärung des Mediensystems ist, insbesondere im Hinblick auf die Annahme des "homo oeconomicus".
- Die Grundlagen der klassischen und neoklassischen ökonomischen Ansätze
- Die Annahmen der Neoklassik und deren Übertragbarkeit auf den Mediensektor
- Marktversagen im Mediensektor und dessen Erklärung durch die neoklassische Theorie
- Die Kritik an der neoklassischen Theorie im Kontext des Mediensystems
- Die Rolle des "homo oeconomicus" im Medienkonsum
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Anwendbarkeit der neoklassischen Theorie auf den Mediensektor. Sie hebt die Besonderheiten von Medienprodukten hervor, die sie von anderen Wirtschaftsgütern unterscheiden, wie die gesellschaftliche Funktion neben der Gewinnerzielung und die Unsicherheit der Qualität im Voraus. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Vorgehensweise, wobei die klassische Theorie als Grundlage für das Verständnis der Neoklassik dient.
Der klassische Ansatz: Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen der klassischen ökonomischen Schule des späten 18. Jahrhunderts, mit Vertretern wie Adam Smith und John Stuart Mill. Es betont die selbstregulierenden Kräfte der Wirtschaft, die flexible Preise und Löhne, und das Saysche Theorem, welches besagt, dass jedes Angebot seine eigene Nachfrage schafft. Aus der klassischen Theorie folgt, dass Wirtschaftskrisen kurzlebig sind und staatliche Eingriffe in die Gesamtnachfrage keinen Einfluss auf Beschäftigung und reales Bruttoinlandsprodukt haben. Die Analyse wird durch das Beispiel der Verschiebung des Preisniveaus veranschaulicht.
Annahmen der Neoklassik: Das Kapitel erläutert die Anfänge der Neoklassik um 1870 und ihre zentralen Postulate: flexible Preise und Löhne sowie die Nutzung aller verfügbarer Informationen durch Individuen bei der Erwartungsbildung. Es stellt die Weiterentwicklung der neoklassischen Theorie im Vergleich zur klassischen Schule dar und betont die Bedeutung der Informationsnutzung für die Entscheidungsfindung wirtschaftlicher Akteure. Die Kapitel legt die Grundlage für die spätere Anwendung dieser Annahmen auf den Mediensektor.
Schlüsselwörter
Neoklassik, klassische Ökonomie, Mediensystem, Marktversagen, öffentliche Güter, externe Effekte, Informationsmängel, homo oeconomicus, Medienkonsum, Preis- und Lohnflexibilität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Anwendbarkeit der Neoklassischen Theorie auf das Mediensystem
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Anwendbarkeit der neoklassischen ökonomischen Theorie auf das Mediensystem. Die zentrale Frage ist, wie gut die neoklassische Theorie, insbesondere die Annahme des "homo oeconomicus", das Mediensystem erklärt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Grundlagen der klassischen und neoklassischen Ökonomie, die Übertragbarkeit neoklassischer Annahmen auf den Mediensektor, Marktversagen im Medienbereich (öffentliche Güter, externe Effekte, Wettbewerbsstrukturen, Informationsmängel, Konsumentenverhalten), Kritik an der neoklassischen Theorie im Medienkontext und die Rolle des "homo oeconomicus" beim Medienkonsum.
Welche ökonomischen Ansätze werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht den klassischen ökonomischen Ansatz (Adam Smith, John Stuart Mill) mit der neoklassischen Schule. Es werden die Unterschiede in ihren Annahmen und Schlussfolgerungen, insbesondere bezüglich der Rolle des Staates und der Marktmechanismen, herausgearbeitet.
Was sind die zentralen Annahmen der Neoklassik?
Die zentralen Annahmen der Neoklassik sind flexible Preise und Löhne sowie die Annahme, dass Individuen alle verfügbaren Informationen nutzen, um Entscheidungen zu treffen. Die Arbeit untersucht, inwieweit diese Annahmen auf den Mediensektor zutreffen.
Welche Formen von Marktversagen werden im Mediensektor diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Formen von Marktversagen im Mediensektor, darunter öffentliche Güter, externe Effekte, strukturelle Probleme des Wettbewerbs, Informationsmängel auf Seiten der Konsumenten und die mögliche Nichtrationalität der Konsumenten.
Wie wird die Rolle des "homo oeconomicus" betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Anwendbarkeit des "homo oeconomicus"-Modells auf den Medienkonsum und hinterfragt, ob dieses Modell das reale Verhalten von Medienkonsumenten ausreichend beschreibt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Einleitung, dem klassischen Ansatz, den Annahmen der Neoklassik, der Allokation von Ressourcen, Marktversagen im Mediensektor, Kritik an der Neoklassik und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Neoklassik, klassische Ökonomie, Mediensystem, Marktversagen, öffentliche Güter, externe Effekte, Informationsmängel, homo oeconomicus, Medienkonsum, Preis- und Lohnflexibilität.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage und den Aufbau erläutert. Es folgen Kapitel, die die klassischen und neoklassischen Ansätze vorstellen, Marktversagen im Mediensektor analysieren und die Kritik an der Neoklassik diskutieren. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
- Quote paper
- Dipl. rer.com. Verena Pohl (Author), 2004, Die Neoklassik - Grundlagen und zentrale Aussagen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57675