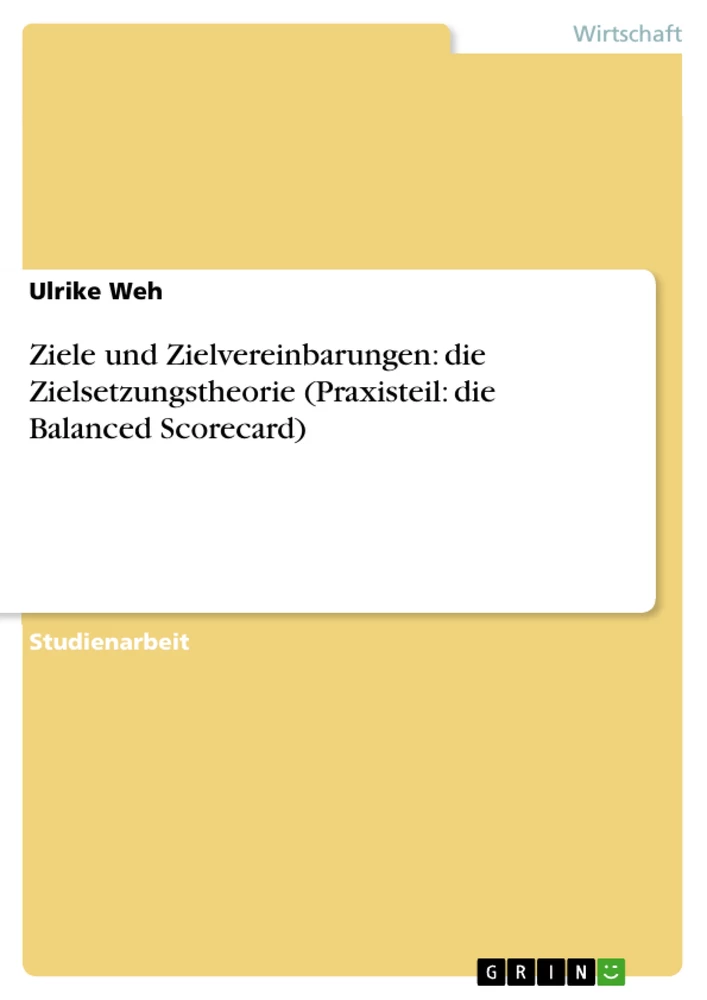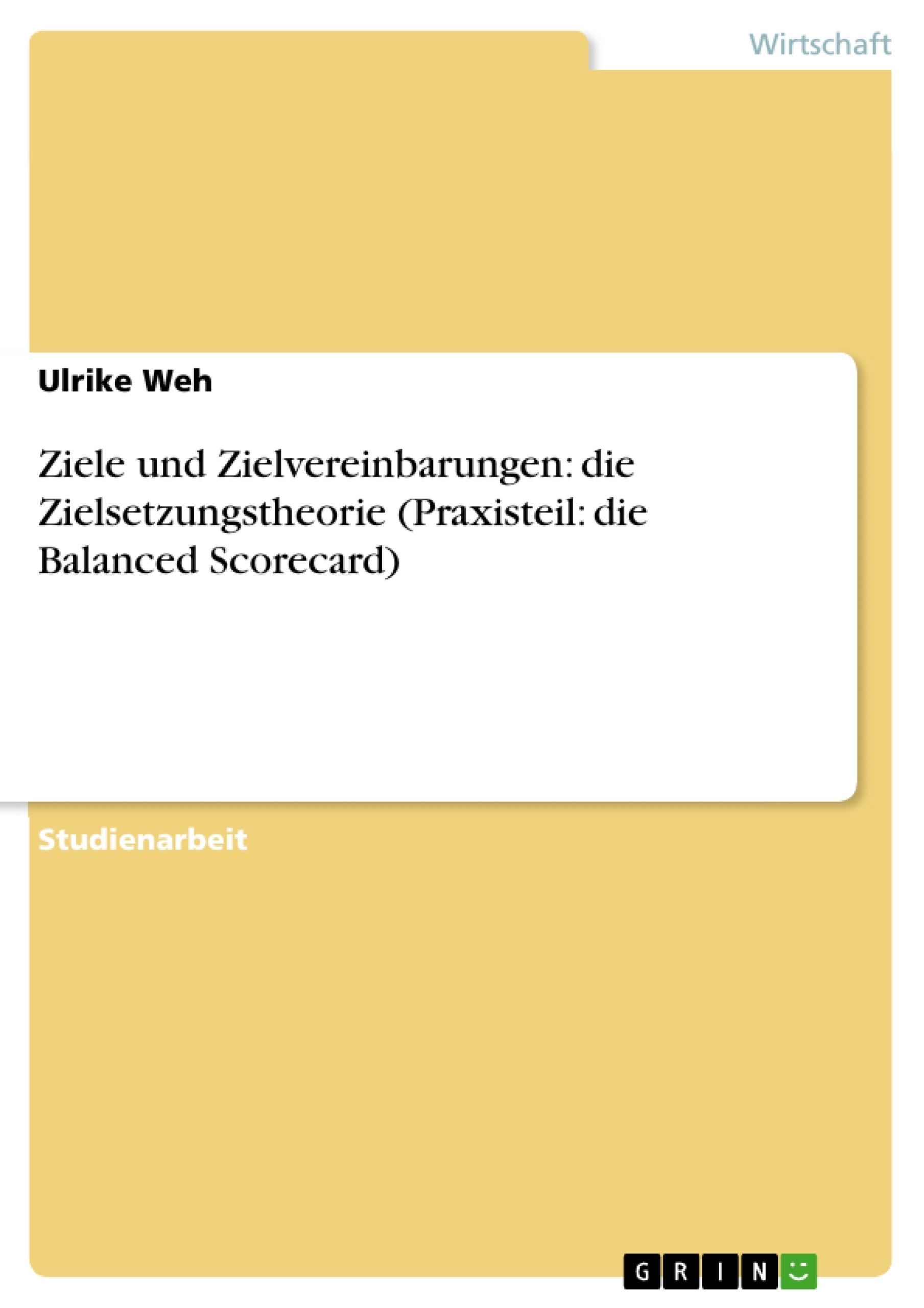„Ziel“ gehört etymologisch zur Wortgruppe „Zeit“ und erhielt im Laufe der Entwicklung eine Bedeutung als räumlicher und zeitlicher Endpunkt (Schüler Duden 1987: 482). Steckt sich eine natürliche Person ein Ziel, so definiert sie darüber eine Vorgabe, die sich auf zukünftig angestrebte Handlungsresultate bezieht (Kohnke 2002: 38 zitiert nach Locke/Latham 1990). Also beeinflussen Ziele menschliches Handeln, bzw. kann menschliches Handeln durch Ziele und deren Vorgabe beeinflusst werden. In der betrieblichen Praxis werden Ziele bereits seit langem, in rudimentärer Form wahrscheinlich schon seit der Geburtsstunde der ersten Arbeitsorganisation vereinbart (Bungard 2002: 22). Wissenschaftliche Beachtung fanden Ziele erstmals 1912, als in den Ach-Hillgruberschen Schwierigkeitsgesetzen formuliert wurde, dass mit steigender Schwierigkeit einer übernommenen Aufgabe unreflektiert die willentliche Anstrengung zu deren Erfüllung steigt (Kohnke 2002: 38). Die Zielsetzungstheorie im heutigen Sinne wurde aus der ursprünglichen Frage, warum manche Arbeitnehmer ceteris paribus bessere Leistungen zeigen als andere (Kohnke 2002: 38), in den letzten 35 Jahren induktiv aus mehreren hundert empirischen Untersuchungen entwickelt (Locke/Latham 2002: 705) und gilt als eine der validesten Theorien für Arbeitsmotivation im organisationspsychologischen Kontext (Locke/Latham 2002: 714). Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich zunächst mit den Kernaussagen der Zielsetzungstheorie und dem darauf basierenden, von Locke und Latham 1990 entwickelten High Performance Cycle, der den Zusammenhang von Zieleigenschaften und Performanz als Kreislauf, mit Hilfe diverser Mediatoren und Moderatoren erklärt. Da Zeit im Originalmodell bisher kaum berücksichtigt wurde, werden im folgenden Kapitel Vorschläge zu deren besserer Integration vorgestellt. Anschließend beschäftigt sich die Arbeit mit dem Aspekt, das Zielsetzung auch negative Auswirkungen haben kann und gegebenenfalls unethisches Verhalten motiviert. Den Abschluss bildet die Betrachtung der praktischen Anwendung von Zielvereinbarungen im Rahmen einer Balanced Scorecard.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung und Themenabgrenzung
- Die Zielsetzungstheorie (der High Performance Cycle)
- Mediatoren des High Performance Cycle
- Moderatoren des High Performance Cycle
- Weitere Elemente des High Performance Cycle
- Kritik am High Performance Cycle
- Temporäre Aspekte in der Zielsetzungstheorie
- Zielsetzung und unethisches Verhalten
- Verständnisfragen zur Zielsetzungstheorie
- Zielsetzung in der betrieblichen Praxis
- Die Balanced Scorecard
- Definition
- Vorgehen
- Empirie
- Aspekte bei der Umsetzung
- Die Balanced Scorecard in der Perspektive des HPC
- Die Balanced Scorecard
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Zielsetzungstheorie und ihrem Einfluss auf die Arbeitsmotivation. Sie untersucht den Zusammenhang zwischen Zielsetzung und Performanz im Rahmen des High Performance Cycle, einem Modell von Locke und Latham.
- Die Kernaussagen der Zielsetzungstheorie
- Der High Performance Cycle
- Temporäre Aspekte der Zielsetzung
- Ethische Implikationen der Zielsetzung
- Praktische Anwendung der Zielsetzung in der Balanced Scorecard
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung und Themenabgrenzung: Die Einleitung definiert den Begriff „Ziel“ und erläutert die Entwicklung der Zielsetzungstheorie als einflussreiche Motivationstheorie in der Organisationspsychologie.
- Die Zielsetzungstheorie (der High Performance Cycle): Dieses Kapitel präsentiert die Kernaussagen der Zielsetzungstheorie, die besagen, dass schwierige und spezifische Ziele zu besserer Leistung führen. Der High Performance Cycle wird vorgestellt, der die Faktoren und Zusammenhänge zwischen Zielen, Performanz und anderen Variablen erklärt.
- Temporäre Aspekte in der Zielsetzungstheorie: Dieses Kapitel diskutiert die Bedeutung von Zeit im Kontext der Zielsetzung und stellt Vorschläge für die Integration von Zeit in das Modell des High Performance Cycle vor.
- Zielsetzung und unethisches Verhalten: Hier wird die potenziell negative Seite der Zielsetzung beleuchtet und die Möglichkeit untersucht, dass Zielvereinbarungen unethisches Verhalten fördern können.
- Zielsetzung in der betrieblichen Praxis: Dieses Kapitel analysiert die praktische Anwendung der Zielsetzungstheorie in Unternehmen, insbesondere im Rahmen der Balanced Scorecard. Die Balanced Scorecard ist ein Managementinstrument, das verschiedene Zieldimensionen berücksichtigt, um die Performance eines Unternehmens zu messen und zu steuern.
Schlüsselwörter
Zielsetzungstheorie, High Performance Cycle, Zielschwierigkeit, Zielspezifität, Zielcommitment, Mediatoren, Moderatoren, Balanced Scorecard, Arbeitsmotivation, Performanz, Ethik.
- Quote paper
- Dipl. Verwaltungswissenschaftler Ulrike Weh (Author), 2005, Ziele und Zielvereinbarungen: die Zielsetzungstheorie (Praxisteil: die Balanced Scorecard), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57640