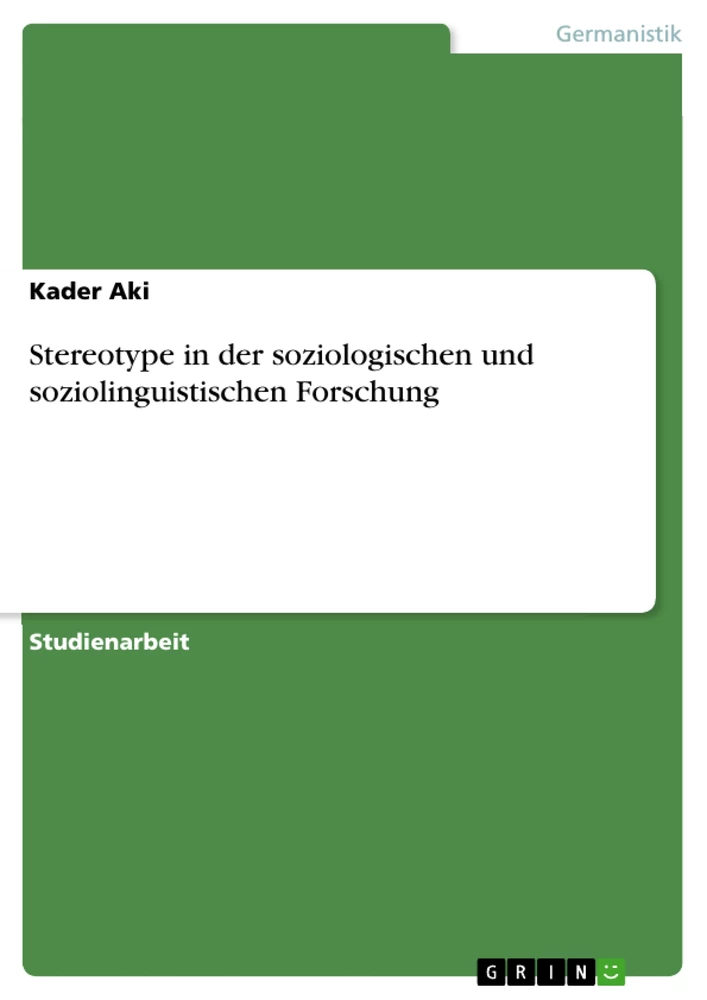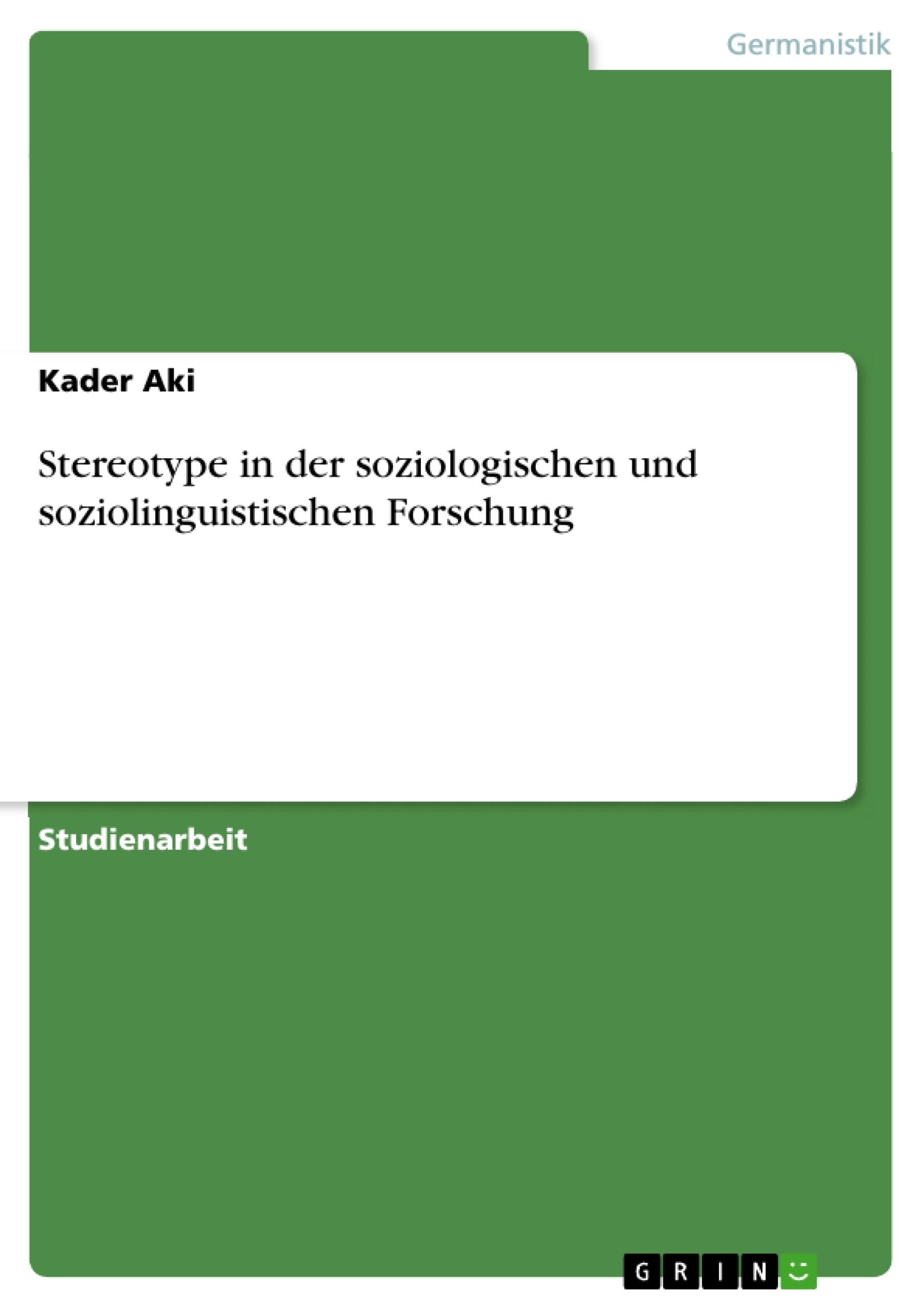Stereotype als Bestandteile des menschlichen Denkens, Sprechens und Handelns sind seit der Einführung des Begriffs in den zwanziger Jahren ein Interessenpunkt für verschiedene Disziplinen, wie etwa für Sozialpsychologie, Psychologie, Linguistik und Literaturwissenschaft, was natürlich zur Folge hat, dass der Begriff und seine Definition stark umstritten wird.
In dieser Arbeit geht es um die verschiedenen Aspekte des Stereotypenbegriffs aus der Sicht verschiedener Disziplinen, jedoch hauptsächlich um die Sicht aus (sozio-)linguistischer Perspektive.
Ein Querschnitt von diversen Stereotypenkonzepten wird dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen des Stereotypenbegriffs
- Der Lippmannsche Stereotypenbegriff in den Sozialwissenschaften
- Abgrenzung der Begriffe „Vorurteil“ und „Stereotyp“
- Stereotyp in der Linguistik
- Wertende Stereotype
- Normative Stereotype
- Soziologischer Aspekt des Stereotyps
- Die Entstehung und das Erlernen von Stereotypen
- Ethnozentrismus
- Gruppenaspekte
- Funktionen von Stereotypen
- Kognitive Kategorisierung
- Soziale Funktionen
- Psychische Funktionen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Stereotypenbegriff aus verschiedenen disziplinären Perspektiven, vor allem aus sozio- und linguistischer Sicht. Ziel ist es, verschiedene Stereotypenkonzepte zu vergleichen und einen Überblick über den Begriff zu geben. Aufgrund des begrenzten Umfangs können nicht alle Aspekte detailliert behandelt werden.
- Der Lippmannsche Stereotypenbegriff und seine Interpretationen.
- Die soziologischen Aspekte der Stereotypenentstehung und -funktionen.
- Die linguistische Klassifizierung von Stereotypen (wertend und normativ).
- Der Einfluss von Kultur und Gesellschaft auf die Bildung von Stereotypen.
- Die Funktionen von Stereotypen auf kognitiver, sozialer und psychischer Ebene.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt Stereotype als Bestandteil menschlichen Denkens, Sprechens und Handelns und erläutert den stark umstrittenen Begriff und seine Definitionen in verschiedenen Disziplinen. Die Arbeit konzentriert sich auf sozio- und linguistische Perspektiven und bietet einen Querschnitt verschiedener Stereotypenkonzepte, wobei aufgrund des begrenzten Umfangs nicht alle Aspekte detailliert dargestellt werden können. Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: die Definition des Begriffs, der soziologische Aspekt und die Funktionen von Stereotypen.
Definitionen des Stereotypenbegriffs: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Stereotypenbegriffs, beginnend mit der Entstehungsgeschichte. Es vergleicht insbesondere die von Wenzel und Quasthoff formulierten Definitionen und legt sie als Grundlage für die linguistische Analyse dar. Lippmanns Definition des Stereotyps als rationales Verfahren zur Reduktion der Komplexität der Umwelt wird detailliert untersucht, ebenso wie die Interpretationen anderer Autoren wie Lilli und Wenzel. Das Kapitel analysiert Lippmanns Ansicht von Stereotypen als „Bilder in unserem Kopf“, die unser Verhalten stärker beeinflussen als die Realität, und beleuchtet den Unterschied zwischen der wahrgenommenen und der wirklichen Welt. Der Bezug zur kulturellen Prägung und Vermittlung von Denkschemata wird ebenfalls diskutiert, zusammen mit dem Aspekt, dass Stereotype nicht neutral sind, sondern positive und negative Funktionen erfüllen. Quasthoffs Interpretation von Stereotypen als geordnetes Weltbild, das unsere Gewohnheiten, unseren Geschmack etc. prägt wird ebenfalls einbezogen.
Soziologischer Aspekt des Stereotyps: Dieses Kapitel untersucht den kulturellen Aspekt von Stereotypen aus soziologischer Sicht. Es erläutert den Entstehungsmechanismus und die Ursachen von Stereotypen, wobei der Zusammenhang mit den Funktionsweisen im Detail im darauf folgenden Kapitel betrachtet wird. Die Entstehung und das Erlernen von Stereotypen werden behandelt, ebenso wie der Einfluss von Ethnozentrismus und Gruppenaspekten auf die Bildung und Verbreitung von Stereotypen. Der Fokus liegt auf den gesellschaftlichen und kulturellen Prozessen, die zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Stereotypen beitragen.
Funktionen von Stereotypen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Funktionen von Stereotypen auf kognitiver, sozialer und psychischer Ebene. Die kognitive Kategorisierung als eine Funktion von Stereotypen zur Bewältigung der Komplexität der Umwelt wird beleuchtet. Es werden die sozialen Funktionen, wie z.B. die soziale Ordnung und die Gruppenidentität, und die psychischen Funktionen wie z.B. Selbstwertgefühl und Sicherheit, erklärt. Der Schwerpunkt liegt darauf, zu zeigen, wie Stereotype in verschiedenen Bereichen des sozialen und individuellen Lebens eine Rolle spielen und welche Auswirkungen sie haben.
Schlüsselwörter
Stereotyp, Vorurteil, Lippmann, Soziologie, Soziolinguistik, Linguistik, Kognitive Kategorisierung, Soziale Funktionen, Psychische Funktionen, Ethnozentrismus, Kultur, Gesellschaft, Wahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Stereotypenbegriffs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Stereotypenbegriff aus verschiedenen Perspektiven, hauptsächlich der Soziologie und Linguistik. Sie vergleicht unterschiedliche Stereotypenkonzepte und bietet einen Überblick über den Begriff, wobei aufgrund des Umfangs nicht alle Aspekte detailliert behandelt werden können.
Welche Perspektiven werden eingenommen?
Die Arbeit betrachtet den Stereotypenbegriff aus soziologischer und linguistischer Sicht. Dabei wird der Lippmannsche Stereotypenbegriff und seine Interpretationen genauer untersucht. Die linguistische Perspektive fokussiert auf die Klassifizierung von Stereotypen (wertend und normativ).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition des Stereotypenbegriffs (inkl. Abgrenzung zu Vorurteilen), soziologische Aspekte der Stereotypenentstehung und -funktionen (Ethnozentrismus, Gruppenaspekte), und die Funktionen von Stereotypen auf kognitiver, sozialer und psychischer Ebene. Der Einfluss von Kultur und Gesellschaft auf die Bildung von Stereotypen wird ebenfalls betrachtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Definitionen des Stereotypenbegriffs (inkl. Lippmanns Definition und Interpretationen), ein Kapitel zum soziologischen Aspekt von Stereotypen (Entstehung und Erlernen), ein Kapitel zu den Funktionen von Stereotypen (kognitiv, sozial, psychisch) und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
Welche Definitionen des Stereotypenbegriffs werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht verschiedene Definitionen des Stereotypenbegriffs, insbesondere die von Lippmann (Stereotype als "Bilder im Kopf"), und diskutiert deren Interpretationen durch andere Autoren wie Lilli und Wenzel. Die Definitionen von Wenzel und Quasthoff dienen als Grundlage für die linguistische Analyse. Der Unterschied zwischen wahrgenommener und wirklicher Welt im Kontext von Stereotypen wird ebenfalls beleuchtet.
Wie wird der soziologische Aspekt von Stereotypen behandelt?
Der soziologische Aspekt behandelt die Entstehung und das Erlernen von Stereotypen, den Einfluss von Ethnozentrismus und Gruppenaspekten auf deren Bildung und Verbreitung. Der Fokus liegt auf gesellschaftlichen und kulturellen Prozessen, die zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Stereotypen beitragen.
Welche Funktionen von Stereotypen werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Funktionen von Stereotypen auf kognitiver Ebene (kognitive Kategorisierung), sozialer Ebene (soziale Ordnung, Gruppenidentität) und psychischer Ebene (Selbstwertgefühl, Sicherheit). Es wird gezeigt, wie Stereotype in verschiedenen Bereichen des sozialen und individuellen Lebens eine Rolle spielen und welche Auswirkungen sie haben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Stereotyp, Vorurteil, Lippmann, Soziologie, Soziolinguistik, Linguistik, Kognitive Kategorisierung, Soziale Funktionen, Psychische Funktionen, Ethnozentrismus, Kultur, Gesellschaft, Wahrnehmung.
- Quote paper
- Kader Aki (Author), 2004, Stereotype in der soziologischen und soziolinguistischen Forschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57399