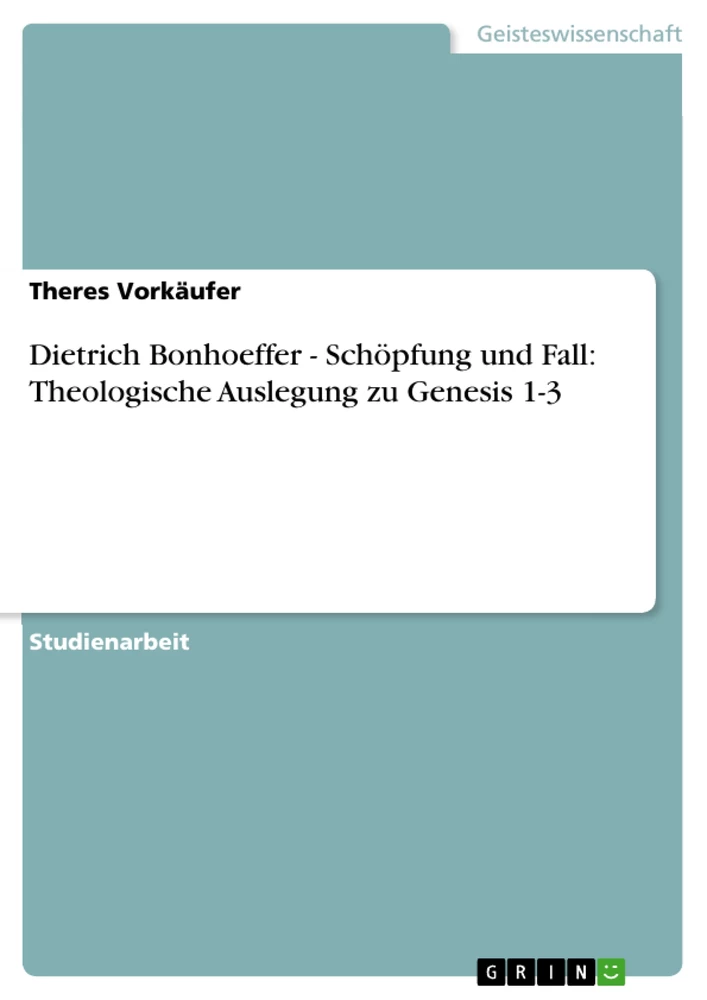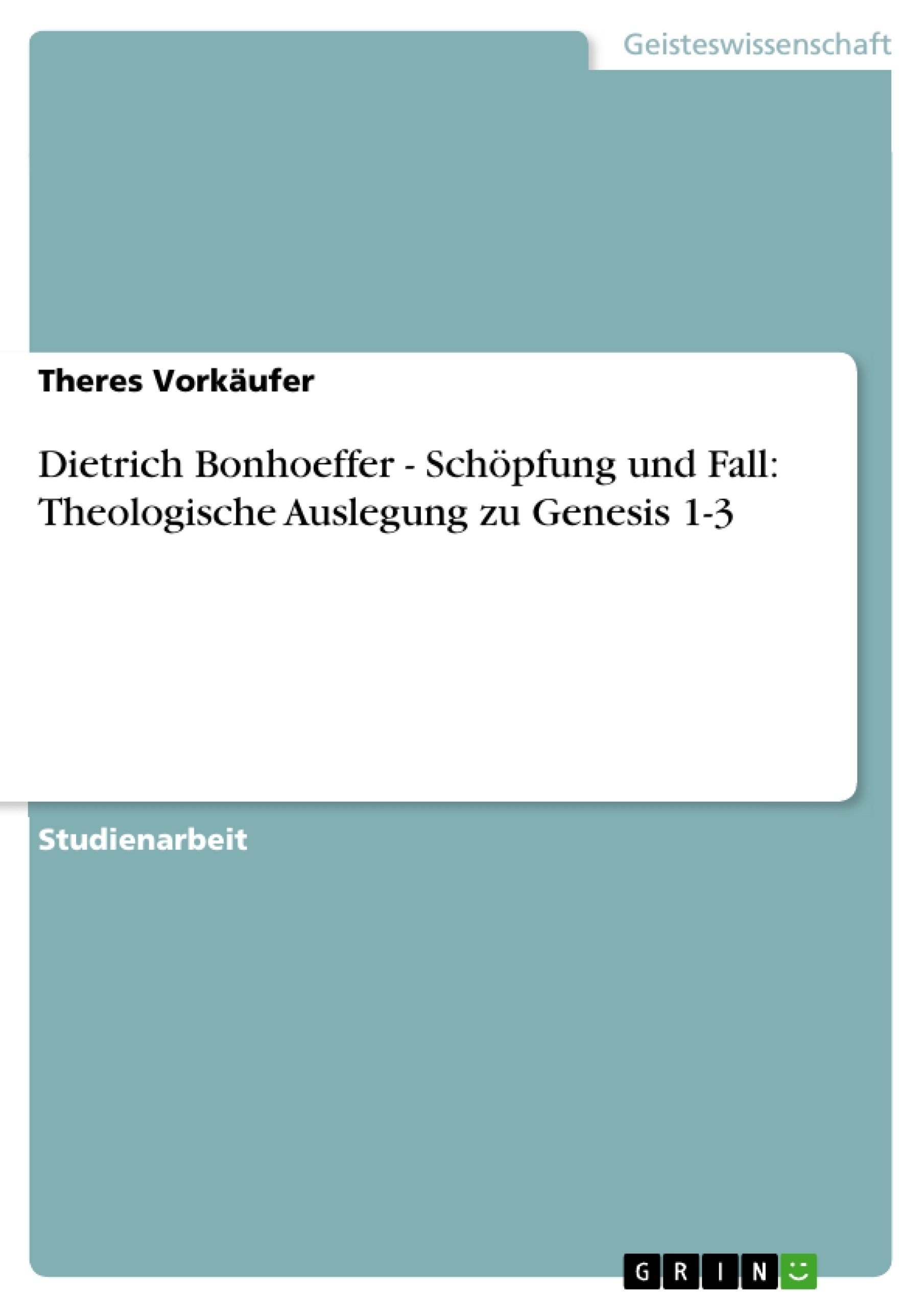Es ist Spätherbst 1932. Das Deutschland der jungen Weimarer Republik ist gezeichnet von den Folgen des verlorenen Krieges - politische, gesellschaftliche und soziale Wirren prägen den Alltag jener Zeit. Die düsteren Seiten des kapitalistischen Systems sind bereits unübersehbar: sechs Millionen Arbeitslose, Wirtschaftskrisen, zahllose hungernde und frierende Menschen, die tatenlos zusehen müssen, wie Getreide verbrannt und Kaffee ins Meer geschüttet wird, nur damit die Preise hoch bleiben - Armut und Elend überall. Die sozialen und gesellschaftlichen Missstände sind wiederum der perfekte Nährboden für die Wahlpropaganda der verschiedene politischen Parteien. Es zeichnet sich mit jedem Wahlgang ein immer gravierender Konkurrenzkampf zwischen den linken und rechten Extremen ab. Ein jäher Abbau der erst jüngst geschaffenen Demokratie beginnt - Entparlamentarisierung und Radikalisierung bestimmen die politischen Auseinandersetzungen, welche jetzt (wortwörtlich) bis auf die Straßen getragen werden: Aufmärsche, Anschläge, Straßenschlachten. Mit der, am 01.06.1932 neu gewählten Regierung unter Reichskanzler Franz von Papen gibt es nur noch einen Kurs, der geradewegs auf eine rechtsextreme Diktatur zusteuert. Bereits am 30.01.1933 wird ein Mann namens Adolf Hitler zum neuen Reichskanzler gewählt werden. Nur einen Monat später (05.03.1933) wird die Weimarer Republik aufgelöst und eine nationalsozialistische Diktatur errichtet werden. Aber schon jetzt (im Herbst 1932) haben sich auch an den Universitäten typische nationalsozialistische Erscheinungsformen unter den Professoren - die der Theologie inbegriffen - herausgebildet. Umso mehr fällt der junge, noch eher unbekannte Privatdozent und Studentenpfarrer, Dietrich Bonhoeffer, in seinem akademischen Umgang mit den Studenten und der methodischen Vermittlung von Lerninhalten aus dem Rahmen: soziales Lernens und Lernen durch Erleben (beispielsweise durch Exkursionen; offene Abende, etc.) prägen seine Veranstaltungen. Auch bei Dietrich Bonhoeffers Tätigkeiten außerhalb der Universität steht nicht die dogmatische Vermittlung der Theologie, sondern die christliche Gemeinschaft („sanctorum Communio“) im Mittelpunkt. Bonhoeffer engagiert sich in der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin Ost und unterrichtet eine bis dahin sehr verwilderte Konfirmandengruppe - die Zionsgemeinde im Arbeiterviertel am Prenzlauer Berg, die derzeit mit den schlimmsten sozialen und gesellschaftlichen Verhältnissen in ganz Berlin zu kämpfen hat.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Zeit und Umstände der Entstehung des Werkes
- Zum Werk
- Vom Vorlesungsmanuskript zum Druck
- Kurze Inhaltsangabe zum Kapitel „Das Bild Gottes auf Erden“
- Intentionen zu „Das Bild Gottes auf Erden“
- Bibliographie
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Multimediale Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Dietrich Bonhoeffers Vorlesung „Schöpfung und Sünde. Theologische Auslegung zu Genesis 1-3“, die im Wintersemester 1932/33 an der Berliner Technischen Hochschule entstand. Ziel ist es, den Kontext der Entstehung, die Intentionen Bonhoeffers und die zentralen theologischen Aussagen der Vorlesung zu beleuchten.
- Der soziopolitische Kontext Deutschlands im Herbst 1932 und dessen Einfluss auf Bonhoeffers Denken
- Bonhoeffers pädagogischer Ansatz und sein Engagement in der sozialen Arbeit
- Die theologische Interpretation von Genesis 1-3 und die Aktualität der Thematik
- Bonhoeffers Auseinandersetzung mit traditionellen theologischen Ansätzen
- Der Weg vom Vorlesungsmanuskript zur Veröffentlichung
Zusammenfassung der Kapitel
Zeit und Umstände der Entstehung des Werkes: Der Herbst 1932 in Deutschland ist geprägt von der Weimarer Republik in ihrer Krise. Sechs Millionen Arbeitslose, wirtschaftliche Instabilität und die zunehmende Radikalisierung der politischen Landschaft bilden den Hintergrund. Die extremen politischen Strömungen und der Aufstieg des Nationalsozialismus schaffen ein Klima der Unsicherheit. Bonhoeffer, ein junger Privatdozent und Studentenpfarrer, zeichnet sich durch seinen sozialen und praxisorientierten Ansatz in Lehre und Gemeindearbeit aus, der sich deutlich von den nationalsozialistischen Tendenzen an den Universitäten abhebt. Sein Engagement für benachteiligte Jugendliche und seine kritische Haltung gegenüber dem aufkommenden Nationalsozialismus werden hier als wichtige Kontextfaktoren hervorgehoben.
Zum Werk: Vom Vorlesungsmanuskript zum Druck: Bonhoeffers Vorlesung „Schöpfung und Sünde“ umfasste 14 Sitzungen und endete im Februar 1933. Die Studierenden baten um die Veröffentlichung des Manuskripts, beeindruckt von Bonhoeffers neuartiger theologischer Herangehensweise und der Aktualität seiner Interpretation von Genesis 1-3 im Kontext der gesellschaftlichen und politischen Umbrüche. Der Text zeichnet sich durch eine intensive Auseinandersetzung mit zentralen Begriffen wie Ebenbildlichkeit, Gemeinschaft, Geschlechtlichkeit und die Bedeutungswandel von „Leben“ durch den Sündenfall aus. Die erhalten gebliebenen Vorlesungsmitschriften sind aufgrund des Verlustes anderer Aufzeichnungen Bonhoeffers umso wertvoller. Die Veröffentlichung erforderte eine Titeländerung.
Schlüsselwörter
Dietrich Bonhoeffer, Schöpfung, Sünde, Genesis 1-3, Theologische Auslegung, Nationalsozialismus, Weimarer Republik, Soziale Arbeit, Christliche Gemeinschaft, Bibelinterpretation, Theologische Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen zu Dietrich Bonhoeffers "Schöpfung und Sünde"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über Dietrich Bonhoeffers Vorlesung "Schöpfung und Sünde. Theologische Auslegung zu Genesis 1-3", gehalten im Wintersemester 1932/33 an der Berliner Technischen Hochschule. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel, sowie Schlüsselwörter. Es beleuchtet den Entstehungskontext, Bonhoeffers Intentionen und die zentralen theologischen Aussagen der Vorlesung.
Wann und unter welchen Umständen entstand Bonhoeffers Vorlesung?
Die Vorlesung entstand im Herbst 1932, während der Weimarer Republik in ihrer Krise. Sechs Millionen Arbeitslose, wirtschaftliche Instabilität und der Aufstieg des Nationalsozialismus prägten das Klima. Bonhoeffers sozialer und praxisorientierter Ansatz in Lehre und Gemeindearbeit hob sich deutlich von den nationalsozialistischen Tendenzen ab.
Was sind die zentralen Themen der Vorlesung?
Die Vorlesung behandelt die theologische Interpretation von Genesis 1-3. Zentrale Themen sind Bonhoeffers pädagogischer Ansatz, sein Engagement in der sozialen Arbeit, seine Auseinandersetzung mit traditionellen theologischen Ansätzen, und die Aktualität seiner Interpretation im Kontext der gesellschaftlichen und politischen Umbrüche. Begriffe wie Ebenbildlichkeit, Gemeinschaft, Geschlechtlichkeit und der Bedeutungswandel von „Leben“ durch den Sündenfall werden intensiv behandelt.
Wie ist die Vorlesung vom Manuskript zum Druck gelangt?
Die Studierenden baten nach Abschluss der 14 Vorlesungssitzungen im Februar 1933 um die Veröffentlichung des Manuskripts, beeindruckt von Bonhoeffers Ansatz. Die Veröffentlichung erforderte eine Titeländerung, und die erhalten gebliebenen Vorlesungsmitschriften sind aufgrund des Verlustes anderer Aufzeichnungen Bonhoeffers besonders wertvoll.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Vorlesung?
Schlüsselwörter sind: Dietrich Bonhoeffer, Schöpfung, Sünde, Genesis 1-3, Theologische Auslegung, Nationalsozialismus, Weimarer Republik, Soziale Arbeit, Christliche Gemeinschaft, Bibelinterpretation, Theologische Pädagogik.
Welche Zielsetzung verfolgt dieses Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, den Kontext der Entstehung, die Intentionen Bonhoeffers und die zentralen theologischen Aussagen der Vorlesung "Schöpfung und Sünde" zu beleuchten.
Welche Quellen wurden verwendet?
Das Dokument listet ein Quellen- und Literaturverzeichnis sowie multimediale Literatur auf (genaue Angaben fehlen im vorliegenden Auszug).
- Quote paper
- Theres Vorkäufer (Author), 2006, Dietrich Bonhoeffer - Schöpfung und Fall: Theologische Auslegung zu Genesis 1-3, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57346