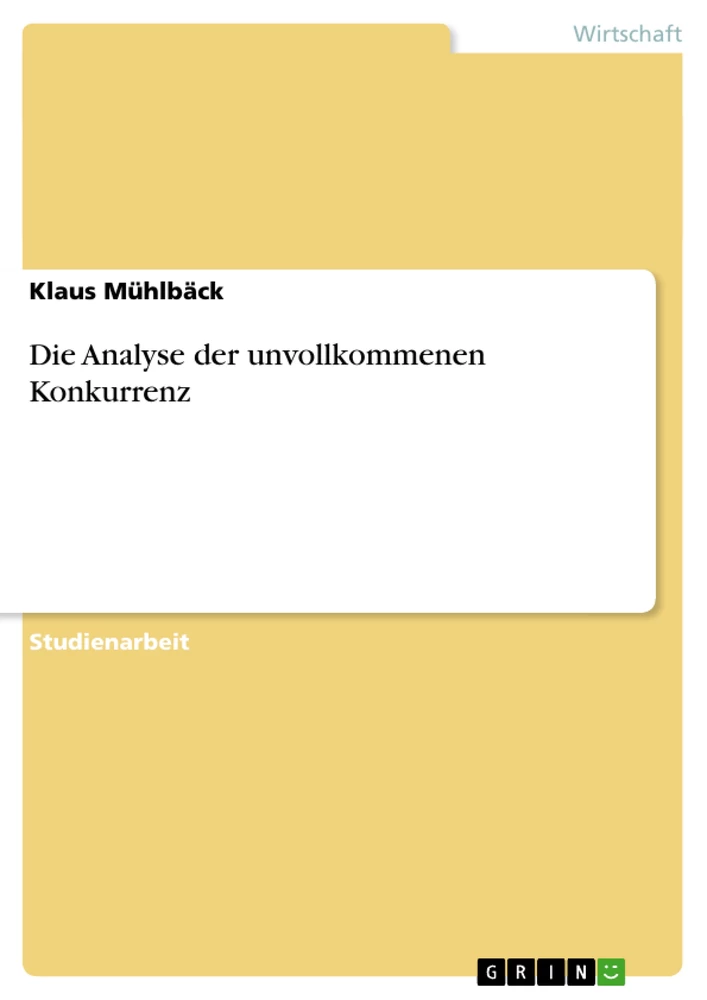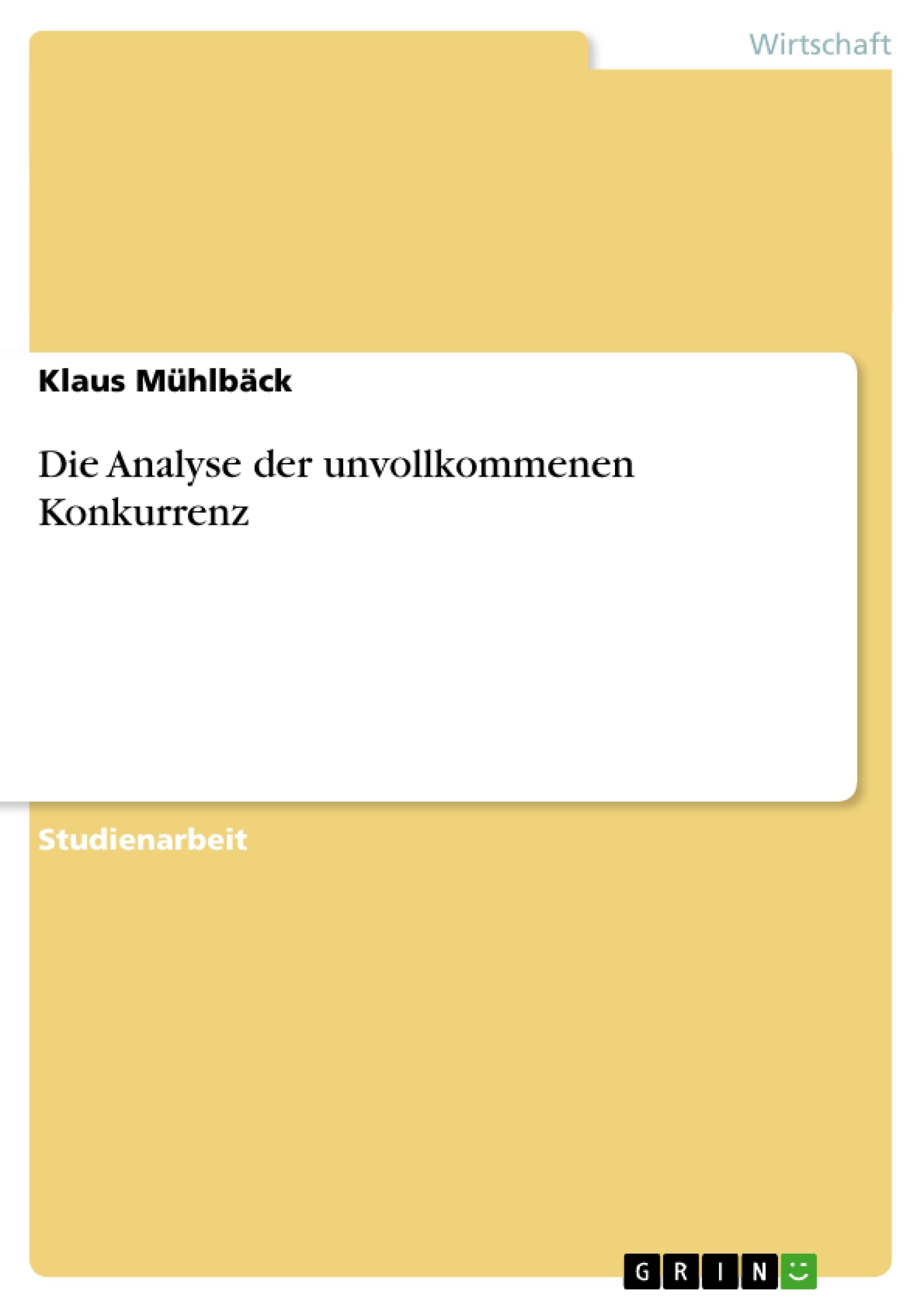Schon im Jahr 1776 hat Adam Smith in seinem bahnbrechenden Werk Vom Wohlstand der Nationen erkannt, daß „Geschäftsleute des gleichen Gewerbes selten zusammenkommen, selbst zu Festen und zur Zerstreuung, ohne daß das Gespräch in einer Verschwörung gegen die Öffentlichkeit endet oder irgendein Plan ausgeheckt wird, wie man die Preise erhöhen kann.“ Nichts von diesem Verdacht hat bis zum heutigen Tage an Aktualität verloren, ganz im Gegenteil, Unternehmenszusammenschlüsse, Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen sind vermehrt Thema des wirtschaftspolitischen Tagesgesprächs. Die gegenwärtige Wettbewerbskommissarin der Europäischen Union, Neelie Kroes, hat zuletzt auf die Gefahren marktausschließender Verhaltensweisen hingewiesen, nicht ohne die Begriffe Marktmacht und Marktmißbrauch in Zusammenhang zu bringen.
Freier Wettbewerb auf Märkten ist unbestritten der wichtigste Faktor zur Bildung volkswirtschaftlich optimaler Preise und Ausbringungsmengen. Bedingung des freien Wettbewerbs ist es, daß ein Marktteilnehmer zwischen mehreren Angeboten der Marktgegenseite wählen kann , in der idealtypischen Form befindet er sich in einem Markt vollkommener Konkurrenz.
Aufgrund der hohen Aktualität der Wettbewerbsproblematik ist es Ziel der vorliegenden Studie, die unvollkommene Konkurrenz zu analysieren. Ausgehend vom Idealtypus der vollkommenen Konkurrenz werden Strukturen des Wettbewerbsmarktes analysiert, ihre verschiedenen in Theorie und Realität vorkommenden Ausprägungen betrachtet, um schließlich Ziele und Instrumente zur Vermeidung von Wettbewerbsbeschränkungen darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Abschnitt: Hinführung zur Thematik
- 2. Abschnitt: Die Marktstruktur
- 2.1 Wesen und Formen der Märkte
- 2.2 Marktkonzentration
- 2.3 Die vollkommene Konkurrenz
- 2.4 Die unvollkommene Konkurrenz
- 3. Abschnitt: Das Angebotsmonopol
- 3.1 Das Marktgleichgewicht im Angebotsmonopol
- 3.2 Die Ineffizienz des Angebotsmonopols
- 4. Abschnitt: Das Angebotsoligopol
- 4.1 Das Analyseproblem im Angebotsoligopol
- 4.2 Die Cournot'sche Lösung des Dyopolproblems
- 4.3 Die Theorie der geknickten Nachfragekurve
- 4.4 Bewußt Parallelverhalten
- 4.5 Kartelle
- 5. Abschnitt: Die monopolistische Konkurrenz
- 5.1 Die Tangentenlösung der monopolistischen Konkurrenz
- 5.2 Die doppelt geknickte Preis-Absatz-Funktion
- 6. Abschnitt: Anti-monopolistische Politik
- 6.1 Verhinderung von Wettbewerbsbeschränkungen durch Kollektivmonopole
- 6.2 Verhinderung von Wettbewerbsbeschränkungen durch Individualmonopole
- 6.3 Erwünschte Monopolisierung
- 7. Abschnitt: Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Seminararbeit ist die Analyse unvollkommener Konkurrenz. Ausgehend vom Modell der vollkommenen Konkurrenz werden verschiedene Marktstrukturen und deren Ausprägungen in Theorie und Praxis untersucht. Die Arbeit beleuchtet Maßnahmen zur Vermeidung von Wettbewerbsbeschränkungen.
- Analyse verschiedener Marktstrukturen
- Untersuchung der unvollkommenen Konkurrenz
- Bewertung der Effizienz verschiedener Marktformen
- Beschreibung von Maßnahmen zur Wettbewerbspolitik
- Bedeutung von Marktkonzentration und Marktmacht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Abschnitt: Hinführung zur Thematik: Dieser einleitende Abschnitt betont die Aktualität des Themas Wettbewerbsbeschränkungen und verweist auf Adam Smiths Beobachtungen über das Verhalten von Geschäftsleuten. Er unterstreicht die Bedeutung von freiem Wettbewerb für volkswirtschaftlich optimale Preise und Mengen und begründet die Notwendigkeit der Analyse unvollkommener Konkurrenz. Der Abschnitt legt den Fokus auf die Untersuchung von Marktstrukturen, ihren Ausprägungen und die Darstellung von Zielen und Instrumenten zur Vermeidung von Wettbewerbsbeschränkungen.
2. Abschnitt: Die Marktstruktur: Dieser Abschnitt definiert zunächst die Marktstruktur anhand der Anzahl der Marktteilnehmer (Anbieter und Nachfrager). Das Stackelberg'sche Marktformenschema wird vorgestellt, welches die verschiedenen Marktformen (Monopol, Oligopol, Polypol) in Abhängigkeit von der Anzahl der Marktteilnehmer auf der Angebots- und Nachfrageseite darstellt. Der Abschnitt führt den Begriff der Marktkonzentration ein und erklärt die Bedeutung der Concentration Ratio (CR) zur Messung von Marktmacht.
3. Abschnitt: Das Angebotsmonopol: Hier wird das Angebotsmonopol detailliert analysiert, wobei das Marktgleichgewicht und die Ineffizienz im Vergleich zur vollkommenen Konkurrenz im Mittelpunkt stehen. Die Zusammenfassung beschreibt, wie ein Monopolist den Preis und die Menge festlegt und wie dies zu Wohlfahrtsverlusten führen kann. Der Abschnitt veranschaulicht die Folgen von Monopolen für Konsumenten und die Wirtschaft.
4. Abschnitt: Das Angebotsoligopol: Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Angebotsoligopol, einem Markt mit wenigen Anbietern. Die Komplexität der Analyse aufgrund des wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnisses der Anbieter wird hervorgehoben. Verschiedene Modelle zur Erklärung des Verhaltens von Oligopolisten werden vorgestellt, darunter das Cournot-Modell, die Theorie der geknickten Nachfragekurve und die Betrachtung von Kartellen und bewusstem Parallelverhalten. Die Auswirkungen dieser Strategien auf den Wettbewerb und den Marktpreis werden erörtert.
5. Abschnitt: Die monopolistische Konkurrenz: Dieser Abschnitt analysiert die monopolistische Konkurrenz, eine Marktform mit vielen Anbietern, die jedoch differenzierte Produkte anbieten. Die Tangentenlösung und die doppelt geknickte Preis-Absatz-Funktion werden erläutert und die Besonderheiten dieser Marktform im Vergleich zu anderen Marktstrukturen hervorgehoben. Die Auswirkungen der Produktdifferenzierung auf den Wettbewerb und die Preisbildung werden im Detail untersucht.
6. Abschnitt: Anti-monopolistische Politik: Dieser Abschnitt behandelt Maßnahmen der Wettbewerbspolitik zur Verhinderung von Monopolen und Oligopolem und deren Auswirkungen auf den Wettbewerb. Verschiedene Strategien zur Regulierung von Kollektiv- und Individualmonopolen werden analysiert und die Frage nach erwünschter Monopolisierung wird diskutiert. Der Abschnitt diskutiert die rechtlichen und ökonomischen Instrumente, die eingesetzt werden, um Wettbewerbsbeschränkungen zu verhindern und einen fairen Wettbewerb zu fördern.
Schlüsselwörter
Unvollkommene Konkurrenz, Marktstrukturen, Angebotsmonopol, Angebotsoligopol, Monopolistische Konkurrenz, Marktkonzentration, Marktmacht, Wettbewerbsbeschränkungen, Wettbewerbspolitik, Marktgleichgewicht, Ineffizienz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse unvollkommener Konkurrenz
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert unvollkommene Konkurrenzformen. Sie beginnt mit dem Modell der vollkommenen Konkurrenz und untersucht verschiedene Marktstrukturen (Monopol, Oligopol, monopolistische Konkurrenz) in Theorie und Praxis. Ein Schwerpunkt liegt auf Maßnahmen zur Vermeidung von Wettbewerbsbeschränkungen.
Welche Marktstrukturen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die folgenden Marktstrukturen: vollkommene Konkurrenz, Angebotsmonopol, Angebotsoligopol und monopolistische Konkurrenz. Für jede Struktur werden das Marktgleichgewicht, die Effizienz und die Auswirkungen auf Konsumenten und Wirtschaft analysiert.
Wie wird das Angebotsmonopol analysiert?
Das Angebotsmonopol wird detailliert untersucht, inklusive Marktgleichgewicht und Ineffizienz im Vergleich zur vollkommenen Konkurrenz. Die Preis- und Mengenentscheidungen des Monopolisten und die daraus resultierenden Wohlfahrtsverluste werden erläutert.
Wie wird das Angebotsoligopol behandelt?
Das Angebotsoligopol, ein Markt mit wenigen Anbietern, wird aufgrund seiner komplexen Analyseproblematik durch verschiedene Modelle erklärt: Cournot-Modell, Theorie der geknickten Nachfragekurve, Kartelle und bewusstes Parallelverhalten. Die Auswirkungen dieser Strategien auf den Wettbewerb und den Marktpreis werden diskutiert.
Was ist die monopolistische Konkurrenz?
Die monopolistische Konkurrenz beschreibt einen Markt mit vielen Anbietern, die jedoch differenzierte Produkte anbieten. Die Analyse umfasst die Tangentenlösung, die doppelt geknickte Preis-Absatz-Funktion und die Auswirkungen der Produktdifferenzierung auf Wettbewerb und Preisbildung.
Welche Maßnahmen der Wettbewerbspolitik werden besprochen?
Die Arbeit beschreibt Maßnahmen zur Verhinderung von Monopolen und Oligopolem. Es werden Strategien zur Regulierung von Kollektiv- und Individualmonopolen analysiert und die Frage nach erwünschter Monopolisierung diskutiert. Rechtliche und ökonomische Instrumente zur Förderung fairen Wettbewerbs werden behandelt.
Welche Schlüsselbegriffe sind wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Unvollkommene Konkurrenz, Marktstrukturen, Angebotsmonopol, Angebotsoligopol, Monopolistische Konkurrenz, Marktkonzentration, Marktmacht, Wettbewerbsbeschränkungen, Wettbewerbspolitik, Marktgleichgewicht, Ineffizienz.
Welche Ziele verfolgt die Seminararbeit?
Die Arbeit zielt auf die Analyse unvollkommener Konkurrenz ab, untersucht verschiedene Marktstrukturen und deren Ausprägungen, bewertet die Effizienz verschiedener Marktformen und beschreibt Maßnahmen der Wettbewerbspolitik. Die Bedeutung von Marktkonzentration und Marktmacht wird ebenfalls beleuchtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Abschnitte gegliedert: Hinführung zur Thematik, Die Marktstruktur, Das Angebotsmonopol, Das Angebotsoligopol, Die monopolistische Konkurrenz, Anti-monopolistische Politik und Abschließende Bemerkungen. Jeder Abschnitt wird zusammengefasst.
- Quote paper
- Dipl. Betriebswirt (FH) Klaus Mühlbäck (Author), 2005, Die Analyse der unvollkommenen Konkurrenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57339