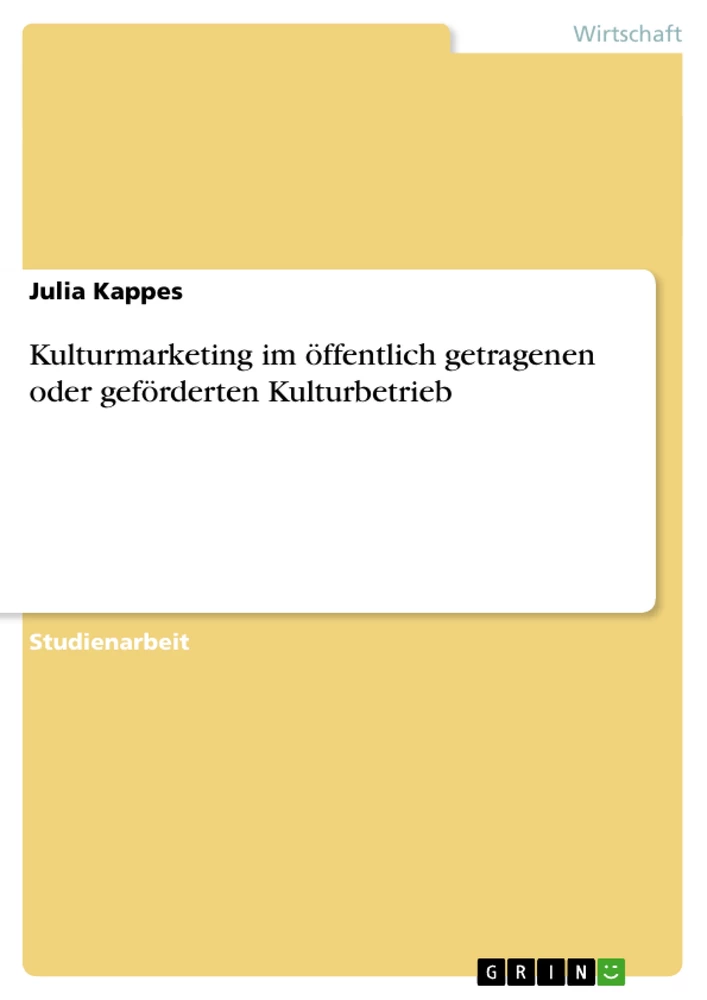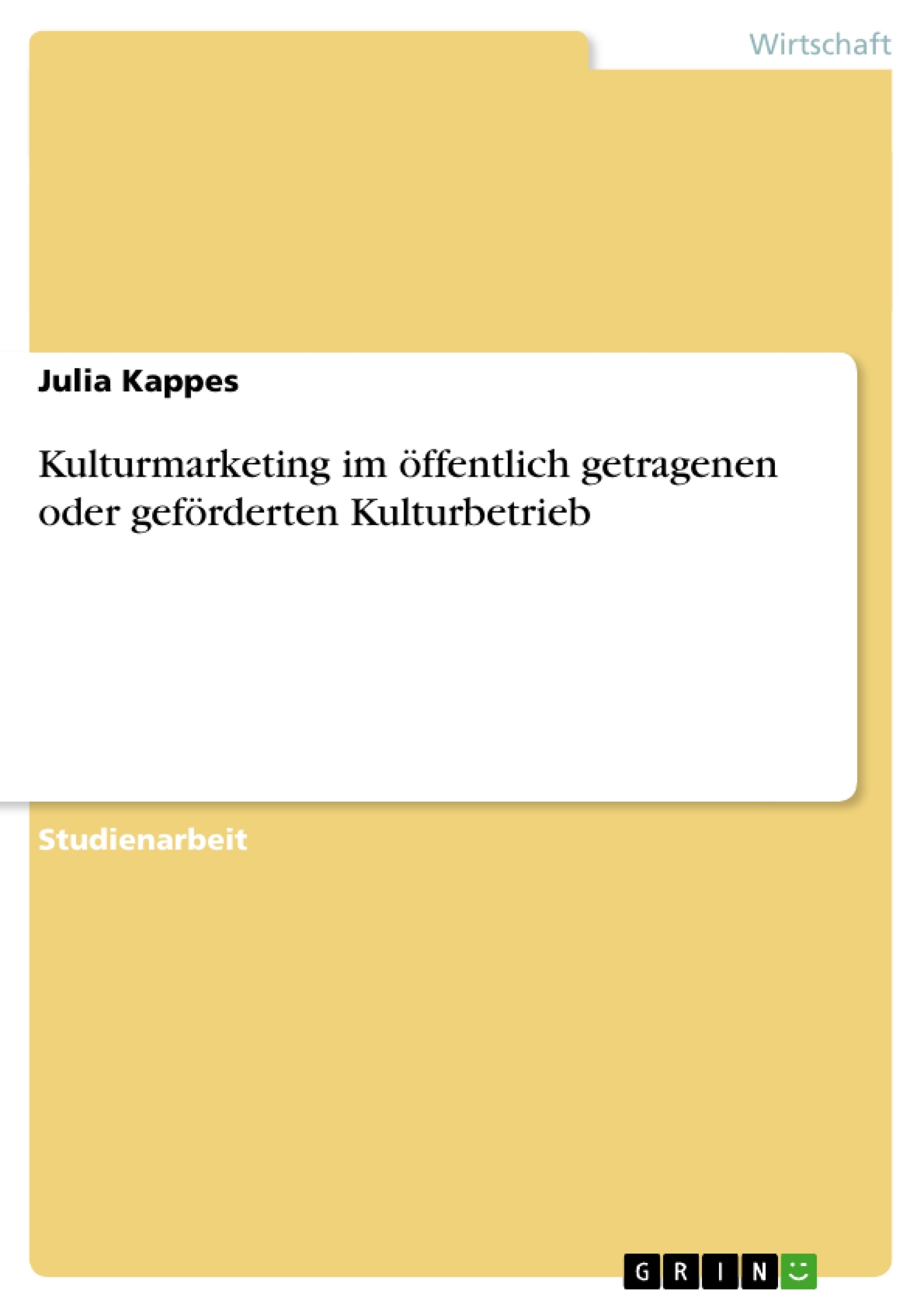Kommunen und Länder sind im Rahmen ihrer Zuständigkeit Träger von Kulturbetrieben oder Unterstützer von solchen. Eingeschlossen kultureller Veranstaltungen. Diese Arbeit setzt sich im Folgenden mit dem Kulturmarketing im staatseigenen bzw. kommunal betriebenen oder staatlich getragenen, das heißt durch Subventionen unterstützten Kulturbetrieb auseinander. Sie stellt sich der Frage, weswegen gerade heute Kulturmarketing in Kulturinstitutionen
wichtiger denn je erscheint und eine Professionalisierung von Nöten ist. Zur
Demonstration, wie Kulturmarketing umgesetzt werden kann, wird der von Klein entwickelte und von den Autorinnen Reimann / Rockweiler in einer leicht modifizierten Version adaptierte Kulturmarketing-Management-Prozess vorgestellt. Um ihn zu veranschaulichen, werden teilweise Beispiele aus der Praxis genannt. Diese sollen natürlich nur exemplarisch für sich stehen. Es versteht sich von selbst, dass das Kulturmarketing des einen Kulturbetriebs
nicht auf den anderen ohne Nachzudenken angewandt werden kann. Kulturmarketing verlangt immer nach individuellen und auf den Kulturbetrieb angepassten Lösungen. Der hier vorgestellte Kulturmarketing-Management-Prozess kann zu diesen führen. Im folgenden werden die Terme Programm, Dienstleistung (Theateraufführung, Oper etc.) oder Güter (Gemälde, Bücher etc. ) oftmals durch das Wort Produkt ersetzt und sprechen damit natürlich von dem Gesamtangebot, d.h. dem Programm, der Dienstleistung oder den
Gütern der Kulturbetriebe. Ebenso verhält es sich mit dem Begriff Kunde, der oftmals synonym für Besucher, Teilnehmer, Nutzer oder Hörer (des öffentlich-rechtlichen Hörfunks / des Rundfunkorchesters etc.) eingesetzt wird.
Die Arbeit hat ihren Schwerpunkt auf das Kulturmarketing zwischen Kulturbetrieb und Kunde (das heißt die Zielgruppen) gelegt. Andere Austauschbeziehungen bleiben aufgrund des Umfangs der Arbeit weitgehend unberücksichtigt (z.B. Kunde und Künstler). Des Weiteren wurde, aus gleichem Grund, auf tiefergehende Darstellung von Kulturmarketing auf der
Steuerungs- und Führungsebene, soll heißen des internen Marketings - verzichtet. Internes Marketing tritt im Allgemeinen hinter dem externen Marketing zurück, da sich Mitarbeiter von Kulturbetrieben normalerweise mit ihrem Kulturbetrieb identifizieren. Das bedeutet aber nicht, dass diese Bereiche weniger bedeutsam innerhalb des Kulturmarketings sind.
Zusammenfassend läßt sich sagen, dass der Schwerpunkt dieser Arbeit auf dem externen Kulturmarketing liegt.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Ansätze zur Begriffsdefinition Kultur
- 3.0 Besonderheiten im öffentlich getragenen oder geförderten Kulturbereich
- 3.1 Zielsetzung
- 3.2 Produktgestaltung- und -produktion
- 3.3 Finanzierung
- 4.0 Kulturmarketing
- 4.1 Begriffserklärung Kulturmarketing
- 4.2 Gründe für Kulturmarketing
- 4.3 Ziele des Kulturmarketings
- 5.0 Methoden und Techniken des Kulturmarketings
- 5.1 Zielsetzung
- 5.2 Marketingforschung: informationsorientiertes Instrument im Kulturmarketing
- 5.2.1 Konkurrenz-Analyse
- 5.2.2 Umweltanalyse
- 5.2.3 Beschaffungs- und Finanzierungs-Analyse
- 5.2.4 Nachfrageanalyse
- 5.2.5 Potenzialanalyse
- 5.2.6 Wissensmanagement / Lobbying
- 5.3 Zieldefinition und Strategieplanung
- 5.4 Operatives Marketing: aktionsorientierte Instrumente im Kulturmarketing
- 5.4.1 Programmpolitik
- 5.4.2 Preis- und Konditionspolitik
- 5.4.3 Distributionspolitik
- 5.4.4 Kommunikationspolitik
- 5.4.5 Servicepolitik
- 5.5 Marketing-Kontrolle und Marketing-Controlling: kontrollierendes und steuernd-begleitendes Instrument im Kulturmarketing
- 6.0 Anwendungsmöglichkeiten und Aufwand in der Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Besonderheiten des Kulturmarketings im öffentlich getragenen oder geförderten Kulturbetrieb und die Notwendigkeit einer Professionalisierung in diesem Bereich. Die Arbeit beleuchtet die Gründe, Ziele und Methoden des Kulturmarketings und präsentiert den Kulturmarketing-Management-Prozess als praktische Umsetzung.
- Die Bedeutung von Kulturmarketing in Kulturinstitutionen
- Die Herausforderungen des Kulturmarketings im öffentlich-rechtlichen und gemeinnützigen Kontext
- Der Kulturmarketing-Management-Prozess als Instrument zur professionellen Umsetzung
- Die Anwendung von Marketinginstrumenten im Kulturbetrieb
- Die besondere Bedeutung von Zielgruppenorientierung im Kulturmarketing
Zusammenfassung der Kapitel
- 1.0 Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Kulturmarketings im öffentlich-rechtlichen und gemeinnützigen Kulturbetrieb dar und führt den Kulturmarketing-Management-Prozess als zentrales Thema der Arbeit ein.
- 2.0 Ansätze zur Begriffsdefinition Kultur: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Ansätze zur Definition von Kultur, die sich vom engen Kulturbegriff bis zum umfassenden Kulturbegriff der Anthroplogie und Ethnologie erstrecken.
- 3.0 Besonderheiten im öffentlich getragenen oder geförderten Kulturbereich: Dieses Kapitel beschreibt die Ziele und Herausforderungen, die im öffentlich getragenen oder geförderten Kulturbereich herrschen. Es betont die Unterschiede zum profitorientierten Kulturbetrieb und die Bedeutung eines anderen Finanzierungsmodells.
- 4.0 Kulturmarketing: Das Kapitel erläutert den Begriff des Kulturmarketings, die Gründe für dessen Bedeutung und die Ziele, die mit Kulturmarketing verfolgt werden.
- 5.0 Methoden und Techniken des Kulturmarketings: Dieses Kapitel stellt verschiedene Methoden und Techniken des Kulturmarketings vor, die in der Praxis eingesetzt werden können. Darunter fallen beispielsweise Marketingforschung, Zieldefinition, Strategieplanung und operative Marketinginstrumente.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Kulturmarketing, Kulturbetrieb, öffentlich-rechtlicher Kulturbetrieb, gemeinnütziger Kulturbetrieb, Kulturmanagement, Kulturmarketing-Management-Prozess, Zielgruppenorientierung, Marketinginstrumente, Programmpolitik, Preis- und Konditionspolitik, Distributionspolitik, Kommunikationspolitik, Servicepolitik.
- Quote paper
- Julia Kappes (Author), 2006, Kulturmarketing im öffentlich getragenen oder geförderten Kulturbetrieb, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57099