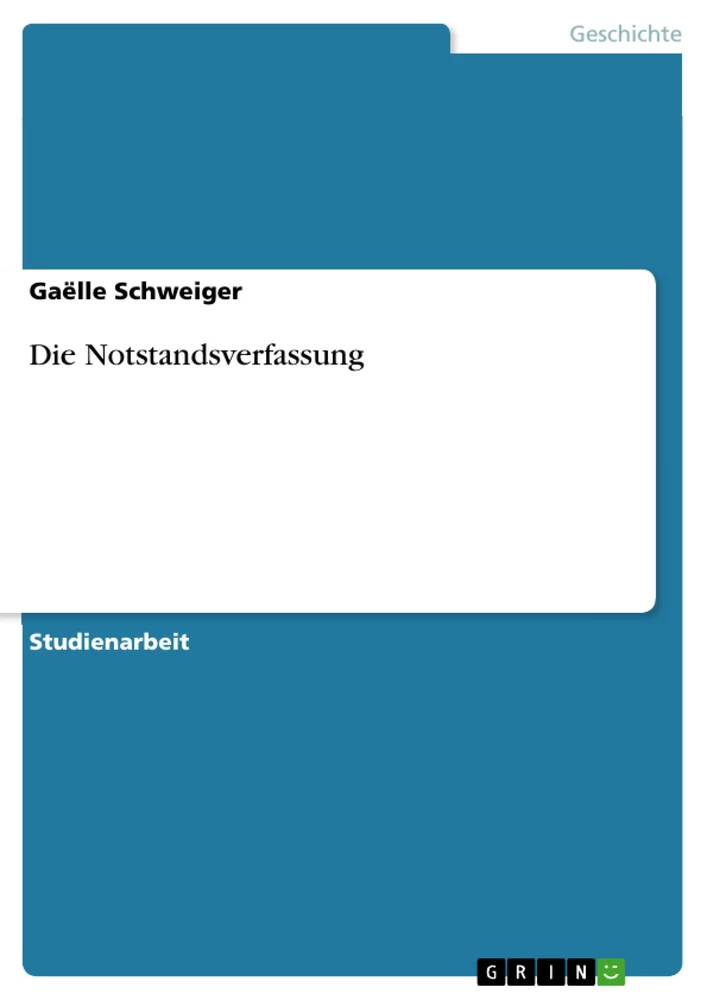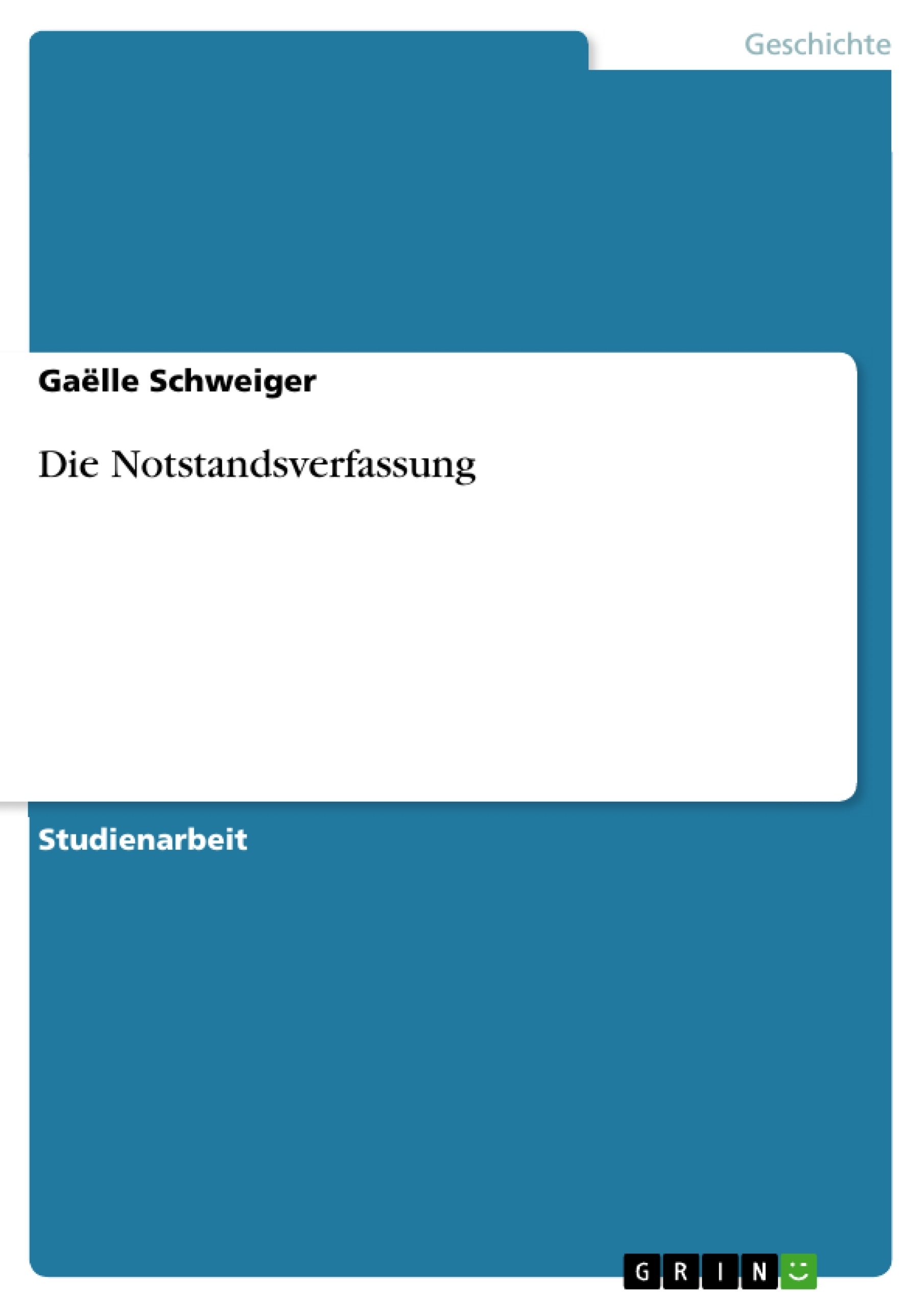Die meisten Verfassungen westlicher Demokratien enthalten eine Regelung des Ausnahmezustandes, d.h. ein vereinfachtes Funktionieren des Staates und Rechtsvorschriften zum Ergreifen außerordentlicher Maßnahmen für Krisensituationen. Der Notstand wurde sogar schon verkündet wie z.B. in Frankreich: Während sich das Bundesinnenministerium damit beschäftigte, Notstandsgesetze für das Grundgesetz auszuarbeiten und diese in der damaligen Legislaturperiode verabschieden zu lassen, wurde der Notstand am 23. April 1961 durch den Elyséepalast in Paris festgestellt. Ziemlich kurz nach dem Inkrafttreten der Verfassung der V. Republik benutzte der französische Staatspräsident Charles de Gaulle den Artikel 16, um nach dem Staatsstreich der Generäle Salan, Challe, Jouhaud und Zeller die Ordnung in Algerien wiederzuherstellen. Damals galt das Ausrufen des Notstandes als begründet. Jedoch waren die Dauer und die Einschränkungen der Befugnisse des Parlaments strittig: die (zu?) große Macht des Staatspräsidenten wurde in Frage gestellt. Der Artikel 16 wurde aber nie geändert. Im Gegensatz dazu gab es bis 1968 in Deutschland keine Notstandsverfassung. Erst am 30. Mai 1968 wurden die Notstandsgesetze in dritter Lesung mit der nach Art. 79 II GG zur Grundgesetzänderung erforderlichen Zweidrittelmehrheit von Bundestag und Bundesrat beschlossen. Sie traten am 28. Juni 1968 in Kraft. Damit endete eine lange Epoche von Verhandlungen oder genauer gesagt Auseinandersetzungen zwischen allen politischen Fraktionen der Bundesrepublik sowie von parlamentarischer und außerparlamentarischer Opposition: Die Diskussion hielt etwa zehn Jahre an. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges war die Notstandsregelung in Deutschland strittig, da der deutsche Staat zur Zeit der NS-Diktatur schlechte Erfahrungen mit dem Ausnahmezustand gemacht hatte: Die Nationalsozialisten hatten das juristische Vakuum des Artikels 48 der WRV ausgenutzt und konnten so die Grundlagen des deutschen demokratischen Systems unter scheinbarer Legalität abschaffen. Laut der Gegner der Notstandsverfassung konnte diese Grundgesetzänderung die Grundrechte der deutschen Bürger und die demokratische Ordnung der BRD nochmals in Gefahr bringen. Laut der Befürworter war sie die einzige Möglichkeit, im „Ernstfall“ die Aufrechterhaltung der Staatsgewalt und die Stabilität im Inneren zuzusichern. Sie ermöglichte auch die Ablösung des Artikels 5 Abs. 2 des Deutschlandvertrags. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Notstandsgesetze (1948-1968)
- Ausnahmerecht in der Weimarer Reichsverfassung
- Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee und Parlamentarischer Rat
- Die auf Notstandssituationen bezogenen Vorschriften des GG
- Die Übergangslösung der Alliierten
- Die „einfachen“ Notstandsgesetze
- Sicherstellungsgesetze
- Schutzgesetze
- Die Notstandsverfassung
- Verschiedene Entwürfe einer Notstandsverfassung
- Schröder-Entwurf (1960)
- Höcherl-Entwurf (1962-1963) und Benda-Entwurf (1965)
- Lücke-Entwurf (1967)
- Arten und Regelung des Notstandes
- Innerer Notstand
- Katastrophenfall
- Äußerer Notstand
- Verteidigungsfall
- Spannungsfall und Bündnisfall
- Kritik und Opposition: Außerparlamentarische Opposition
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entstehung und Funktionsweise der Notstandsverfassung in der Bundesrepublik Deutschland. Sie untersucht die historischen und politischen Hintergründe für die Einführung der Notstandsgesetze, insbesondere die Rolle der SPD und der außerparlamentarischen Opposition in den Verhandlungen. Darüber hinaus beleuchtet die Arbeit die Kritik an der Notstandsverfassung und untersucht, ob sie eine Gefahr für die deutsche Demokratie und den Schutz der Grundrechte darstellt.
- Die Entwicklung der Notstandsgesetze von 1948 bis 1968
- Die Rolle der SPD und der außerparlamentarischen Opposition bei den Verhandlungen
- Die Funktionsweise der Notstandsverfassung und ihre Auswirkungen auf die Grundrechte
- Die Kritik an der Notstandsverfassung und ihre potenziellen Gefahren für die Demokratie
- Der Vergleich des deutschen Notstandsrechts mit anderen westlichen Demokratien
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Notstandsregelung in westlichen Demokratien dar und verdeutlicht die Besonderheit der deutschen Situation nach den Erfahrungen mit dem Ausnahmezustand im Nationalsozialismus. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Entwicklung der Notstandsgesetze und die Funktionsweise der Notstandsverfassung zu analysieren.
- Die Notstandsgesetze (1948-1968): Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Entwicklungen, die zur Einführung der Notstandsgesetze führten. Es untersucht das Ausnahmerecht in der Weimarer Reichsverfassung, die Diskussionen im Verfassungskonvent und die Vorschriften des Grundgesetzes, die sich auf Notstandssituationen beziehen. Darüber hinaus werden die Übergangslösung der Alliierten und die „einfachen“ Notstandsgesetze, einschließlich der Sicherstellungs- und Schutzgesetze, erläutert.
- Die Notstandsverfassung: Dieses Kapitel widmet sich der Entstehung und dem Inhalt der Notstandsverfassung. Es analysiert die verschiedenen Entwürfe, insbesondere den Schröder-, Höcherl/Benda- und Lücke-Entwurf. Darüber hinaus werden die Arten und Regelungen des Notstandes, darunter der innere Notstand, der Katastrophenfall und der äußere Notstand (Verteidigungsfall, Spannungsfall und Bündnisfall), im Detail dargestellt.
- Kritik und Opposition: Außerparlamentarische Opposition: Dieses Kapitel beleuchtet die Kritik an der Notstandsverfassung und die Rolle der außerparlamentarischen Opposition in den Verhandlungen. Es analysiert die Argumente der Gegner und Befürworter der Notstandsverfassung und untersucht, ob die Notstandsverfassung eine wirkliche Gefahr für die deutsche Demokratie und den Respekt vor den individuellen Grundrechten darstellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen des Notstandsrechts und der Notstandsverfassung in der Bundesrepublik Deutschland. Schlüsselbegriffe sind: Ausnahmezustand, Weimarer Reichsverfassung, Grundgesetz, Notstandsgesetze, Notstandsverfassung, Sicherstellungsgesetze, Schutzgesetze, innerer Notstand, Katastrophenfall, äußerer Notstand, Verteidigungsfall, Spannungsfall, Bündnisfall, außerparlamentarische Opposition, Grundrechte, Demokratie, politische Partizipation.
- Citation du texte
- Gaëlle Schweiger (Auteur), 2005, Die Notstandsverfassung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56999