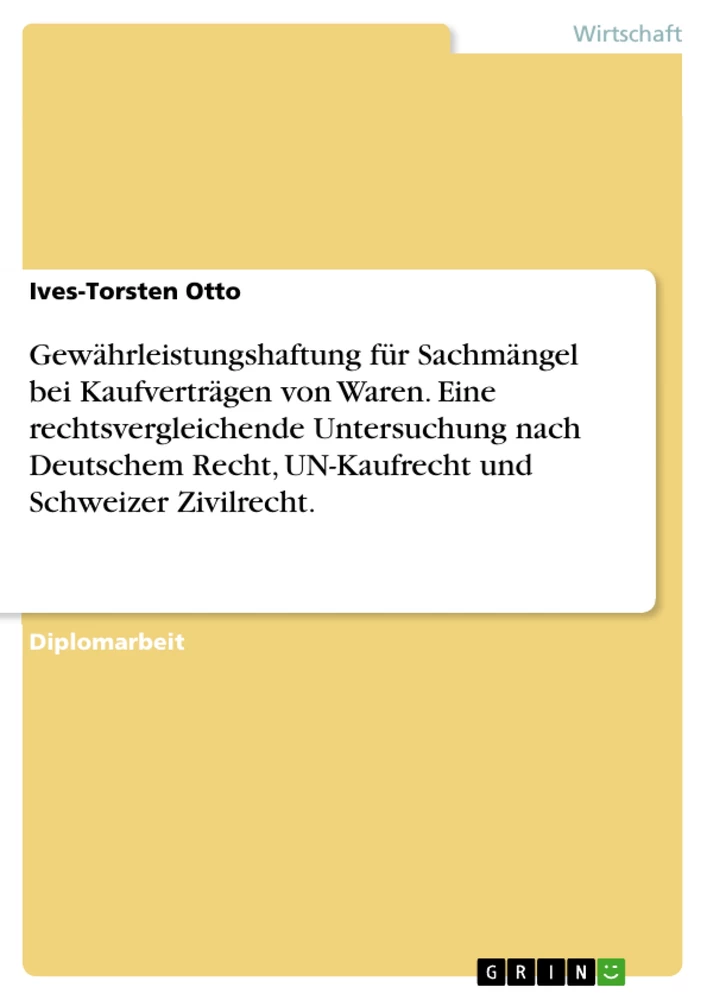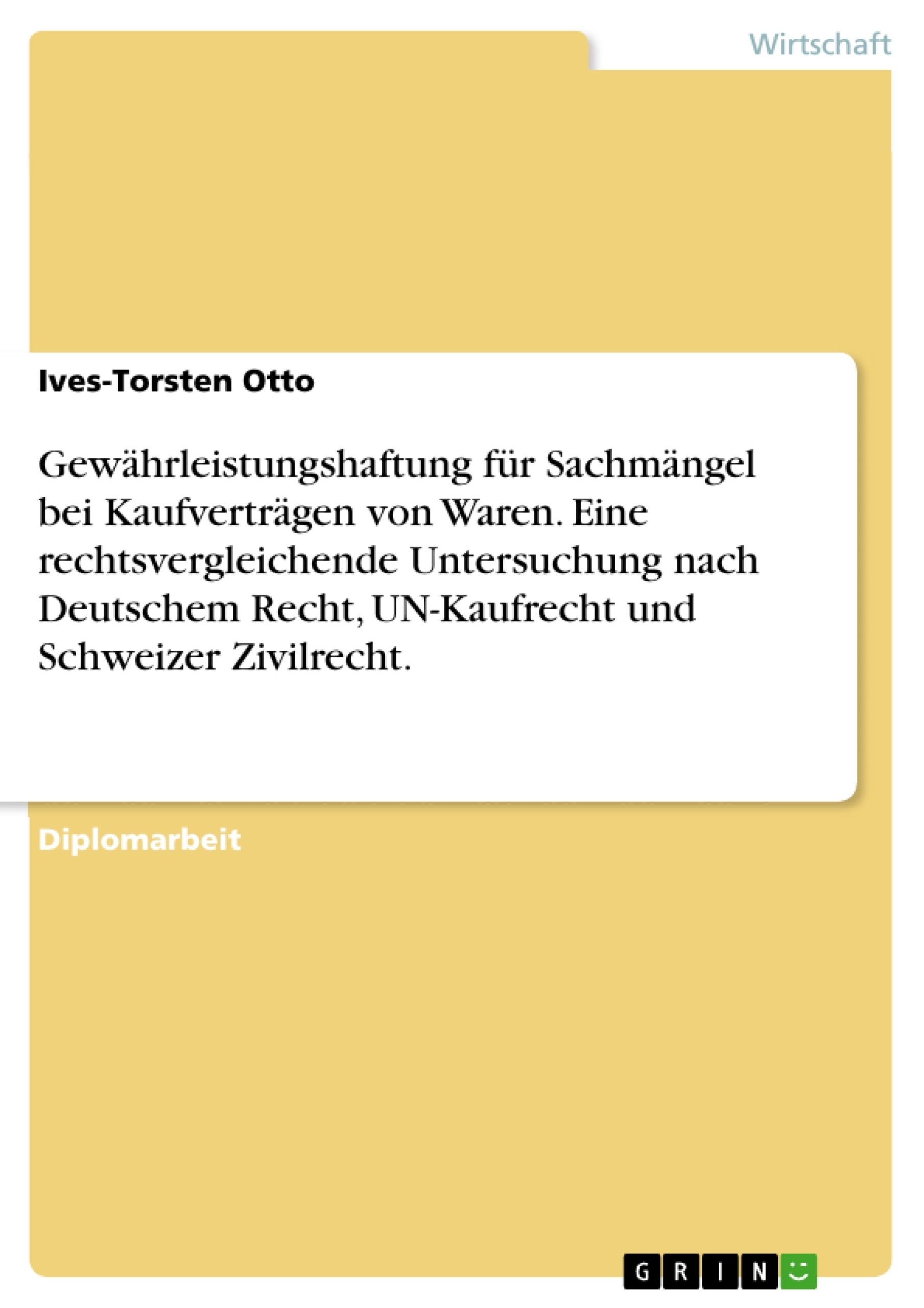Das tragende Element der Europäischen Gemeinschaft (EG) ist das Rechtsprinzip das im Zentrum der europäischen Integration steht. Die Gemeinschaft ist eine Schöpfung des Rechts. Sie beeinflusst damit nicht nur das öffentliche Recht, sondern auch zentrale Bereiche des Privatrechts der Mitgliedstaaten. Mit dem einheitlichen Europäischen Binnenmarkt, der aus den vier wirtschaftlichen Grundfreiheiten des EG-Vertrages besteht - der Freie Warenverkehr, der Freie Personenverkehr, die Dienstleistungsfreiheit sowie die Freiheit des Kapital- und Zahlungsverkehrs - erwiesen sich jedoch unterschiedliche wirtschaftliche wie rechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten als hinderlich. Internationale Wirtschaftsbeziehungen sind heutzutage eine Sache des Alltags. Daher steht der zwischenstaatliche private Warenverkehr auch im Zentrum der EG. Für beide Vertragspartner führt jedoch eine fremde Rechtsordnung mit deren wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und sprachlicher Verschiedenartigkeit zu Unsicherheiten. Eine fremde Gewährleistungshaftung, die auf den Kaufvertrag angewendet werden soll, führt allein durch die bloße Verschiedenartigkeit der Rechtsnormen, und zusätzlich bei möglichen Ansprüchen des Käufers bei mangelhaft gelieferter Kaufsache auch die Verschiedenartigkeit der Rechtsfolgen, zu erhöhten unternehmerischen Transaktionskosten, die zuweilen auch aus möglich werdenden Prozesskosten aufgrund Rechtsverfolgung entstehen können. Sie betreffen die Rechte des Käufers, ebenso die Verpflichtungen des Verkäufers. Im Ergebnis führen damit unterschiedliche nationale Regelungen beim Kaufvertrag zu Informationsproblemen der Vertragsparteien.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergrund
- Rechtsvereinheitlichung im internationalen Handel
- Anmerkung zum Deutschen Recht
- Anmerkung zum Schweizerischen Recht
- Gegenstand, Vorgehen und Ziel der Untersuchung
- Gang der Untersuchung
- A. Sachmängelhaftung im Deutschen Kaufrecht
- I. Pflichten des Verkäufers, Inhalt des Vertrages, Erfüllungsort und Gefahrübergang
- II. Pflicht zur Lieferung mangelfreier Ware
- 1. Gemeinsame Definition der Sachmängel
- a) verschiedene Sachmängel
- aa) ausdrückliche Beschaffenheitsvereinbarung
- bb) Eignung zur vertraglichen Verwendung
- cc) Eignung zur gewöhnlichen Verwendung
- dd) Öffentliche Äußerungen
- b) Montage- und Montageanleitungsmangel
- c) Falschlieferung und Zuweniglieferung
- 2. Maßgeblicher Zeitpunkt für Mangelfreiheit
- III. Rangfolge der Käuferrechtsbehelfe
- IV. Sachliche Schranken der Käuferrechtsbehelfe
- 1. Kenntnis- und Unkenntnis des Sachmangels
- 2. Der beiderseitige Handelskauf
- a) Obliegenheit des Käufers zur Untersuchung der Ware
- b) Obliegenheit des Käufers zur Rüge des Sachmangels
- c) Rechtsfolgen bei nicht ordnungsgemäßer oder unterbliebener Rüge
- d) Rechtsfolgen bei ordnungsgemäßer Rüge
- e) Regress beim Verbrauchsgüterkauf
- V. Zeitliche Schranken der Käuferrechtsbehelfe
- 1. Verjährung nach den allgemeinen Regelungen
- 2. Verjährungsmodifikation beim Regressanspruch
- VI. Die einzelnen Käuferrechtsbehelfe, die Art, Wahl und Weise
- 1. Anspruch auf Nacherfüllung in „natura“ und Voraussetzungen
- 2. Die Gestaltungsrechte, Rücktritt und Minderung
- a) Gemeinsame Voraussetzungen
- b) Das Rückgewährschuldverhältnis
- c) Kaufpreisminderung
- 3. Auf Geldausgleich gerichtete Ansprüche, Schadenersatz bzw. Aufwendungsersatz
- a) Anspruchsgrundlage und Voraussetzungen
- b) Schadenersatz statt der Leistung
- aa) Großer Schadenersatz
- bb) Kleiner Schadenersatz
- c) Schadenersatz neben der Leistung und Verzögerungsschaden
- d) Aufwendungsersatz
- 4. Zusätzliche Voraussetzungen beim Verbrauchsgüterkauf
- a) Verbraucherschutz
- aa) Keine vertragliche Haftungsbeschränkung im Voraus
- bb) Gesetzliche Vermutung zu Gunsten des Verbrauchers
- cc) Beschaffenheitsgarantie
- b) Rückgriff des Unternehmers
- VII. Der Fernabsatzvertrag
- 1. Anwendungsbereich, persönlicher und sachlicher
- 2. Verbraucherschutz durch Informationspflichten
- a) Vorvertragliche Informationspflichten des Unternehmers
- b) Rechtsfolgen bei Missachtung
- c) Nachvertragliche Informationspflichten des Unternehmers
- d) Rechtsfolgen bei Missachtung
- e) Widerrufs- und Rückgaberecht des Verbrauchers
- aa) Das Widerrufsrecht des Verbrauchers
- bb) Ausschluss des Widerrufsrechts des Verbrauchers
- cc) Das Rückgaberecht des Verbrauchers
- dd) Rechtsfolgen des Widerrufs
- ee) Rechtsfolgen bei Rückgaberecht
- ff) Keine Vertragliche Haftungsbeschränkung im Voraus
- B. Sachmängelhaftung im UN-Kaufrecht (CISG)
- I. Das UN-Kaufrecht, Gegenstand und Inhalt
- II. Pflichten des Verkäufers, Inhalt des Vertrages, Erfüllungsort und Gefahrübergang
- III. Pflicht zur Lieferung mangelfreier Ware
- 1. Definition des Sachmangels
- 2. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Mangelfreiheit
- IV. Das System der Käuferrechtsbehelfe, Merkmale und Voraussetzungen
- 1. Übersicht der Käuferrechtsbehelfe
- 2. Differenzierung der Rechtsbehelfe nach Verfügbarkeit und Anknüpfungspunkte
- a) Einheitlicher Tatbestand der Vertragsverletzung
- b) Ausnahmen in der Verfügbarkeit der Rechtsbehelfe
- c) Differenzierung nach dem „Gewicht“ der Vertragsverletzung
- Analyse der Pflichten des Verkäufers im Hinblick auf die Lieferung mangelfreier Ware
- Untersuchung der verschiedenen Sachmängeldefinitionen und ihrer Anwendung in den jeweiligen Rechtsordnungen
- Vergleich der Käuferrechtsbehelfe und ihrer Voraussetzungen in den drei Rechtssystemen
- Bewertung des Verbraucherschutzes im Kontext der Sachmängelhaftung
- Bedeutung des Fernabsatzrechts und seiner Auswirkungen auf die Sachmängelhaftung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Gewährleistungshaftung für Sachmängel bei Kaufverträgen von Waren. Sie verfolgt das Ziel, die rechtlichen Rahmenbedingungen der Sachmängelhaftung im internationalen Handelsrecht zu beleuchten und dabei die Rechtsordnungen Deutschlands, der Schweiz und des UN-Kaufrechts zu vergleichen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Sachmängelhaftung bei Kaufverträgen von Waren ein und erläutert die Relevanz der rechtsvergleichenden Untersuchung. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die zu behandelnden Themenbereiche.
Kapitel A behandelt die Sachmängelhaftung im Deutschen Kaufrecht. Es werden die Pflichten des Verkäufers, die Definition von Sachmängeln, die maßgeblichen Zeitpunkte für Mangelfreiheit und die Käuferrechte im Falle eines Mangels beleuchtet. Dabei werden die verschiedenen Käuferrechtsbehelfe, wie Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadenersatz, detailliert erläutert und ihre Voraussetzungen sowie rechtlichen Grenzen dargestellt.
Kapitel B widmet sich der Sachmängelhaftung im UN-Kaufrecht (CISG). Es werden die grundlegenden Regeln des UN-Kaufrechts, die Pflichten des Verkäufers und die Definition des Sachmangels dargestellt. Anschließend wird das System der Käuferrechtsbehelfe im UN-Kaufrecht vorgestellt und die Differenzierung der Rechtsbehelfe nach Verfügbarkeit und Anknüpfungspunkte erläutert.
Schlüsselwörter
Sachmängelhaftung, Kaufvertrag, Waren, Gewährleistung, Deutsches Recht, Schweizer Zivilrecht, UN-Kaufrecht (CISG), Rechtsvergleichung, Käuferrechte, Verkäuferpflichten, Sachmängeldefinition, Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung, Schadenersatz, Verbraucherschutz, Fernabsatzvertrag.
- Quote paper
- Ives-Torsten Otto (Author), 2006, Gewährleistungshaftung für Sachmängel bei Kaufverträgen von Waren. Eine rechtsvergleichende Untersuchung nach Deutschem Recht, UN-Kaufrecht und Schweizer Zivilrecht. , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56936