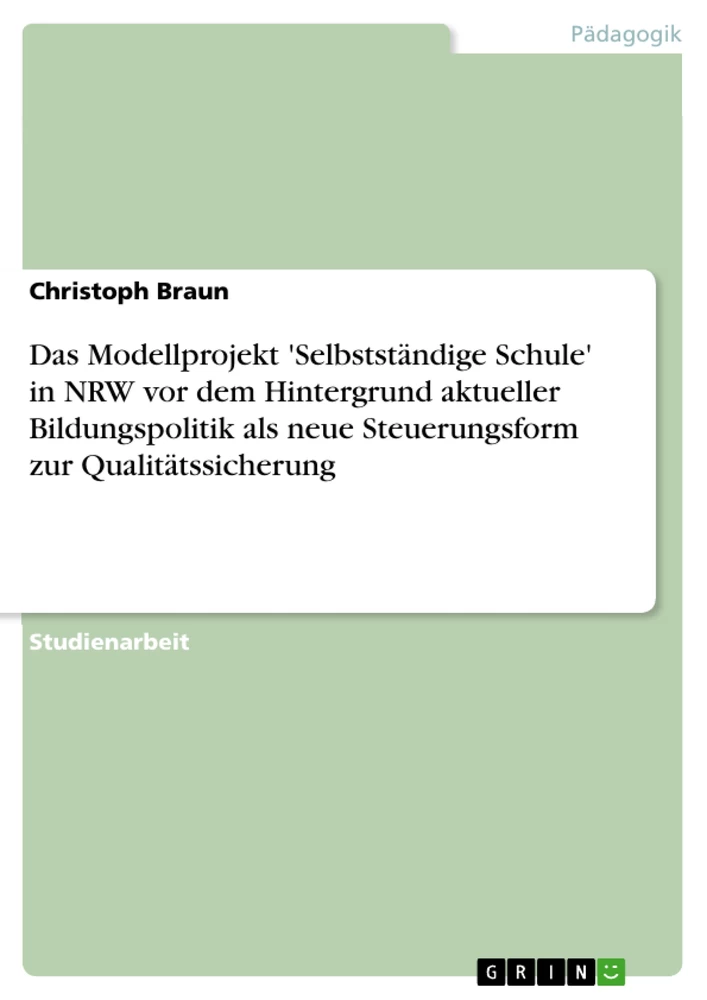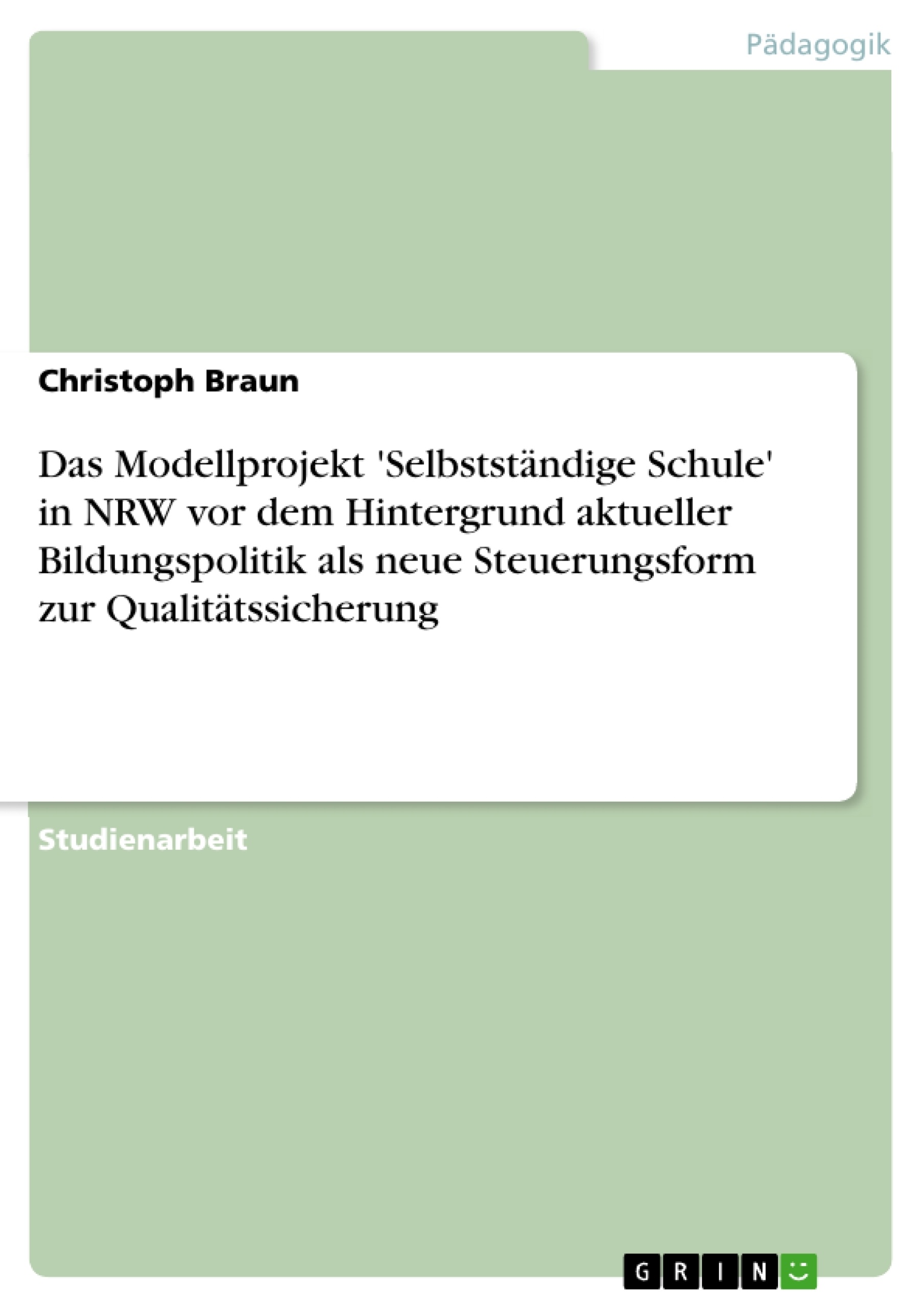Die größere Selbstständigkeit von Schulen ist seit den 1970er Jahren Thema der Schulentwicklungsforschung und Bildungspolitik. Zuständig für die Ausgestaltung des Bildungssystems sind in der Bundesrepublik Deutschland die Bundesländer, die in der Kultusministerkonferenz miteeinander kooperieren. Die Länder haben zur Steuerung des Schulsystems unterschiedliche Instrumente zur Hand, die sich danach klassifizieren lassen, auf welchen Bereich von steuernden Wirkungen sie sich beziehen. Steuerung kann einmal den Kontext von Schule betreffen, also die Frage des Inputs von Ressourcen klären, welche die materielle und personelle Ausstattung betreffen. Steuerung kann aber auch auf die schulische Arbeit abzielen, also den Unterricht selbst mit seinen Formen und Inhalten regeln. Die dritte Möglichkeit ist, durch Maßnahmen direkt auf die Wirkung der Schule abzuzielen, also die Zertifizierung zu standardisieren. Schulische Steuerung ist also entweder kontextorientiert (Inputsteuerung), prozessorientiert (Prozessteuerung) oder wirkungsorientiert (Outputsteuerung). Das bisherige bürokratisch und zentralistisch strukturierte Verwatungssystem ist überholt, neue Steuerungsmodelle, die in öffentlichen Verwaltungen entwickelt worden sind, sollen dessen Nachteile überwinden. Hier ist vor allem die Zusammenführung von Fach- und Ressourcenmanagement zu nennen, denn bisher ist es so, dass Schulen das interne Ressourcenmanagement zwar in Eigenregie übernehmen, ihr Spielraum dabei jedoch ziemlich gering ist. Die alte Steuerung im Bildungswesen ist durch Inputsteuerung geprägt, neue Steuerung hingegen setzt auf dezentrale Ressourcenverantwortung. Um ein Modell dieser neuen Steuerung soll es in dieser Hausarbeit gehen: Das Projekt „Selbstständige Schule“ in Nordrhein-Westfalen ist das momentan bundesweit größte Reformprojekt, dass sich mit regionaler Schulentwicklung beschäftigt. Unter Punkt 2 wird dieses Modellprojekt ausführlich dargestellt und Unterschiede zur bisherigen Steuerung im Bildungswesen werden herausgearbeitet. Im Fazit unter Punkt 3 werden diese noch mal zusammengefasst und das Projekt „Selbstständige Schule“ auf dieser Grundlage bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- Alte und neue Steuerung im Bildungswesen – eine Einleitung
- Das Modellprojekt „Selbstständige Schule“ in NRW
- Grundlagen und Konzeptentwicklung
- Ziel des Gesamtprojekts
- Steuerungsstrukturen im Projekt
- Die Bedeutung von Fortbildung im Projekt
- Chancen und Risiken selbstständiger Schulen
- Fazit - Beurteilung des Projekts vor bildungspolitischem Hintergrund
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Modellprojekt „Selbstständige Schule“ in Nordrhein-Westfalen vor dem Hintergrund aktueller Bildungspolitik. Ziel ist es, die neue Steuerungsform zur Qualitätssicherung zu analysieren und deren Chancen und Risiken zu bewerten. Die Arbeit vergleicht das Projekt mit bisherigen, zentralistisch geprägten Steuerungsmodellen im Bildungswesen.
- Entwicklung neuer Steuerungsmodelle im Bildungswesen
- Dezentrale Ressourcenverantwortung und Selbststeuerung von Schulen
- Das Modellprojekt „Selbstständige Schule“ in NRW: Konzept und Umsetzung
- Zusammenarbeit zwischen Schulen, Schulträgern und Schulaufsicht
- Bewertung des Projekts im Hinblick auf Qualitätssicherung und Bildungsziele
Zusammenfassung der Kapitel
1. Alte und neue Steuerung im Bildungswesen – eine Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Schulsteuerung ein und differenziert zwischen alten, zentralistischen und neuen, dezentralen Modellen. Es beschreibt verschiedene Steuerungsebenen (Input, Prozess, Output) und argumentiert, dass das bisherige, bürokratisch strukturierte System überholt ist. Die Einführung neuer Steuerungsmodelle, die auf dezentrale Ressourcenverantwortung setzen, wird als notwendig dargestellt. Das Modellprojekt „Selbstständige Schule“ in Nordrhein-Westfalen wird als Beispiel für eine solche neue Steuerungsform vorgestellt.
2. Das Modellprojekt „Selbstständige Schule in NRW“: Dieses Kapitel beschreibt ausführlich das Modellprojekt „Selbstständige Schule“ in Nordrhein-Westfalen. Es beleuchtet die Grundlagen und die Konzeptentwicklung des Projekts, das in Zusammenarbeit zwischen der Bertelsmann Stiftung und dem Schulministerium entstanden ist. Das Kapitel erläutert das übergeordnete Ziel der Verbesserung der Qualität schulischer Arbeit, insbesondere des Unterrichts, durch qualitätsorientierte Selbststeuerung an Schulen und die Entwicklung regionaler Bildungslandschaften. Es wird die Beteiligung zahlreicher Schulen verschiedener Schulformen in ganz Nordrhein-Westfalen hervorgehoben und der erweiterte Handlungsspielraum der Schulen durch gesetzliche Öffnungsklauseln beschrieben. Die Bedeutung der Zusammenarbeit von Lehrkräften zur Förderung der Lernkompetenz der Schülerinnen und Schüler wird betont.
Schlüsselwörter
Selbstständige Schule, Schulsteuerung, Bildungspolitik, Nordrhein-Westfalen, Dezentrale Ressourcenverantwortung, Qualitätsentwicklung, Schulqualität, regionale Bildungslandschaften, Selbststeuerung, Inputsteuerung, Prozessteuerung, Outputsteuerung.
Modellprojekt „Selbstständige Schule“ in NRW: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Modellprojekt „Selbstständige Schule“ in Nordrhein-Westfalen. Sie untersucht die neue Steuerungsform im Bildungswesen, vergleicht sie mit traditionellen, zentralisierten Modellen und bewertet deren Chancen und Risiken im Hinblick auf die Qualitätssicherung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung neuer Steuerungsmodelle im Bildungswesen, die dezentrale Ressourcenverantwortung und Selbststeuerung von Schulen, das Konzept und die Umsetzung des Modellprojekts „Selbstständige Schule“, die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Schulträgern und Schulaufsicht sowie die Bewertung des Projekts hinsichtlich Qualitätssicherung und Bildungsziele.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: „Alte und neue Steuerung im Bildungswesen – eine Einleitung“, „Das Modellprojekt „Selbstständige Schule“ in NRW“ und „Fazit - Beurteilung des Projekts vor bildungspolitischem Hintergrund“.
Was ist das Ziel des Modellprojekts „Selbstständige Schule“?
Das übergeordnete Ziel des Projekts ist die Verbesserung der Qualität schulischer Arbeit, insbesondere des Unterrichts, durch qualitätsorientierte Selbststeuerung an Schulen und die Entwicklung regionaler Bildungslandschaften.
Wie funktioniert die neue Steuerungsform im Modellprojekt?
Das Projekt setzt auf dezentrale Ressourcenverantwortung und Selbststeuerung der Schulen. Schulen erhalten einen erweiterten Handlungsspielraum durch gesetzliche Öffnungsklauseln und die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften wird zur Förderung der Lernkompetenz der Schülerinnen und Schüler betont.
Wer ist an dem Projekt beteiligt?
Das Projekt entstand in Zusammenarbeit zwischen der Bertelsmann Stiftung und dem Schulministerium von Nordrhein-Westfalen. Zahlreiche Schulen verschiedener Schulformen in ganz Nordrhein-Westfalen beteiligen sich.
Welche Steuerungsebenen werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Steuerungsebenen: Inputsteuerung, Prozessteuerung und Outputsteuerung. Es wird argumentiert, dass das bisherige, bürokratisch strukturierte System überholt ist und neue, dezentrale Modelle notwendig sind.
Welche Chancen und Risiken werden im Zusammenhang mit dem Projekt genannt?
Die Arbeit analysiert sowohl die Chancen (z.B. erhöhte Qualität durch Selbststeuerung, regionale Bildungslandschaften) als auch die Risiken (z.B. ungleiche Verteilung von Ressourcen, Schwierigkeiten bei der Qualitätssicherung) des Modellprojekts.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Selbstständige Schule, Schulsteuerung, Bildungspolitik, Nordrhein-Westfalen, Dezentrale Ressourcenverantwortung, Qualitätsentwicklung, Schulqualität, regionale Bildungslandschaften, Selbststeuerung, Inputsteuerung, Prozessteuerung, Outputsteuerung.
- Quote paper
- Christoph Braun (Author), 2005, Das Modellprojekt 'Selbstständige Schule' in NRW vor dem Hintergrund aktueller Bildungspolitik als neue Steuerungsform zur Qualitätssicherung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56899