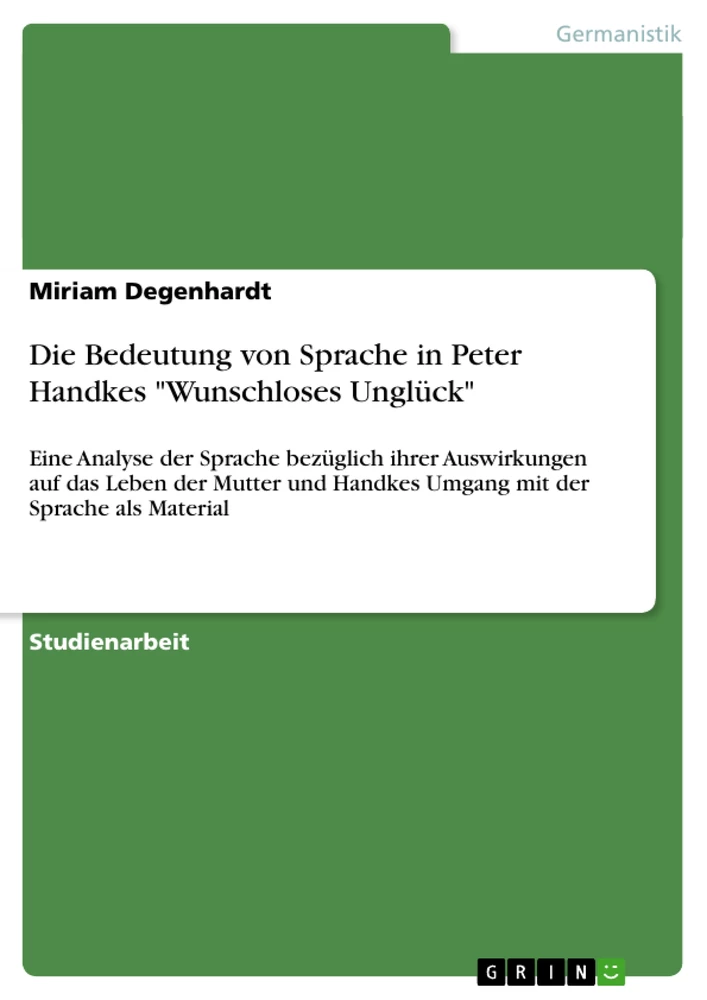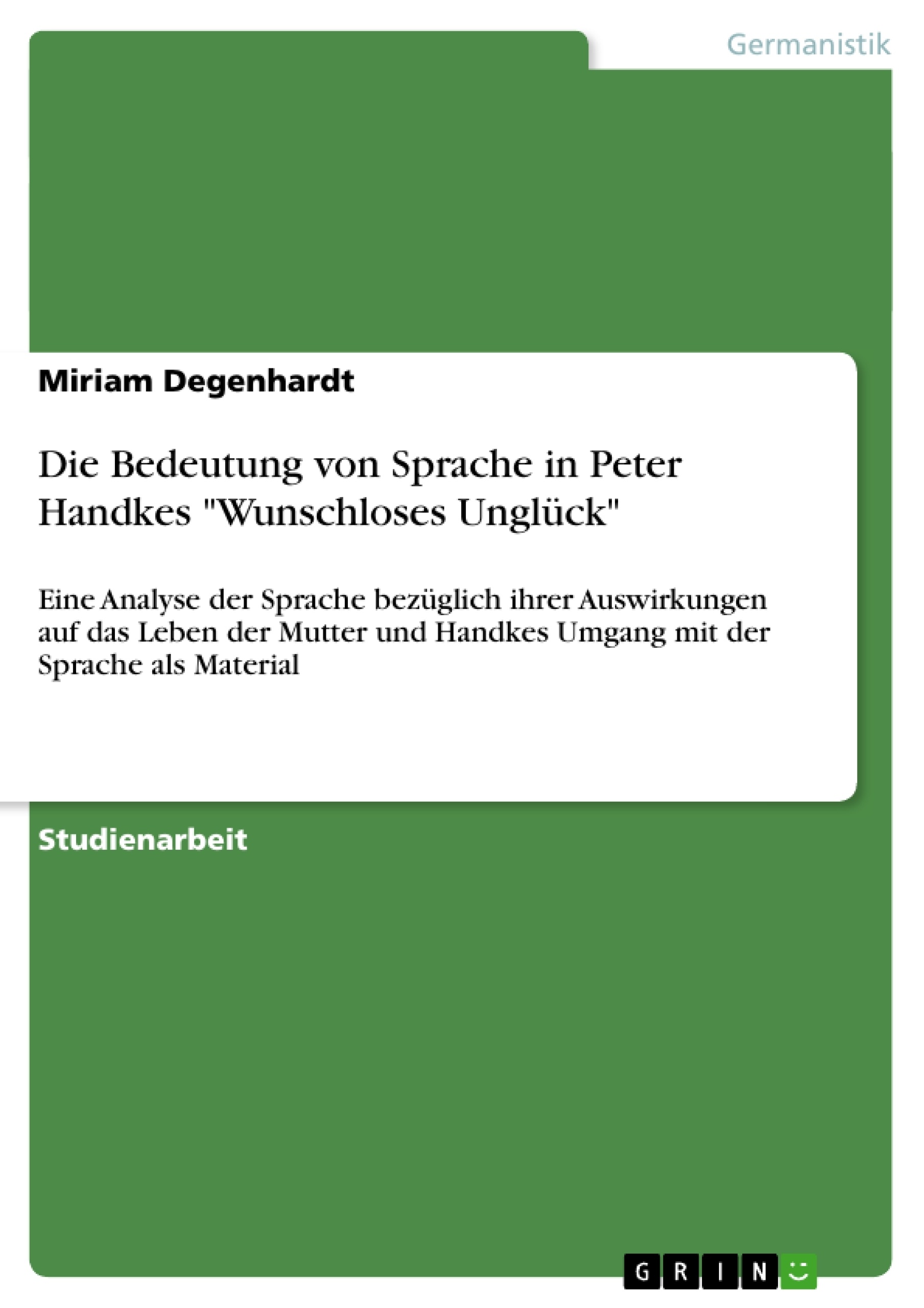Die Erzählung „Wunschloses Unglück“1 von Peter Handke, die Thema dieser Arbeit sein soll, erschien im Jahr 1972. Zeitlich ist dieses Werk somit einzuordnen in die Bewegung der „Neuen Subjektivität“ und „Neuen Innerlichkeit“.2 Diese literarische Richtung lässt sich in zwei unterschiedliche Phasen einteilen. In der ersten Phase ging es den Autoren wie zum Beispiel Martin Walser darum, politisch engagierte Texte zu publizieren. Bei Peter Handke wie auch bei anderen Autoren (Botho Strauss, Thomas Bernhard) hingegen ging es nicht um eine direkte politische Beeinflussung der Leserschaft. Ihre Werke erscheinen auf den ersten Blick nicht als politisch. Die Besonderheit liegt statt dessen darin, anhand einer einzelnen Person auf die sozialen Lebensumstände, in denen die Menschen leben und unter denen sie oftmals leiden, hinzuweisen. Aus diesem Grund kann man Handkes Erzählung „Wunschloses Unglück“ unter die Begriffe der „Neuen Subjektivität“ und „Neuen Innerlichkeit“ einordnen, muss aber dabei beachten, dass hier der Autor den Weg wählt, über das Leben einer einzelnen Person auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen.
Der folgenden Arbeit liegt eine Dreiteilung zugrunde. In dem ersten Teil soll die Frage bearbeitet werden, aus welcher Motivation heraus Peter Handke das Buch verfasst hat. Dabei soll sowohl auf die vom Erzähler genannten Gründe eingegangen werden, als auch auf möglicherweise nicht auf den ersten Blick erkennbare Motive. In diesem ersten Kapitel soll versucht werden darzustellen, dass der Erzähler die Geschichte der Mutter nutzt, um über sich selbst zu schreiben. In einem zweiten Schritt soll durch eine Analyse verschiedener Textstellen gezeigt werden, wie sich aus der vordergründigen Geschichte der Mutter eine Geschichte über den Erzähler entwickelt. Aufgezeigt werden soll, wie sich das Leben der Mutter gestaltet hat und aus welchen Gründen sie sich zu dem Menschen entwickelt hat, der von dem Erzähler beschrieben wird. Hierbei sollen auch die gesellschaftlichen und sozialen Verhältnisse näher betrachtet werden. Ferner soll in diesem Abschnitt der Arbeit die Beziehung zwischen Mutter und Sohn beleuchtet werden, um herauszustellen, inwiefern die Erzählung über die Mutter auch immer ein Erinnern an die Vergangenheit des Erzählers darstellt. In einem letzten Kapitel soll schließlich noch die von Handke verwendete Sprache näher betrachtet werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Schreibmotivation und der Weg zur eigenen Geschichte
- Der Weg von der Geschichte der Mutter zum Ich des Erzählers und die Einflüsse der Gesellschaft auf die Entwicklung der Mutter und deren Beziehung zu ihrem Sohn
- Von der Geschichte der Mutter zur Geschichte über den Erzähler
- Die Bedeutung der gesellschaftlichen Einflüsse auf die „Entwicklung“ der Mutter und ihrer „Sprachlosigkeit“
- Die Bedeutung der Gesellschaft und die Rolle der Frau innerhalb dieser Gesellschaft
- Die Bedeutung von Sprache für das Leben der Mutter
- Die Mutter-Sohn-Beziehung und die Bedeutung von Körperlichkeit
- Peter Handke und die Sprache
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Peter Handkes „Wunschloses Unglück“ und beleuchtet die Rolle von Sprache in der Erzählung. Der Fokus liegt dabei auf den Auswirkungen der Sprache auf das Leben der Mutter und Handkes Umgang mit der Sprache als Material. Die Arbeit zielt darauf ab, die Schreibmotivation Handkes aufzudecken und zu verstehen, wie er die Geschichte der Mutter nutzt, um über sich selbst zu schreiben. Dabei wird auch die Bedeutung der gesellschaftlichen Einflüsse und die Mutter-Sohn-Beziehung beleuchtet.
- Die Schreibmotivation Handkes und die Nutzung der Muttergeschichte als Selbstreflexion
- Die Darstellung der Mutter als Opfer gesellschaftlicher Normen und ihrer "Sprachlosigkeit"
- Die Bedeutung der Sprache als Werkzeug für Selbstentfaltung und Bewusstseinsbildung
- Die Rolle der Körperlichkeit in der Mutter-Sohn-Beziehung
- Die Kritik an der gesellschaftlichen Wahrnehmung und Darstellung von Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Werk „Wunschloses Unglück“ im Kontext der „Neuen Subjektivität“ und „Neuen Innerlichkeit“ vor. Sie erläutert, dass Handke durch das Leben einer einzelnen Person auf gesellschaftliche Missstände hinweist. Die Arbeit verfolgt die Absicht, die von Handke durch den bewussten Sprachgebrauch ausgeübte Gesellschaftskritik aufzuzeigen und gleichzeitig die Grenzen der Möglichkeiten der Sprache zu beleuchten.
Das zweite Kapitel untersucht die Schreibmotivation des Autors. Es wird analysiert, ob Handke die Geschichte einer Frau oder darüber hinausgehende Motive im Blick hat. Es zeigt sich, dass der Erzähler die Geschichte der Mutter als Mittel zur Selbstreflexion nutzt.
Das dritte Kapitel beleuchtet den Weg von der Geschichte der Mutter zum Ich des Erzählers. Es wird analysiert, wie sich das Leben der Mutter gestaltet hat und warum sie zu dem Menschen geworden ist, der von dem Erzähler beschrieben wird. Hierbei werden auch gesellschaftliche und soziale Verhältnisse sowie die Beziehung zwischen Mutter und Sohn betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Analyse von Peter Handkes „Wunschloses Unglück“ fokussiert auf die Rolle der Sprache in der Erzählung. Schlüsselwörter sind die „Neue Subjektivität“, „Neue Innerlichkeit“, Gesellschaftskritik, Sprachlosigkeit, Mutter-Sohn-Beziehung und die Bedeutung der Sprache als Material.
- Citation du texte
- Miriam Degenhardt (Auteur), 2005, Die Bedeutung von Sprache in Peter Handkes "Wunschloses Unglück" , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56743