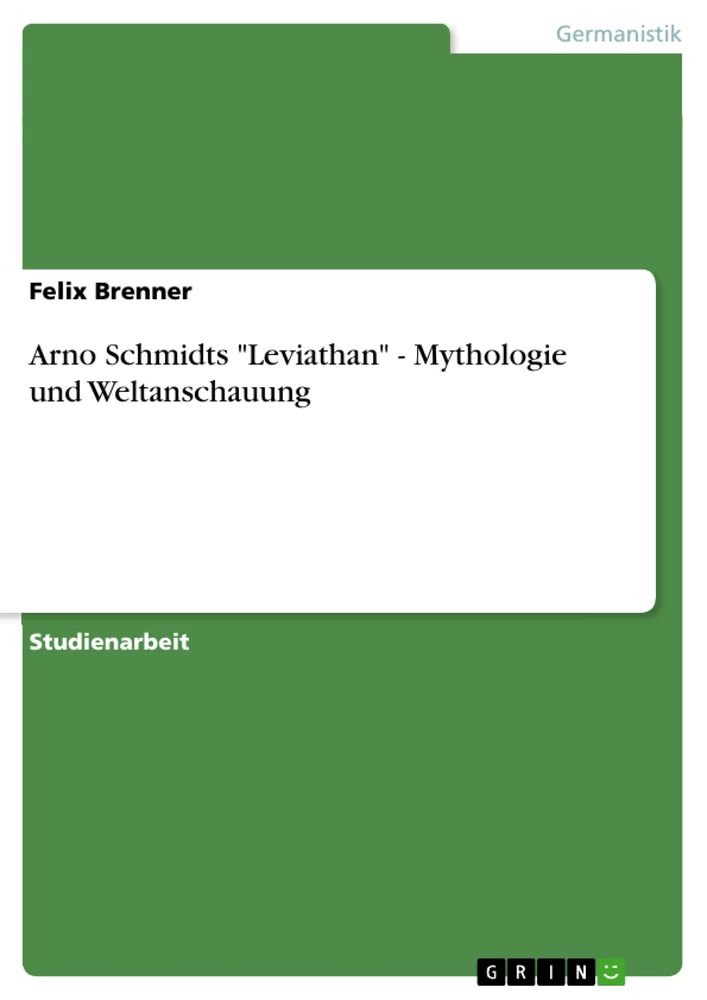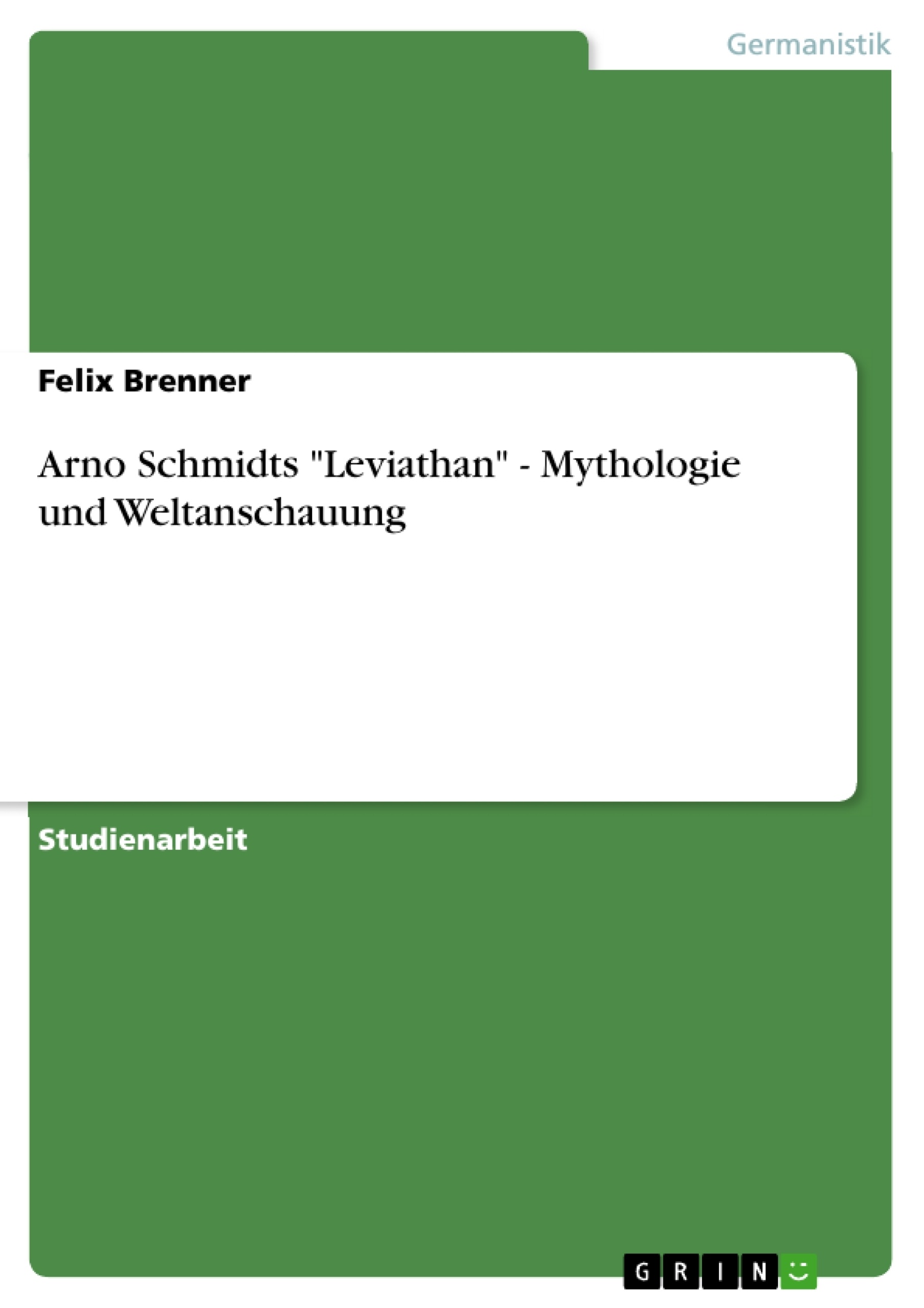Der Begriff „Leviathan“ trägt mehrere Bedeutungen, auf die in dieser Arbeit in der notwendigen Ausführlichkeit eingegangen werden soll. Die Betrachtung reicht vom ersten Auftreten des Wortes über seine religiöse Bedeutung bis zu der nach ihm benannten politischen Theorie. Der Leviathan hat seine Ursprünge in der altorientalischen Mythologie. Im Alten Testament fügen sich Leviathan und Drache, Satan und Antichrist zu einer polaren Gegenkraft Gottes. Im monotheistischen Glauben kann es aber keine autonome Position neben Gott geben. Deshalb muss er dessen Geschöpf, also gezielt in den Schöpfungsplan eingesetzt sein. Der Leviathan ist daher auch als dunkle Seite Gottes verstanden worden. Wesentlich wurde der Begriff des Leviathans auch durch Hobbes` Staatsphilosophie geprägt, laut welcher der Absolutismus die einzige Staatsform sei, in der die Menschen in Frieden leben könnten. Arno Schmidt stimmt mit Hobbes in der pessimistischen Weltsicht, der Mensch sei von Natur aus böse und befinde sich in einem natürlichen Kampf mit seinen Mitmenschen, überein. Daraus folgert er jedoch keine politische Notwendigkeit, denn aufgrund des Machtmissbrauchs der Nationalsozialisten ist Schmidt gegen eine Staatsgewalt, die Mittel zur Unterdrückung innehat. Allerdings plädiert er damit nicht für die Demokratie oder eine andere Staatsform, sondern lehnt den Staat allgemein ab. Andererseits kann der nationalsozialistische Staat als Verkörperung des Leviathan gesehen werden. Unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges und dem Untergang des Dritten Reiches wäre es nahe liegend, dass Schmidt den Leviathan als Gleichnis auf den nationalsozialistischen Staat gesehen hat.
Der Autor hat seinem ihm eigenen Weltbild den Namen Leviathan gegeben. Da dies grundlegend für sein Gesamtwerk ist, bedarf es einer ausführlichen Besprechung und nimmt dieser Punkt den größten Raum in der vorliegenden Arbeit ein: Das Universum werde sich nach seiner Erschaffung mitsamt allem in sich befindlichen auch wieder zerstören. Die Eingebundenheit der Menschen in dieses Prinzip determiniere ihren Charakter. Eigenständige Aktivität sei ihnen daher nicht möglich. Vielmehr trügen die Menschen im Rahmen ihrer Möglichkeiten dazu bei, die Kontraktion des Universums zu beschleunigen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Der Kontrast zwischen der „besten der Welten“ und dem Leviathan
- B. Arno Schmidts Leviathan- Mythos und Weltanschauung
- 1. Der Leviathan in der Mythologie
- 1.1 Die Herkunft des Leviathans
- 1.2 Der Leviathan im Alten Testament
- 1.3 Zusammenhang zwischen dem biblischen Leviathan und Schmidts Erzählung
- 2. Der politische Leviathan
- 2.1 Erklärung der Hobbesschen Theorie
- 2.2 Parallelen zwischen den Leviathanstheorien von Hobbes und Schmidt
- 3. Schmidts leviathanisches Weltbild
- 3.1 Die Ambivalenz der Schmidtschen Leviathanstheorie
- 3.2 Das Einwirken Schopenhauers
- 3.3 Schmidts Leviathanstheorie
- 3.4 Der Kontrast zwischen Schmidts Atheismus und dem göttlichen Leviathan
- 3.5 Schmidts Leviathan- Ein moderner Mythos
- 1. Der Leviathan in der Mythologie
- C. Der Leviathan als immer wiederkehrendes Motiv in der Weltliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Arno Schmidts Erzählung „Leviathan oder die beste der Welten“ und analysiert die Verwendung des Leviathan-Mythos als Metapher für Schmidts Weltanschauung. Der Fokus liegt auf der Interpretation des Leviathan im Kontext biblischer und philosophischer Traditionen, insbesondere im Vergleich zu Thomas Hobbes' politischer Theorie. Die Arbeit beleuchtet die ambivalente Natur von Schmidts Leviathan-Konzept und seine Verbindung zu pessimistischen philosophischen Strömungen.
- Der Kontrast zwischen Leibniz' optimistischer "besten aller Welten" und Schmidts pessimistischem Leviathan-Bild.
- Die verschiedenen Bedeutungen des Leviathan in Mythologie, Religion und Politik.
- Die Interpretation des Leviathan in Arno Schmidts Erzählung und dessen Funktion als Metapher.
- Der Einfluss philosophischer Strömungen (z.B. Schopenhauer) auf Schmidts Weltanschauung.
- Die Einordnung von Schmidts Leviathan-Konzept in die literarische Tradition.
Zusammenfassung der Kapitel
A. Der Kontrast zwischen der „besten der Welten“ und dem Leviathan: Dieser einführende Abschnitt etabliert den zentralen Gegensatz zwischen Gottfried Wilhelm Leibniz' optimistischer Vorstellung von der "besten aller Welten" und Arno Schmidts pessimistischer Gegenüberstellung des Leviathan. Er betont die Notwendigkeit, den Titel und die darin enthaltenen komplexen Begriffe zu verstehen, um den Text adäquat zu interpretieren. Der Abschnitt dient als Brücke zum Verständnis der weiteren Analyse, indem er die zentralen Konfliktlinien des Werkes bereits im Vorfeld einführt und die Leserschaft auf die bevorstehende Auseinandersetzung mit den vielschichtigen Bedeutungen des Leviathan vorbereitet. Die Schwierigkeit des Textes und die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit komplexen Begriffen werden hervorgehoben.
B. Arno Schmidts Leviathan- Mythos und Weltanschauung: Dieser Abschnitt bildet den Kern der Arbeit. Er untersucht den Leviathan in seinen verschiedenen Ausprägungen: als mythologisches Mischwesen, als religiöses Symbol im Alten Testament und als politisches Konzept bei Hobbes. Es wird detailliert die Verbindung zwischen diesen verschiedenen Interpretationen und Schmidts eigener Auffassung des Leviathan hergestellt. Der Abschnitt analysiert die Ambivalenz in Schmidts Darstellung, den Einfluss von Schopenhauer und den Kontrast zwischen Schmidts Atheismus und der traditionellen Vorstellung vom göttlichen Leviathan. Schmidts Interpretation des Leviathan als moderner Mythos wird eingehend diskutiert, um die komplexen theologischen und philosophischen Hintergründe des Werkes zu verdeutlichen und Schmidts einzigartige literarische Strategie zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Arno Schmidt, Leviathan, Mythos, Weltanschauung, Thomas Hobbes, Gottfried Wilhelm Leibniz, pessimismus, Religion, Politik, Altes Testament, Schopenhauer, Moderne, Ambivalenz, Metapher.
Häufig gestellte Fragen zu Arno Schmidts "Leviathan oder die beste der Welten"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Arno Schmidts Erzählung "Leviathan oder die beste der Welten" und untersucht den darin verwendeten Leviathan-Mythos als Metapher für Schmidts Weltanschauung. Sie vergleicht Schmidts Interpretation des Leviathan mit biblischen, philosophischen (insbesondere Hobbes) und literarischen Traditionen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den Kontrast zwischen Leibniz' optimistischer "besten aller Welten" und Schmidts pessimistischer Sichtweise. Sie untersucht verschiedene Bedeutungen des Leviathan in Mythologie, Religion und Politik, interpretiert den Leviathan in Schmidts Erzählung, analysiert den Einfluss philosophischer Strömungen (wie Schopenhauer) auf Schmidts Weltanschauung und ordnet Schmidts Leviathan-Konzept in die literarische Tradition ein. Die Ambivalenz und die theologischen und philosophischen Hintergründe von Schmidts Leviathan-Konzept werden eingehend diskutiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: A. Der Kontrast zwischen der „besten der Welten“ und dem Leviathan (Einleitung); B. Arno Schmidts Leviathan-Mythos und Weltanschauung (Hauptteil, der den Leviathan in mythologischen, religiösen und politischen Kontexten untersucht und Schmidts Interpretation analysiert); C. Der Leviathan als immer wiederkehrendes Motiv in der Weltliteratur (Einordnung in einen breiteren literarischen Kontext).
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Arno Schmidt, Leviathan, Mythos, Weltanschauung, Thomas Hobbes, Gottfried Wilhelm Leibniz, Pessimismus, Religion, Politik, Altes Testament, Schopenhauer, Moderne, Ambivalenz, Metapher.
Welche Rolle spielt der Leviathan in Schmidts Erzählung?
Der Leviathan dient in Schmidts Erzählung als zentrale Metapher für Schmidts pessimistische Weltanschauung. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Ebenen der Bedeutung des Leviathan – als mythologisches Wesen, religiöses Symbol und politisches Konzept – um Schmidts individuelle Interpretation zu verstehen.
Wie wird der Leviathan in Bezug auf andere Denker betrachtet?
Die Arbeit vergleicht Schmidts Leviathan-Konzept mit der politischen Theorie von Thomas Hobbes und dem optimistischen Weltbild von Gottfried Wilhelm Leibniz. Der Einfluss von Schopenhauer auf Schmidts pessimistische Sichtweise wird ebenfalls analysiert.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt die Komplexität von Schmidts Leviathan-Konzept und dessen Einbettung in verschiedene philosophische und literarische Traditionen. Sie verdeutlicht die ambivalente Natur von Schmidts Darstellung und deren einzigartige literarische Strategie.
- Quote paper
- Felix Brenner (Author), 2006, Arno Schmidts "Leviathan" - Mythologie und Weltanschauung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56533