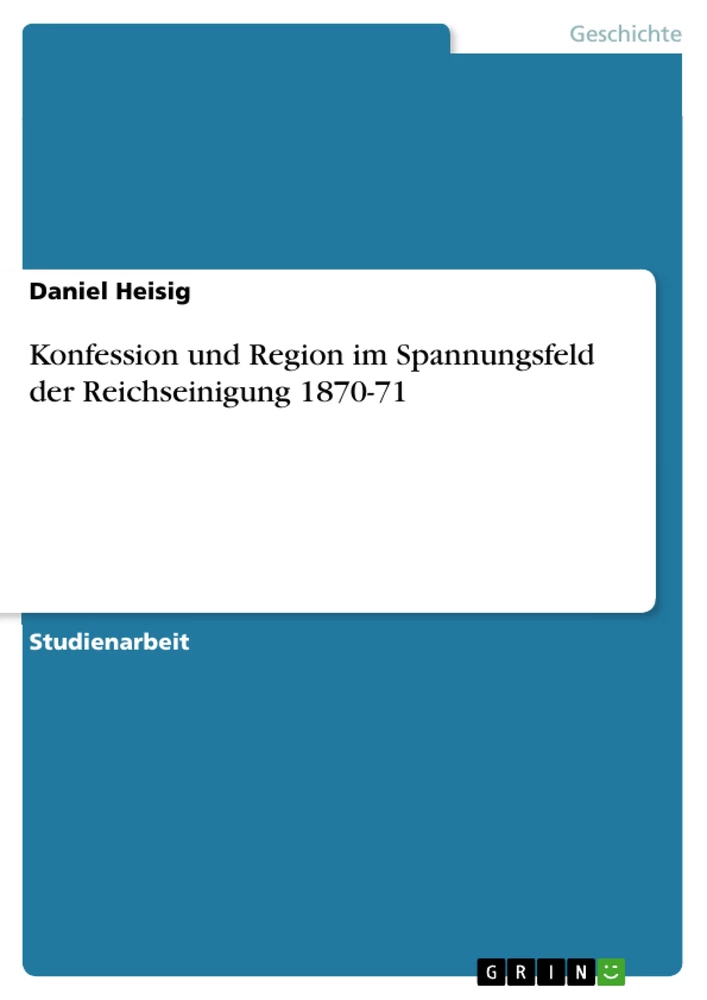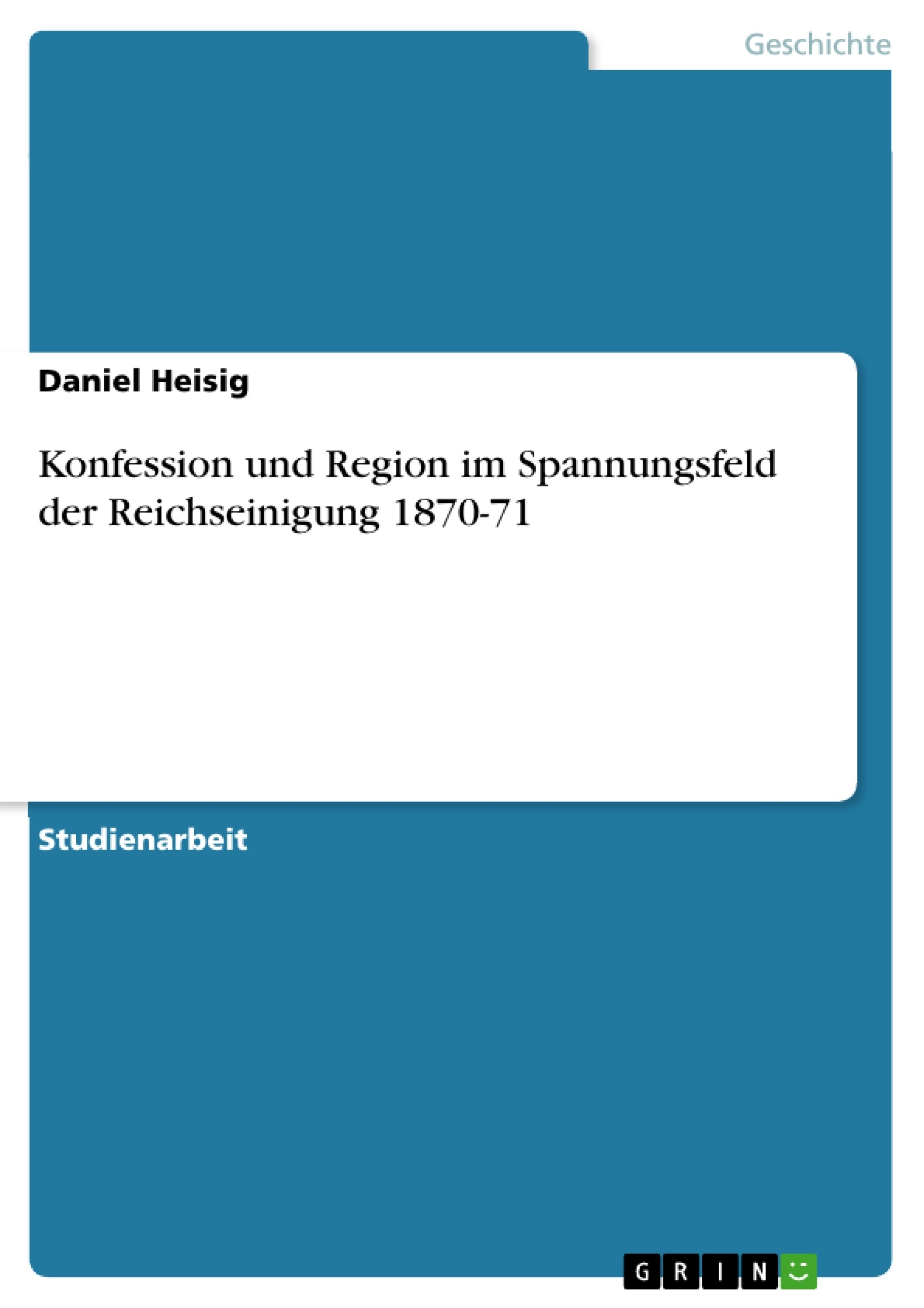Nachdem die nationalen Hoffnungen, welche in den Befreiungskriegen 1815 entstanden waren, enttäuscht wurden, dauerte es bis zu den Einigungskriegen 1864, 1866 und 1871 bis die deutsche Frage geklärt wurde und eine Deutsches Reich mit einem Kaiser an der Spitze gegründet werden konnte. Diese Arbeit setzt sich mit der Problematik auseinander, die sich aus der Lage ergibt, dass das neugegründete Reich sich aus Einzelstaaten mit jeweils eigener Geschichte und eigenem Partikularbewusstsein zusammengesetzt war. Dabei wird dies noch dadurch in seiner Komplexität erhöht, dass die Einzelstaaten mehrkonfessionell zusammengesetzt waren. Der Aufbau der Hausarbeit ist zum einen in die Themenbereiche Konfession und Region gegliedert und zum anderen chronologisch zwischen den Einstellungen zum deutschfranzösischen Krieg 1870 und denen zum Deutschen Reich in seiner Konstituierungsphase aufgeteilt. Im Anschluss an diese Einführung folgt also eine allgemeine Darstellung der konfessionellen Situation der Soldaten im Krieg von 1870/71. Darauf folgt eine Betrachtung der Einstellungen der Konfessionen zum Deutschen Reich. Das dritte Kapitel setzt sich dann intensiv mit der regionalen Problematik auseinander. In dem Bemühen eindeutige Merkmale und Standpunkte zu erhalten ist dieser Abschnitt auf die Partei der Bayerischen Patrioten konzentriert. Hier wird anhand der „Historisch-politischen Blätter für das katholische Deutschland“ von Josef Edmund Jörg und dessen publizierten Briefwechsel aufgezeigt, welche Auswirkungen das Partikularbewusstsein auf die Einstellungen und Meinungen zum deutsch-französischen Krieg und zum Deutschen Reich und dessen Kaiser haben. Das vorletzte Kapitel versucht dann eine Fusion beider Bereiche vorzunehmen. Das Augenmerk liegt dort auf der gegenseitigen Beeinflussung von konfessionellen und regionalen Faktoren und auf den Unterschieden beider. Zum Abschluss werden die Ergebnisse resümiert und ein Ausblick auf die Einstellungen katholischer Kreise im Deutschen Kaiserreich im 19. Jahrhundert vorgenommen.
Die Relevanz dieser Hausarbeit ergibt sich aus den Erkenntnissen, die sich den Beobachtungen und Feststellungen hinsichtlich Integrations- und Abgrenzungsmotiven verschiedener Gruppen gewinnen lassen. Auch wenn heute konfessionelle oder regionale Fragen keinerlei Rolle spielen in Deutschland lassen sich doch möglicherweise Parallelen hinsichtlich gegenwärtiger Integrationsproblematiken von Menschen aus anderen Kulturräumen feststellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Konfession als Faktor der Einstellung zur Nation
- Konfessionalität im Krieg 1870/71
- Das Verhältnis der Konfessionen zum entstehenden Deutschen Reich
- Regionale Beeinflussung der Einstellungen zur Nation – am Beispiel Bayerns
- Einstellungen zum Deutsch-Französischen Krieg 1871
- Einstellung zum Reich und Kaiser in der Konstituierungsphase
- Beziehung zwischen regionaler und konfessioneller Haltung zur Nation
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Rolle von Konfession und Region im Kontext der deutschen Reichseinigung 1870/71. Sie untersucht, wie Konfessionelle Zugehörigkeit und regionale Besonderheiten die Einstellungen der Menschen zum Deutsch-Französischen Krieg und zum entstehenden Deutschen Reich beeinflussten.
- Die Bedeutung der Konfession im Deutsch-Französischen Krieg und ihre Auswirkungen auf die Einstellungen der Soldaten.
- Die Rolle der Konfessionen in der Konstituierungsphase des Deutschen Reichs.
- Der Einfluss der regionalen Besonderheiten, insbesondere in Bayern, auf die Einstellungen zur Reichseinigung.
- Die Interaktion zwischen konfessionellen und regionalen Faktoren im Kontext der deutschen Nationalbewegung.
- Die Relevanz dieser Untersuchung im Hinblick auf gegenwärtige Integrationsproblematiken.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die den historischen Hintergrund der deutschen Reichseinigung und die Relevanz des Themas erläutert.
Das zweite Kapitel untersucht die Bedeutung der Konfession im Deutsch-Französischen Krieg. Es analysiert die religiöse Situation der Soldaten und zeigt auf, dass Konfessionen trotz des Kriegsgeschehens ein gewisses Maß an Harmonie und Verbrüderung ermöglichten.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die regionale Problematik anhand des Beispiels Bayerns. Anhand der „Historisch-politischen Blätter für das katholische Deutschland“ von Josef Edmund Jörg werden die Auswirkungen des bayerischen Partikularbewusstseins auf die Einstellungen zum Krieg und zum entstehenden Reich untersucht.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der gegenseitigen Beeinflussung von konfessionellen und regionalen Faktoren und zeigt die Unterschiede zwischen beiden auf.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Konfession, Region, Nationalismus, Reichseinigung, Deutsch-Französischer Krieg, Bayern, Partikularbewusstsein, Integration und Abgrenzung.
- Quote paper
- Daniel Heisig (Author), 2006, Konfession und Region im Spannungsfeld der Reichseinigung 1870-71, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56531