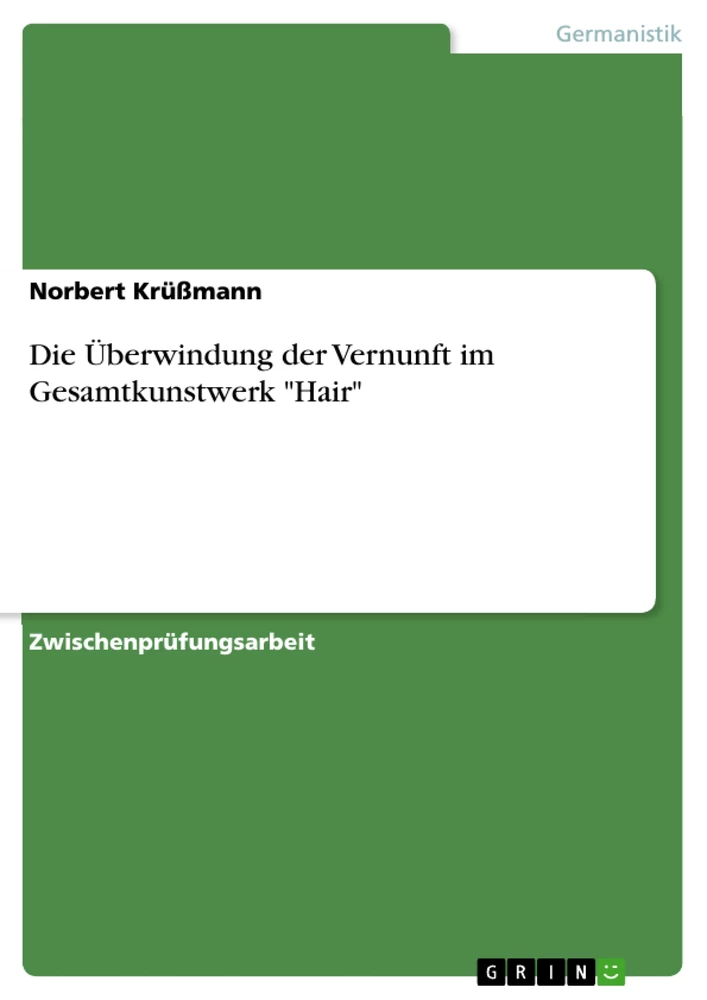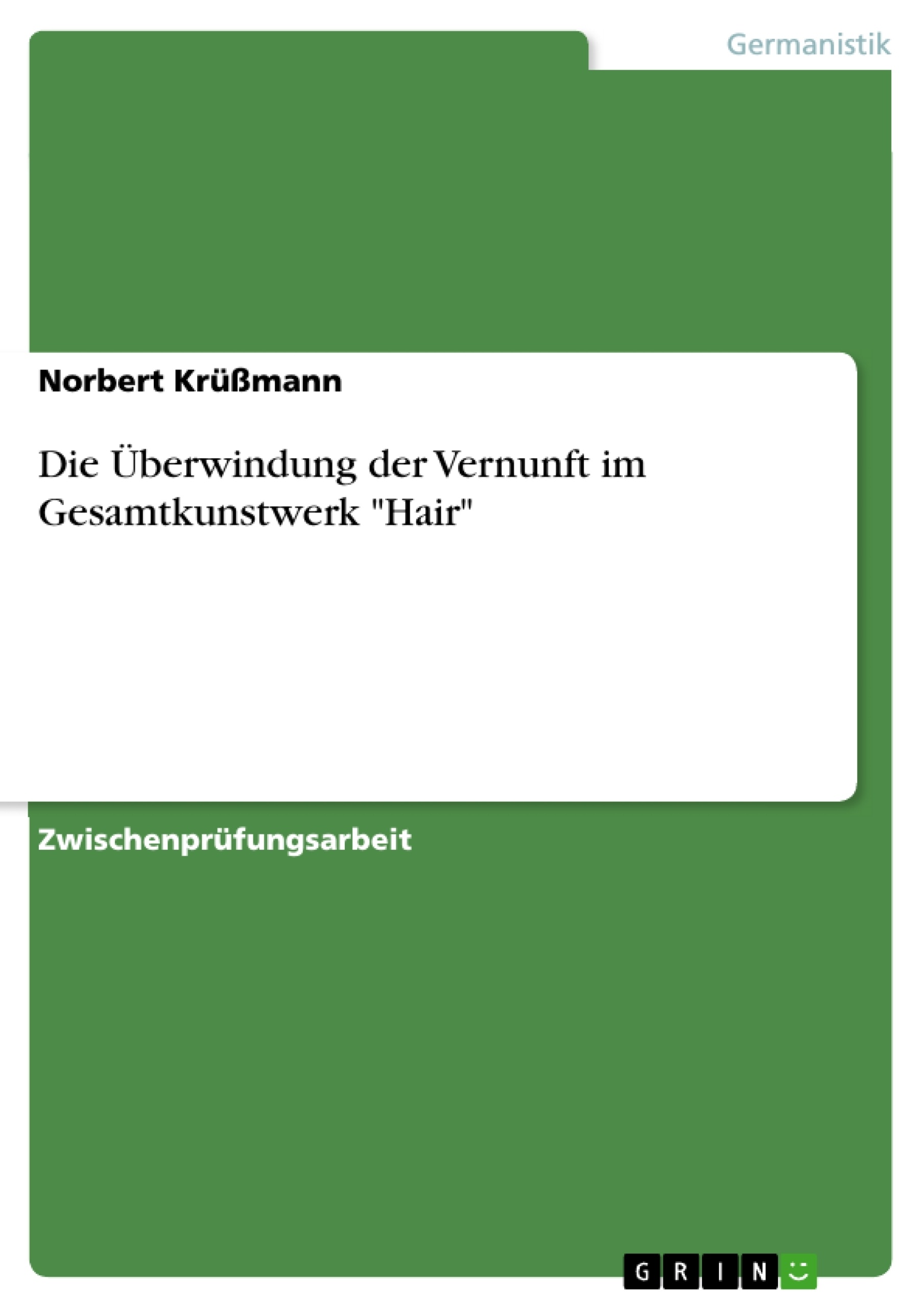Die Geschichte von „Hair“, dem Bühnenwerk, das wie kein zweites das Lebensgefühl der Hippiebewegung der sechziger Jahre transportiert, ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Dabei rief es von Anfang an bei der Kritik sehr verschiedene Reaktionen hervor. Einerseits feierten Theaterkritiker der New York Times und der Saturday Review es als multisensual theater, das die authentische Stimme der Gegenwart wiedergebe. Andererseits aber gab und gibt es seit der Uraufführung 1967 immer wieder Stimmen, die es für „vulgär, billig und geschmacklos“ halten und von einer „banalen Handlung“ sprechen.
Möglicherweise deshalb, wahrscheinlicher aber, weil die Gattung Musical insgesamt immer noch dem reinen Unterhaltungstheater zugerechnet wird, gibt es in der Flut der Kritiken und Rezensionen, die zu Hair geschrieben wurden, kaum Sekundärliteratur, die sich analytisch mit diesem Werk beschäftigt. Dabei besteht in verschiedenen Punkten Klärungsbedarf, wie zum Beispiel in der Frage, ob es sich bei „Hair“ überhaupt um ein Musical handelt. Dieser Problematik wird die vorliegende Arbeit im zweiten Kapitel nachgehen.
Zunächst muß jedoch geklärt werden, über welches „Hair“ wir überhaupt reden; denn seit seiner Uraufführung am Public Theater 1967 veränderte sich häufig sein Gesicht, paßte sich sowohl der Zeit als auch regionalen Gegebenheiten an. Die Bearbeitung dieser Frage wird den Anfang der Arbeit bilden.
Wenn diese formalen Ansätze besprochen sind, wird endlich der Inhalt zu behandeln sein. Da sich dieser äußerst vielschichtig darstellt, ist es im begrenzten Rahmen dieser Arbeit unumgänglich, sich auf einen Aspekt zu beschränken. Neben den Themen Freiheit, Liebe, Antirassismus und Pazifismus, die explizit angesprochen das Bühnenstück prägen, zieht sich die Abkehr von der Vernunft wie ein roter Faden durch die ungefähr zweistündigen Aufführungen. Der Nachweis dieses Ansatzes soll den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bilden. Er wird auf zweierlei Arten verwirklicht. Einerseits werden in „Hair“ Grenzen negiert und damit einer Kategorisierung der Welt, die der Vernunft zu Grunde liegt, entgegengewirkt, andererseits wird der polare Dualismus, die Vorbedingung für jedes vernünftige Urteil über die Welt, aufgehoben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entstehungsgeschichte
- Die Gattungseinordnung
- Musical
- Sprechtheater
- Das klassische Drama
- Die Geburt der Tragödie
- Das epische Theater
- Das Gesamtkunstwerk
- Grenzüberschreitungen
- Realität und Fiktion
- Die Grenzen des Individuums
- Kultureller Crossover
- Die Grenzen des Sagbaren
- Die Glorifikation des Irrationalen
- Aquarius
- Hair
- My Conviction
- Where Do I Go
- Good Morning, Starshine
- Let The Sunshine
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Musical „Hair“ im Kontext seiner Entstehungsgeschichte und seiner gattungsspezifischen Merkmale. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Überwindung der Vernunft im Stück und der damit verbundenen Grenzüberschreitungen. Analysiert werden die verschiedenen Interpretationen des Werkes und seine Rezeption in der Kritik.
- Die Entstehungsgeschichte von „Hair“ und seine Entwicklung.
- Die Einordnung von „Hair“ in die Gattung des Musicals und seine Beziehung zum Sprechtheater.
- Die Darstellung der Überwindung der Vernunft als zentrales Thema.
- Die Grenzüberschreitungen in Bezug auf Realität und Fiktion, Individuum und Gesellschaft.
- Die Rezeption und Kritik des Musicals.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Musicals „Hair“ ein und skizziert die zentrale Forschungsfrage nach der Überwindung der Vernunft im Werk. Sie beschreibt den enormen Erfolg des Stücks und die gegensätzlichen Reaktionen der Kritik, die von enthusiastischen Lobpreisungen bis hin zu vernichtenden Urteilen reichten. Die Einleitung verweist auf den Mangel an analytischer Sekundärliteratur zu „Hair“ und begründet die Notwendigkeit einer eingehenden Beschäftigung mit dem Werk.
Die Entstehungsgeschichte: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung des Musicals „Hair“, beginnend bei den Autoren Gerome Ragni und James Rado, die das Libretto zusammenstellten, bis hin zum Komponisten Galt MacDermot und dem Regisseur Gerald Freeman. Es wird die Entwicklung des Stücks von der Uraufführung im Public Theater bis zur Broadway-Version mit ihren Veränderungen und Anpassungen an die Zeit und die jeweiligen Aufführungsorte nachgezeichnet. Besonders wird der Konflikt zwischen den Autoren und dem Produzenten thematisiert, der zu einem Personalwechsel in den Hauptrollen führte. Das Kapitel zeigt, wie „Hair“ sich als organisch gewachsenes Gesamtkunstwerk entwickelte und in seinen verschiedenen Fassungen stets Veränderungen unterworfen war.
Schlüsselwörter
Hair, Musical, Hippie-Bewegung, Vernunft, Irrationalität, Grenzüberschreitung, Gesamtkunstwerk, Realität und Fiktion, Rezeption, Kritik.
Häufig gestellte Fragen zu "Hair": Eine Analyse der Überwindung der Vernunft
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Musical „Hair“ umfassend. Sie untersucht die Entstehungsgeschichte, die gattungsspezifische Einordnung (Musical, Sprechtheater, Gesamtkunstwerk), zentrale Themen wie die Überwindung der Vernunft und die damit verbundenen Grenzüberschreitungen (Realität/Fiktion, Individuum/Gesellschaft), sowie die Rezeption und Kritik des Stücks. Die Arbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden im Musical „Hair“ behandelt?
Das zentrale Thema ist die Überwindung der Vernunft und die damit verbundene Glorifikation des Irrationalen. Weitere wichtige Themen sind Grenzüberschreitungen in Bezug auf Realität und Fiktion, die Grenzen des Individuums und der Gesellschaft, sowie kulturelle Überschreitungen und die Grenzen des Sagbaren. Die Analyse betrachtet auch die Hippie-Bewegung als wichtigen Kontext.
Wie ist das Musical „Hair“ gattungsmäßig einzuordnen?
„Hair“ wird als Musical eingeordnet, weist aber auch deutliche Bezüge zum Sprechtheater auf, insbesondere zum klassischen Drama, der Geburt der Tragödie und dem epischen Theater. Die Arbeit betont zudem den Charakter des Stücks als Gesamtkunstwerk.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Entstehungsgeschichte, ein Kapitel zur Gattungseinordnung, ein Kapitel zu Grenzüberschreitungen, ein Kapitel zur Glorifikation des Irrationalen (mit Analyse einzelner Songs), und einen Schluss. Jedes Kapitel wird in der Arbeit kurz zusammengefasst.
Wie wird die Entstehungsgeschichte von „Hair“ dargestellt?
Die Entstehungsgeschichte wird detailliert beschrieben, von den Autoren Gerome Ragni und James Rado (Libretto) über den Komponisten Galt MacDermot bis zum Regisseur Gerald Freeman. Die Entwicklung des Stücks von der Uraufführung im Public Theater bis zur Broadway-Version mit ihren Veränderungen und Anpassungen wird nachgezeichnet. Der Konflikt zwischen den Autoren und dem Produzenten und der damit verbundene Personalwechsel in den Hauptrollen wird thematisiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Hair, Musical, Hippie-Bewegung, Vernunft, Irrationalität, Grenzüberschreitung, Gesamtkunstwerk, Realität und Fiktion, Rezeption, Kritik.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht „Hair“ im Kontext seiner Entstehungsgeschichte und gattungsspezifischen Merkmale, mit Fokus auf die Darstellung der Überwindung der Vernunft und der damit verbundenen Grenzüberschreitungen. Analysiert werden verschiedene Interpretationen und die Rezeption in der Kritik. Die Arbeit hebt den Mangel an analytischer Sekundärliteratur zu „Hair“ hervor und begründet die Notwendigkeit einer eingehenden Beschäftigung mit dem Werk.
- Quote paper
- Magister Artium Norbert Krüßmann (Author), 2000, Die Überwindung der Vernunft im Gesamtkunstwerk "Hair", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56497