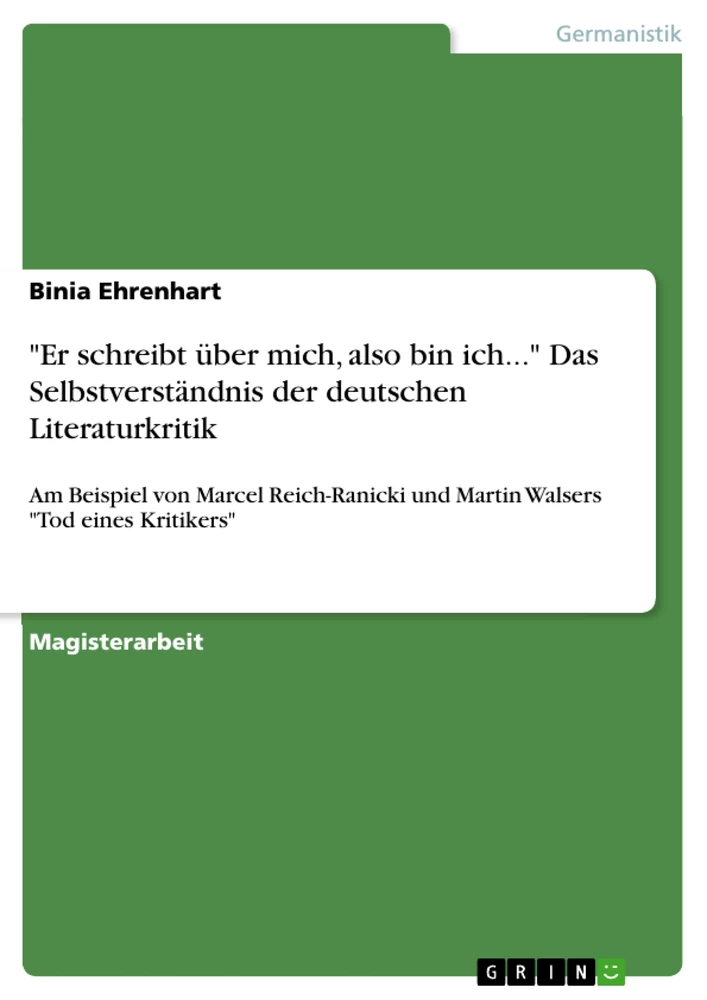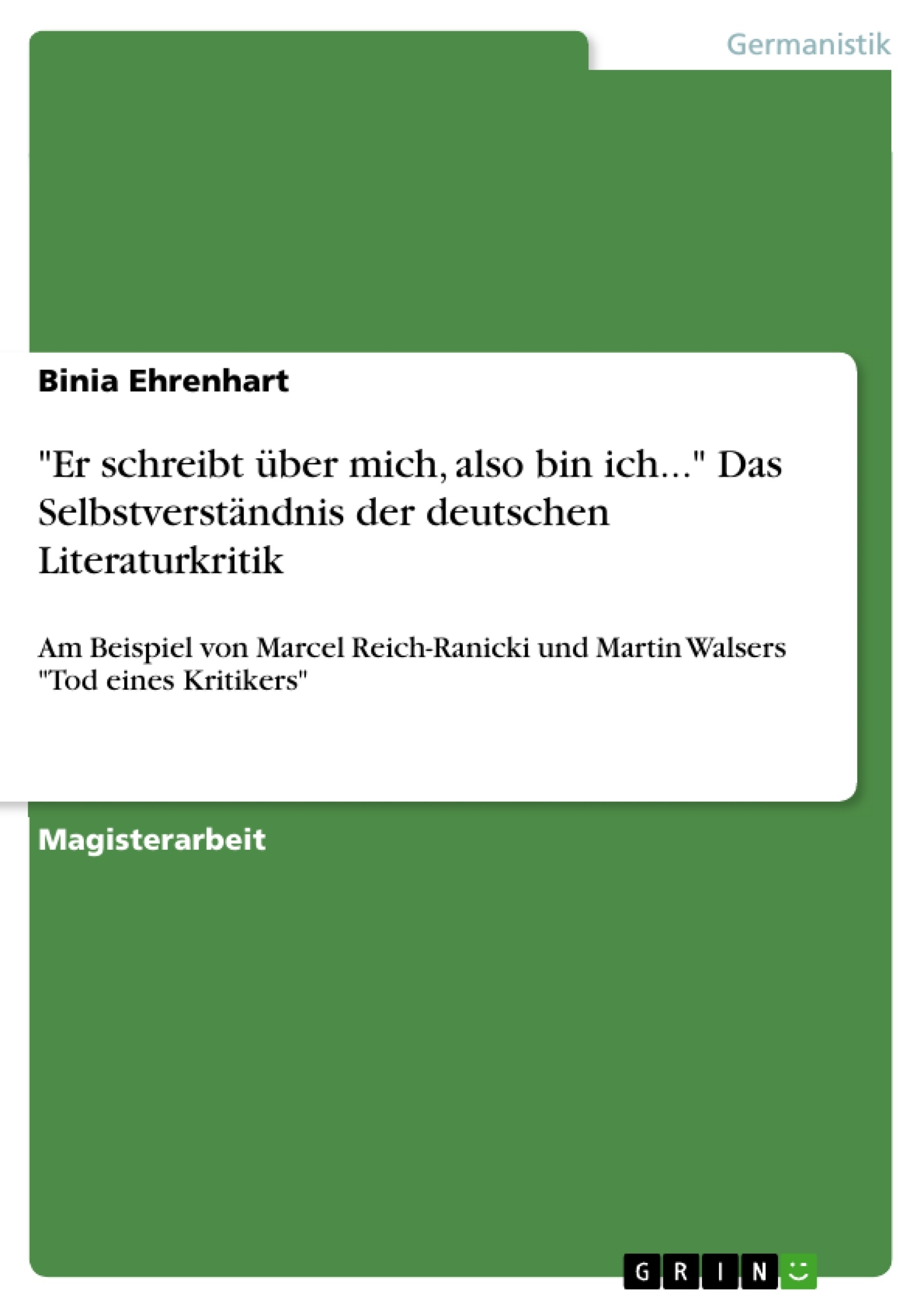Der Papst ist als Botschafter Gottes auf Erden, um die Menschen das heilige Testament zu lehren. Er ist in seinen Entscheidungen und Taten unfehlbar. Er wurde ernannt, um den Menschen die Kirche Christi und deren Gebote näher zu bringen und sie so auf dem tugendhaften Weg Gottes zu geleiten. Durch den Glauben an den Papst und seine Lehren können die Menschen ein besseres Leben führen.
Der Literaturpapst, den es wie den der Kirche nur einmal geben kann, arbeitet im Dienste der Literatur. In ihrem Namen prangert er literarische Missstände und vor allem deren Verursacher an, um den Menschen die bestmögliche Literatur aufzeigen zu können. Außerdem handelt auch er in dem Glauben, die Menschen durch seine Gebote vor Schlimmem, in diesem Fall schlechter Literatur, zu bewahren und ihnen Besseres anzubieten. Sein Ziel ist es, durch die getroffene Auswahl erzieherisch auf die Leser einzuwirken. Marcel Reich-Ranicki ist in einer Reihe mit Christian Adolf Klotz, Paul Lindau und Alfred Kerr seit vielen Jahren der Erste, der wieder als Literaturpapst bezeichnet wird. Auch wenn dieser Titel weder bei den dreien vor Reich-Ranicki noch bei ihm selbst oft wohlwollend oder anerkennend benutzt wurde, so drückt er dennoch eines aus: Der Papst ist der Oberste seiner Zunft, seine Meinung ist, auch wenn sie oft angegriffen wird, niemals belanglos oder gar ignorierbar. Sogar die Gegner von Marcel Reich-Ranicki müssen zugeben, dass jede seiner Kritiken zumindest wahrgenommen wird. Freiwillig oder nicht, alle im Literaturbetrieb müssen sich mit ihm auseinandersetzen. Da sich Reich-Ranicki allerdings lieber als Anwalt der Literatur sieht, der sie gegen Behandlungen und Misshandlungen aller Art verteidigt, überlässt er es seines Erachtens den Rezipienten, ein endgültiges Urteil über ein Werk zu fällen. Er erhebt auch keinen Anspruch auf Wahrheit bei seinen Kritiken, allerdings versteht er es durch Polemisierung, Vereinfachung und Zuspitzung seine Leser oder sein Publikum zu beeinflussen. Schon seit Beginn seiner Karriere scheiden sich die Meinungen über die Art und Weise, wie Reich-Ranicki mit Autoren und deren Werken umgeht und auch wie mit ihm umgegangen wird. Ein Ereignis übertrifft 2002 aber alles in der literarischen Welt bisher da Gewesene. Martin Walsers Roman „Tod eines Kritikers“ führt bereits vor dessen Erscheinen zu einem Skandal.
Inhaltsverzeichnis
- I. Deutsche Päpste
- II. Traditionsbezüge in der deutschen Literaturkritik
- 1. Historischer Rückblick anhand ausgewählter Beispiele
- 1.1. Lessing: Negation als pädagogische Funktion
- 1.2. Goethe: Verächter der Kritik
- 1.3. Drittes Reich: Propaganda statt Kritik
- 1.4. DDR: Schreiben mit gelähmter Hand
- 1.5. Heute: Multimediale Inszenierung
- 2. Der Platz der Literaturkritik im medialen Zeitalter - eine systemtheoretische Betrachtung
- 3. Der deutsch-deutsche Literaturstreit und die Frage nach der Autorität des Autors
- 3.1. Der „Fall“ Christa Wolf oder: Die Verantwortung eines Schriftstellers
- 3.2. Autorenkonzepte
- III. Der Aufstieg des Marcel Reich-Ranicki
- 1. Prägungen und Grunderfahrungen
- 2. Sein Einstieg in die Literaturkritik der BRD
- 3. Die „Macht“ eines Kritikers
- 3.1. Grass: Kalkulierender Artist mit monumentalen Missgeschicken
- 3.2. Böll: Die Galionsfigur
- 3.3. Bachmann: Opfer feministischer Vorurteile
- 4. Das Showtalent Reich-Ranicki
- IV. „Tod eines Kritikers“ und der deutsche Literaturskandal
- 1. Das Streitobjekt
- 2. Verlauf der Kontroverse
- 3. Der Roman als Angriff auf die Person Reich-Ranicki
- 3.1. Vorgeschichte Walser - Reich-Ranicki
- 3.2. „Ein großes Stück Postmoderne“
- 3.3. Der Roman unter dem Antisemitismus-Verdikt
- 4.1. Vorgeschichte eines Antisemitismusverdachts
- 4.2. „Tod eines Kritikers“ als Spielmodell der Komödie
- 5. Resümee
- V. Das Ende der Papstära?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Rolle und das Selbstverständnis der deutschen Literaturkritik in den letzten zwei Jahrzehnten am Beispiel von Marcel Reich-Ranicki und Martin Walsers Roman „Tod eines Kritikers“. Sie analysiert die Kontroverse um den Roman und die damit verbundenen Vorwürfe des Antisemitismus.
- Die Rolle des Literaturkritikers im medialen Zeitalter
- Der Einfluss und die Macht von Literaturkritik
- Der deutsch-deutsche Literaturstreit und die Frage nach der Autorität des Autors
- Das Verhältnis von Literatur und Kritik
- Der Einfluss von Persönlichkeiten wie Reich-Ranicki auf die literarische Landschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Deutsche Päpste: Dieses Kapitel beleuchtet die Figur des „Literaturpapstes“ und stellt Marcel Reich-Ranicki in die Reihe prominenter Kritiker wie Christian Adolf Klotz, Paul Lindau und Alfred Kerr. Es thematisiert Reich-Ranickis Einfluss und die kontroversen Reaktionen auf seine Kritik.
- II. Traditionsbezüge in der deutschen Literaturkritik: Dieses Kapitel untersucht die historischen Wurzeln der deutschen Literaturkritik anhand ausgewählter Beispiele, angefangen bei Lessing über Goethe bis zum Dritten Reich und der DDR. Es analysiert den Platz der Literaturkritik im medialen Zeitalter und den deutsch-deutschen Literaturstreit.
- III. Der Aufstieg des Marcel Reich-Ranicki: Dieses Kapitel zeichnet den Aufstieg Reich-Ranickis als Literaturkritiker nach, beleuchtet seine Prägungen und Grunderfahrungen, seinen Einstieg in die BRD und die „Macht“ seiner Kritik. Es analysiert seine Auseinandersetzungen mit prominenten Autoren wie Grass, Böll und Bachmann und stellt seine Rolle als „Showtalent“ dar.
- IV. „Tod eines Kritikers“ und der deutsche Literaturskandal: Dieses Kapitel widmet sich dem Roman „Tod eines Kritikers“ von Martin Walser, der bereits vor seinem Erscheinen zu einem Skandal führte. Es untersucht die Vorwürfe des Antisemitismus gegen Walser, die Kontroverse um den Roman und seine Interpretation als Angriff auf Reich-Ranicki.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Literaturkritik, Selbstverständnis, Medien, Einfluss, Kontroverse, Antisemitismus, Reich-Ranicki, Walser, „Tod eines Kritikers“, deutscher Literaturstreit, Autorität, Verantwortung, Tradition, Medienlandschaft.
- Quote paper
- Magistra Artium Binia Ehrenhart (Author), 2005, "Er schreibt über mich, also bin ich..." Das Selbstverständnis der deutschen Literaturkritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56443