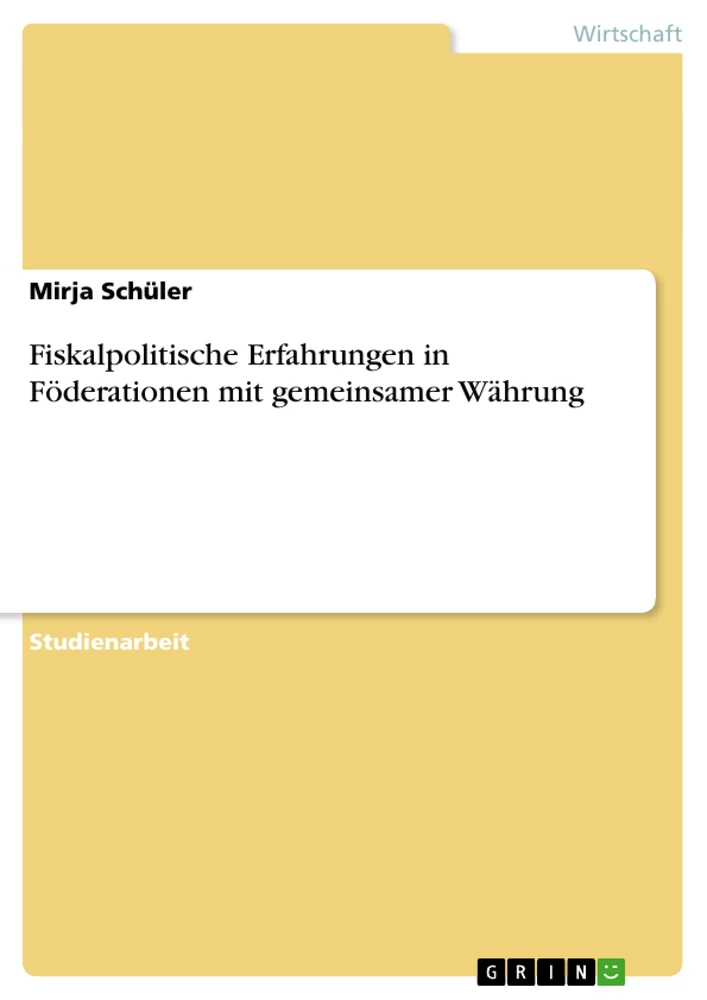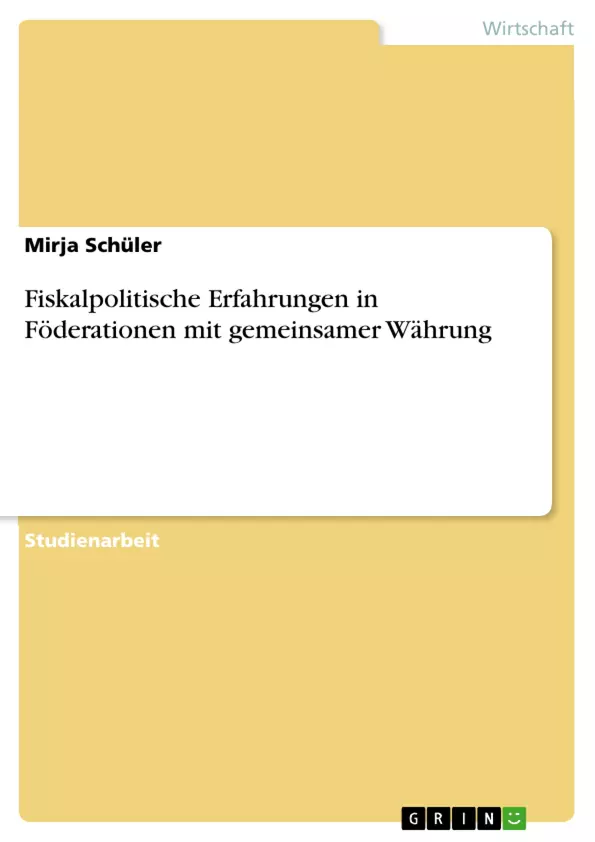Das Ziel eines Staates sollte es sein, einen effizienten Einsatz der gegebenen Ressourcen, eine möglichst homogene Einkommensverteilung und einen hohen Beschäftigungsstand bei vertretbarer Preisstabilität zu gewährleisten. Man kann also die Effektivität des öffentlichen Sektors an dem Grad der Lösung des Allokations-, Distributions-, und Stabilitätsproblems feststellen.
Ausgehend von der Beurteilung zweier extremer Staatsformen, nämlich der mit einer vollkommen zentralisierten und der mit einer weitgehend dezentralisierten Organisation, kommt man zu dem Schluß, daß eine Zwischenform beider Modelle die beste Lösung darstellt. In einer Föderation, in der neben einer Zentralregierung auch dezentrale Regierungseinheiten existieren, können die Vorteile beider Extrema kombiniert und gewichtige Nachteile ausgeschaltet werden.
Es entsteht die Theorie des fiskalischen Föderalismus, die sich mit einer sinnvollen Aufteilung der staatlichen Aufgaben, Ausgaben und Einnahmen in einem politischen System mit mindestens zwei staatlichen Ebenen beschäftigt.
Im Rahmen dieser Hausarbeit sollen praktische Erfahrungen, die in Föderationen mit unterschiedlichem Zentralisierungsgrad gemacht wurden gegenübergestellt werden. Es sollen Erkenntnisse gewonnen werden, die der Bestimmung einer optimalen Struktur des öffentlichen Sektors hinsichtlich der Zuordnung von Entscheidungsbefugnissen und Verantwortlichkeiten auf zentrale und dezentrale gesellschaftliche Ebenen dienen können.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Problemstellung
- Gang der Untersuchung
- Die Bundesrepublik Deutschland
- Die Finanzverfassung
- Die Verteilung der Aufgaben
- Die Verteilung der Ausgaben
- Die Verteilung der Einnahmen
- Die Rolle der Gemeinden
- Die Veränderungen im Laufe der Zeit
- Die Entwicklung zwischen 1949 und 1990
- Die besondere Situation nach der deutschen Wiedervereinigung
- Bestandsaufnahme und Beurteilung
- Die Ausgabenseite
- Die Einnahmenseite
- Der Finanzausgleich
- Beurteilung
- Forderungen des Sachverständigenrates
- Die Finanzverfassung
- Die USA
- Der Hintergrund
- Zentralistische Tendenzen
- Revenue Sharing
- Federal Grants
- Mandates
- Bewertung
- New Federalism
- Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit den fiskalpolitischen Erfahrungen in Föderationen mit gemeinsamer Währung. Das Ziel ist es, die Funktionsweise des Fiskalföderalismus anhand von Beispielen aus Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika zu analysieren und Erkenntnisse für die Gestaltung der Fiskalpolitik innerhalb der Europäischen Union zu gewinnen.
- Analyse der Finanzverfassung und -entwicklung in Deutschland und den USA
- Beurteilung des Einflusses von Zentralisierungstendenzen auf den Fiskalföderalismus
- Untersuchung der Auswirkungen der deutschen Wiedervereinigung auf die Finanzverfassung
- Diskussion über die optimale Struktur des öffentlichen Sektors in föderalen Systemen
- Überlegungen zur Gestaltung der Fiskalpolitik innerhalb der Europäischen Union
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit führt in die Thematik des Fiskalföderalismus ein und erläutert die Problemstellung. Es werden die Ziele des Staates und die Effektivität des öffentlichen Sektors im Kontext des Allokations-, Distributions- und Stabilitätsproblems diskutiert. Das Kapitel beleuchtet die Vor- und Nachteile zentralisierter und dezentralisierter Staatsformen und stellt den Fiskalföderalismus als optimale Zwischenform vor.
Kapitel 2 widmet sich der Finanzverfassung der Bundesrepublik Deutschland. Es werden die grundlegenden Regelungen des Grundgesetzes hinsichtlich der Verteilung von Aufgaben, Ausgaben und Einnahmen zwischen Bund und Ländern dargestellt. Die Entwicklung der Finanzverfassung von 1949 bis zur Gegenwart wird beleuchtet, wobei auch die besonderen Herausforderungen der deutschen Wiedervereinigung berücksichtigt werden. Die Analyse umfasst eine Bestandsaufnahme und Beurteilung der aktuellen Situation, einschließlich der Ausgabenseite, der Einnahmenseite, des Finanzausgleichs und der Forderungen des Sachverständigenrates.
Im dritten Kapitel werden die Erfahrungen mit dem Fiskalföderalismus in den Vereinigten Staaten von Amerika betrachtet. Der Hintergrund des US-amerikanischen Systems wird erläutert, und es werden zentralistische Tendenzen wie Revenue Sharing, Federal Grants und Mandates analysiert. Schließlich werden die Entwicklungen im Rahmen des „New Federalism“ beleuchtet.
Schlüsselwörter
Fiskalföderalismus, Finanzverfassung, Bundesrepublik Deutschland, Vereinigte Staaten von Amerika, Europäische Union, Zentralisierung, Dezentralisierung, Aufgabenverteilung, Ausgabenverteilung, Einnahmenverteilung, Finanzausgleich, Wiedervereinigung, Revenue Sharing, Federal Grants, Mandates, New Federalism.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kernkonzept des fiskalischen Föderalismus?
Es befasst sich mit der Aufteilung von staatlichen Aufgaben, Ausgaben und Einnahmen zwischen zentralen und dezentralen Regierungsebenen.
Wie ist die Finanzverfassung in Deutschland strukturiert?
Das Grundgesetz regelt die Verteilung der Aufgaben und Einnahmen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, ergänzt durch einen Finanzausgleich.
Welche Besonderheiten weist der US-amerikanische Fiskalföderalismus auf?
In den USA gibt es starke dezentrale Tendenzen, aber auch zentralistische Instrumente wie Federal Grants (Bundeszuweisungen) und Revenue Sharing.
Wie beeinflusste die Wiedervereinigung die deutsche Finanzverfassung?
Die Wiedervereinigung erforderte massive Umverteilungen und Anpassungen im Finanzausgleich, um die neuen Bundesländer zu integrieren.
Was versteht man unter „New Federalism“ in den USA?
Es beschreibt Bestrebungen, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten wieder stärker von der Bundesebene auf die Einzelstaaten zurückzuverlagern.
- Quote paper
- Mirja Schüler (Author), 1999, Fiskalpolitische Erfahrungen in Föderationen mit gemeinsamer Währung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5639