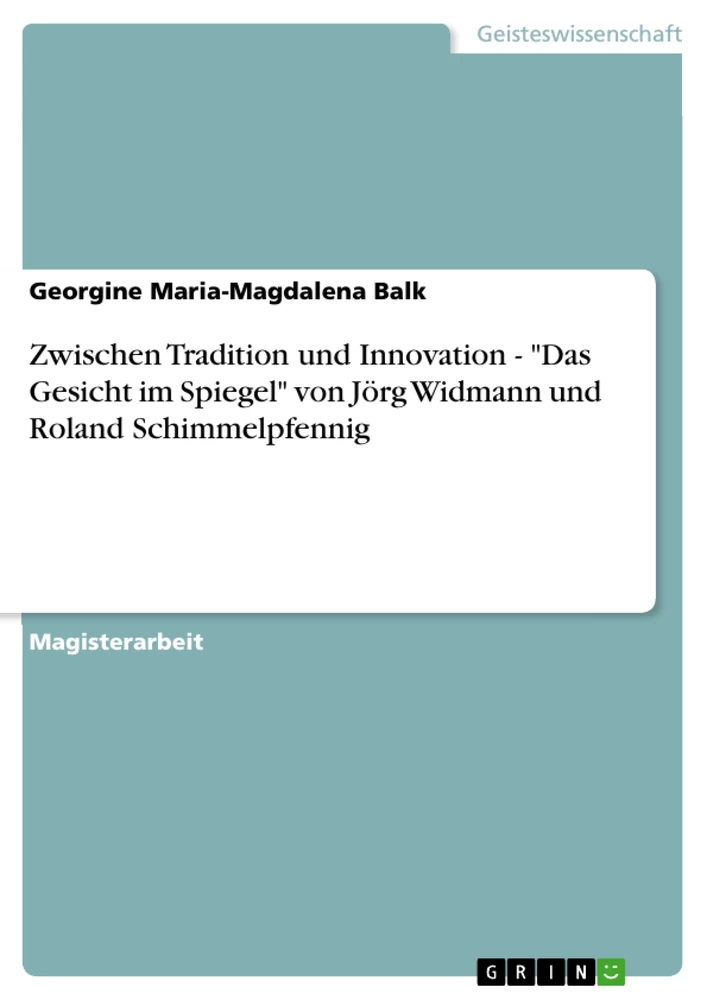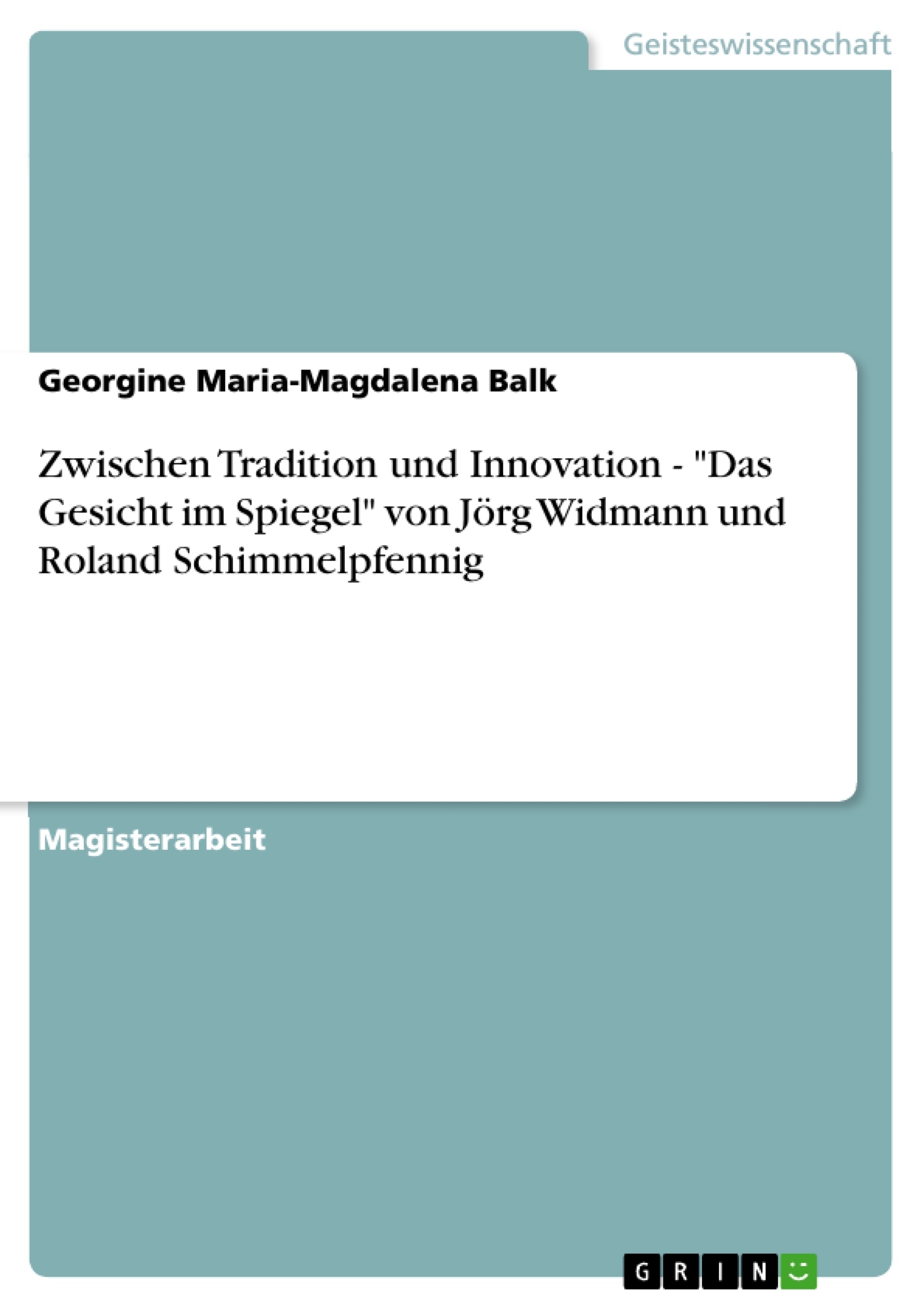Unter dem Aspekt der Korrelation zwischen traditionellem und innovativem Schaffen wird die Relevanz und Eigenständigkeit der Oper „Das Gesicht im Spiegel” (UA 2003) von Jörg Widmann und Roland Schimmelpfennig beleuchtet.
Äußere und innere Motivation der als Magisterarbeit im Fach Theaterwissenschaft entstandenen Untersuchung begünstigte der Umstand, dass die Autorin als Regieassistentin bei der Münchner Uraufführungsproduktion mitgewirkt hat.
Dem Überblick über die Uraufführungsszenerie im deutschsprachigen Musiktheater in der Spielzeit 2002/2003 folgt eine Skizzierung biographischer Daten der Autoren und ihres Schaffens. Ein Abriss der Entstehungsgeschichte und der Produktionssituation schließt sich an. Die im Hauptteil behandelte dramatische und musikalische Umsetzung bietet einerseits eine Übersicht über die konstituierenden dramaturgischen Elemente des Stücks andererseits aber auch Einblick in die schillernde Vielschichtigkeit des Musiktheaterstücks. Dabei werden sowohl literaturwissenschaftliche als auch musikwissenschaftliche Parameter herangezogen. Da sich das Libretto der Oper zentral mit der Thematik des Klonens beschäftigt, folgt eine Rezeption des Motivs des „Künstlichen Menschen“. Aufgrund des Bezugs zur Gegenwart drängt sich die Frage auf, ob bewusst an die Tradition der „Zeitoper“ der 20er Jahre angeknüpft wurde. Schließlich geht die Verfasserin ausführlich auf die Zweitaufführung des Werks in Krefeld/Mönchengladbach ein. Ein umfangreicher Anhang rundet die Arbeit wissenschaftlich fundiert ab.
Die bisherige Literaturlage für einen weiten Themenkreis dieser Arbeit ist recht mager. Eine Beschäftigung mit dem Werk des Dramatikers Schimmelpfennig beispielsweise ist, obwohl das veröffentlichte Werk schon sehr umfangreich ist und an den institutionalisierten Schauspielbühnen Deutschlands sehr häufig auf dem Spielplan steht, bisher ausgeblieben. Die Situation verhält sich auch für das Œuvre des Komponisten Jörg Widmann nicht anders. Die Autorin konnte sich bezüglich Schimmelpfennigs und Widmanns Personen und Schaffen auf Primärliteratur und Informationen der Verlage stützen und durch Interviews Lücken des so vorgefundenen Materials schließen. Speziell zum noch jungen Musiktheaterwerk „Das Gesicht im Spiegel” lagen als Literatur lediglich die Programmheftbeiträge der Ur– und Zweitaufführung, sowie ein umfangreicher Pressespiegel vor, so dass die wissenschaftliche Aufarbeitung im Rahmen dieser Magisterarbeit störende Lücken zu schließen vermag.
Inhaltsverzeichnis
- „Das Gesicht im Spiegel” – Das Schaffen seiner Urheber und der Versuch einer Einordnung in die Reihe zeitgenössischer Werke
- Methoden und Forschungssituation
- Uraufführungen im deutschsprachigen Raum im Genre Musiktheater der Spielzeit 2002/2003 – ein Überblick
- Die jungen Autoren des Musiktheaterstücks „Das Gesicht im Spiegel”
- Roland Schimmelpfennig als Autor von Gegenwartsdramatik
- Biographische Daten Schimmelpfennigs
- Schimmelpfennigs zeitrelevante Dramatik
- Jörg Widmann als Komponist dramatischer Werke
- Biographische Daten Widmanns
- Gattungs – und genreübergreifende Werke als Wegbereiter für musiktheatrale Kompositionen
- Musiktheatrale Kompositionen
- Die Handlung von „Das Gesicht im Spiegel\" als Resultat früher verarbeiteter Sujets
- Die Entstehung von „Das Gesicht im Spiegel”
- „Das Gesicht im Spiegel\" als Auftragsoper
- Die Zusammenarbeit von Komponist und Librettist
- Der Produktionsprozess der Uraufführung
- Die dramatische und musikalische Umsetzung
- Das Libretto
- Dramaturgie im Handlungsverlauf
- Bezug zu Elementen der antiken Tragödie
- Figurenzeichnung
- Namensbedeutung
- Figurencharakteristik und -entwicklung
- Justine – eine von ihrer Umwelt determinierte Figur
- Patrizia - ein Gegenentwurf zur Figur der Justine
- Bruno - ein Mann zwischen ein- und derselben Frau
- Milton gefangen in der Welt der Wissenschaft
- Die Kompositorische Umsetzung
- Die Musikalische Dramaturgie
- Die Antiklimax im Spannungsaufbau
- Die dramatische Funktion der Zwischenspiele
- Die Figurencharakteristik
- Besonderheiten des musikalischen Ausdrucks der einzelnen Figuren
- Die Charakterisierung durch die Wahl des Stimmfachs
- Die Charakterisierung durch Satztechnik und Form
- Die Harmonik
- Die Orchesterbehandlung
- Der „Künstliche Mensch”
- Das Motiv des „Künstlichen Menschen\" in der europäischen Literatur
- Das Klongeschöpf Justine als „Künstlicher Mensch❝
- Die Gier nach der „Künstlichen Frau“
- Die Zusammensetzung des „Künstlichen Menschen“
- Die bedingte Perfektion des „Künstlichen Menschen“
- Die Unbeherrschbarkeit des „Künstlichen Menschen“
- Doppelgänger
- Die Realisierbarkeit des Mythos durch die Möglichkeiten der Forschung
- Gegenwartsstück, Zeitoper, ... ? Der Versuch einer Einordnung von „Das Gesicht im Spiegel”
- Die Zweitaufführung von „Das Gesicht im Spiegel”
- Die Bedeutung einer Zweitaufführung für neue Musiktheaterstücke
- Die Zweitaufführung von „Das Gesicht im Spiegel“ am Theater Krefeld
- Brückenschlag zwischen Tradition und Innovation – eine Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die wissenschaftliche Hausarbeit untersucht die Entstehung, dramaturgische und musikalische Gestaltung sowie die thematischen Schwerpunkte des Musiktheaterstücks „Das Gesicht im Spiegel“ von Jörg Widmann und Roland Schimmelpfennig. Die Arbeit beleuchtet die Einordnung des Werks in die zeitgenössische Musiktheaterlandschaft und analysiert die Zusammenarbeit von Komponist und Librettist. Darüber hinaus werden die dramaturgischen Besonderheiten, die musikalische Umsetzung sowie die thematische Auseinandersetzung mit dem Motiv des „Künstlichen Menschen“ im Kontext der europäischen Literaturgeschichte erörtert.
- Die Zusammenarbeit von Komponist und Librettist
- Dramaturgische Besonderheiten und musikalische Umsetzung
- Das Motiv des „Künstlichen Menschen“ im Kontext der europäischen Literaturgeschichte
- Die Einordnung des Werks in die zeitgenössische Musiktheaterlandschaft
- Die Bedeutung der Zweitaufführung für neue Musiktheaterstücke
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Einordnung des Musiktheaterstücks „Das Gesicht im Spiegel“ in die zeitgenössische Musiktheaterlandschaft. Es werden die Biografien von Komponist Jörg Widmann und Librettist Roland Schimmelpfennig beleuchtet und ihre jeweiligen Werke in den Kontext der Gegenwartsdramatik und der Musiktheaterlandschaft eingeordnet. Zudem wird die Entstehung des Stücks sowie die Zusammenarbeit von Widmann und Schimmelpfennig im Detail dargestellt.
Im zweiten Kapitel wird die dramaturgische und musikalische Umsetzung des Werks analysiert. Hierbei werden die Besonderheiten des Librettos, die Figurenzeichnung und die musikalische Dramaturgie im Spannungsaufbau, die Charakterisierung der Figuren durch die Wahl des Stimmfachs und die Satztechnik sowie die Orchesterbehandlung beleuchtet.
Kapitel 3 befasst sich mit dem zentralen Motiv des „Künstlichen Menschen“ im Stück. Es wird die Relevanz dieses Motivs in der europäischen Literaturgeschichte erörtert und die Figur Justine als Klongeschöpf in ihren verschiedenen Facetten – von der Gier nach der „Künstlichen Frau“ bis zur Unbeherrschbarkeit des „Künstlichen Menschen“ – analysiert. Die Realisierbarkeit des Mythos im Kontext der modernen Forschung wird ebenfalls diskutiert.
Kapitel 4 widmet sich der Einordnung des Werks in die verschiedenen Genres der zeitgenössischen Musiktheaterlandschaft. Die Charakteristika des Gegenwartsstücks, der Zeitoper und anderer relevanter Kategorien werden im Hinblick auf „Das Gesicht im Spiegel“ beleuchtet.
Schlüsselwörter
Musiktheater, Gegenwartsdramatik, „Das Gesicht im Spiegel“, Jörg Widmann, Roland Schimmelpfennig, „Künstlicher Mensch“, Klongeschöpf, Uraufführung, Zweitaufführung, Dramaturgie, Musik, Komposition, Libretto, Figurenzeichnung, Orchester, Harmonik, Satztechnik, Forschung, Mythos, Zeitgenössisches Musiktheater, Genre
- Quote paper
- M.A. Georgine Maria-Magdalena Balk (Author), 2005, Zwischen Tradition und Innovation - "Das Gesicht im Spiegel" von Jörg Widmann und Roland Schimmelpfennig, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56278