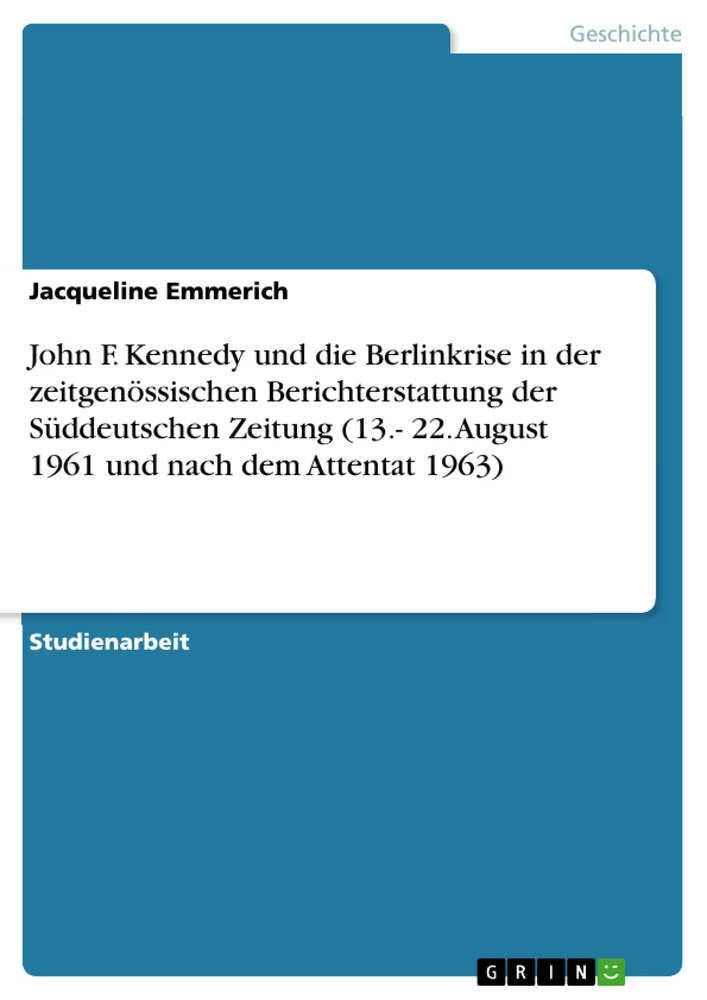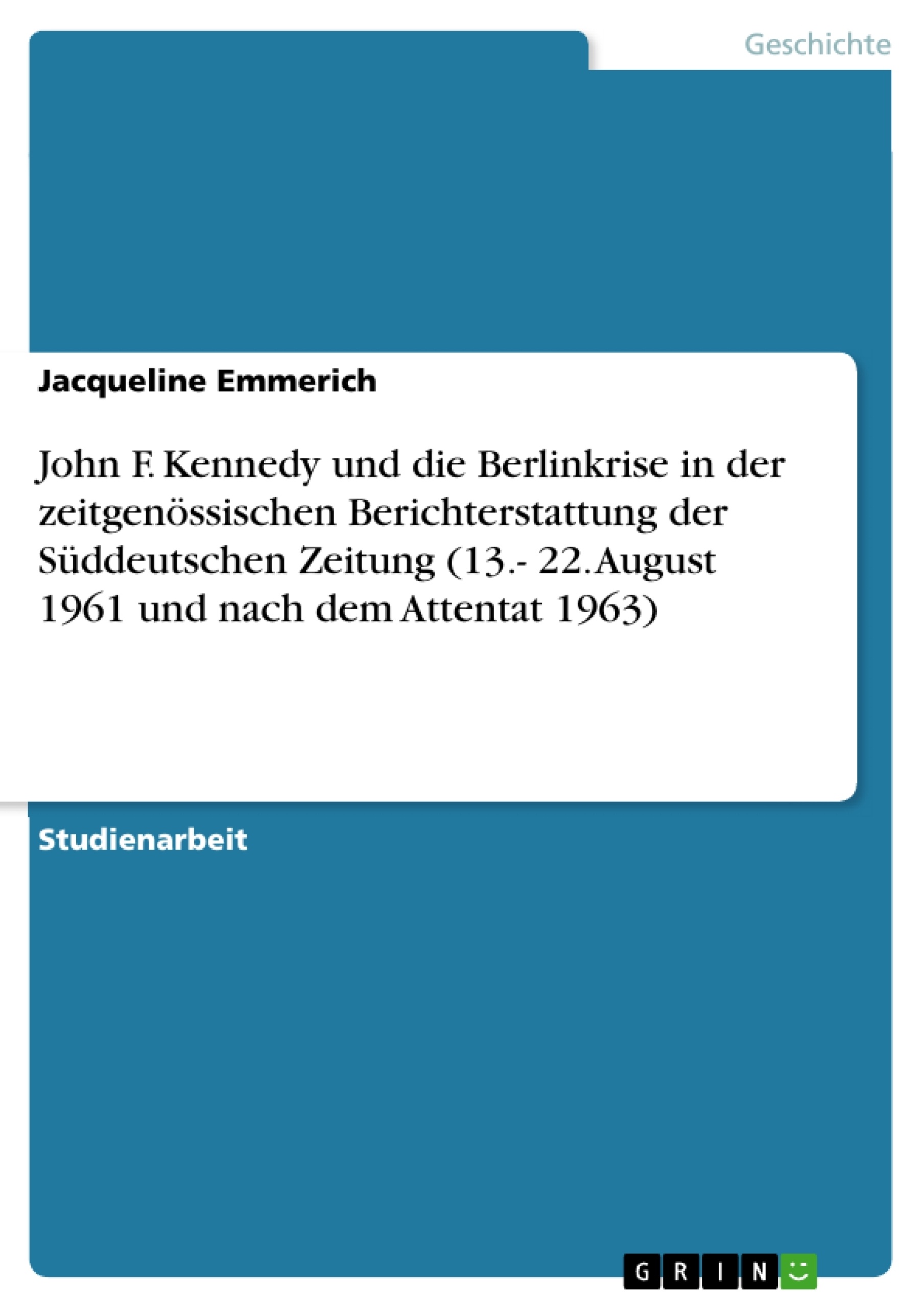Im vergangenen Jahr löste der Tod von Papst Johannes Paul II. weltweit nicht nur innerhalb der katholischen Glaubensgemeinschaft tiefe Trauer aus, ebenso pilgerten Millionen vornehmlich junger Nicht-Katholiken nach Rom. Und auch trotz der erzkonservativen Ansichten des ehemaligen Papstes bezüglich Sexualität u. ä, aufgrund derer er häufig der Kritik besonders der jungen Generationen ausgesetzt war, schien in den Tagen nach seinem Tod all diese vergessen, seine Heiligsprechung wurde gefordert.
Zwar mag ein Vergleich des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy mit Papst Johannes Paul II. gewagt erscheinen, doch ergeben sich bei näherer Betrachtung in der Tat Parallelen: So löste die Ermordung John F. Kennedys im November 1963 nicht nur Trauer und Bestürzung in der westlichen Welt aus, sondern auch in der UdSSR und den anderen Ostblock- Staaten zeigte man sich ehrlich betroffen. War auch Kennedys außenpolitisches Vorgehen besonders in Bezug auf Deutschland und der Berlinkrise von deutscher Seite heftig kritisiert worden, so ist hiervon nach seinem plötzlichen Tod kaum mehr etwas wahrzunehmen. Im Gegenteil: Nach Kennedys Erfolg in der Kubakrise 1962, neigte man noch zu seinen Lebzeiten auch in Deutschland zu dessen Glorifizierung als Retter der Welt.
Hat man sich jedoch eingehend mit der Geschichte und den Hintergründen der Berlinkrise beschäftigt, mag diese Tatsache etwas befremdlich wirken. Kennedy war nämlich der erste amerikanische Präsident, der erstmals direkt klar werden ließ, die deutsche Wiedervereinigung sei nicht das außenpolitische Primärziel der USA. Ferner scheute er sich nicht, in der Berlinkrise die Absperrung der östlichen Sektorengrenzen zu Gunsten eines Modus vivendi mit der UdSSR zu akzeptieren. Trotz dieses offenen „Verrates“ wurde der amerikanische Vizepräsident Lyndon B. Johnson eine Woche nach dem Mauerbau mit Jubel und Begeisterung von der Berliner Bevölkerung empfangen. Wie lässt sich dieser Widerspruch erklären, zumindest nachvollziehen? Zahlreiche Forschungen aus heutiger Zeit bieten aufgrund der Freigabe von immer neuen Akten zur Berlinkrise Auskunft über viele damals von der Öffentlichkeit unbemerkte Details und Entscheidungsvorgänge, die im Nachhinein Licht in diesen Widerspruch bringen. Dabei muss man sich aber stets der Tatsache bewusst sein, dass wir auch über alle weiteren Ereignisse und Konsequenzen der Berlinkrise Bescheid wissen und die Dinge somit aus der Rückschau bewerten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Vorgeschichte: Wahrnehmung der Ereignisse von Juni bis August 1961
- Die Woche vom 14. bis 22. August 1961: Berichterstattung und Beurteilung der Vorgänge
- Die Einschätzung von John F. Kennedy und der Berlinkrise nach dessen Tod und in Willy Brandts „Begegnungen mit Kennedy“
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die zeitgenössische Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung über die Berlinkrise im August 1961 und die sich im Nachhinein ergebende Bewertung John F. Kennedys. Ziel ist es, die öffentliche Wahrnehmung der Ereignisse und die Einschätzung Kennedys sowohl während als auch nach der Krise zu analysieren und die Widersprüche in der öffentlichen Meinung zu beleuchten.
- Analyse der Süddeutschen Zeitung Berichterstattung zur Berlinkrise.
- Die öffentliche Wahrnehmung von John F. Kennedy während und nach der Krise.
- Die Rolle der USA in der Berlinkrise und die deutsche Reaktion darauf.
- Der Vergleich der öffentlichen Meinung mit der heutigen Bewertung der Ereignisse.
- Die Widersprüche in der Bewertung Kennedys Handlungsweise.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Vergleich zwischen der Reaktion auf den Tod von Papst Johannes Paul II. und John F. Kennedy dar, um die scheinbar widersprüchliche Glorifizierung Kennedys trotz seiner umstrittenen Politik in der Berlinkrise zu beleuchten. Die Arbeit untersucht die zeitgenössische Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung um die öffentliche Meinung während der Krise zu rekonstruieren und die heutige Bewertung im Kontext der damaligen Ereignisse zu verstehen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Berichterstattung und der Einschätzung Kennedys und der Westmächte im August 1961 und nach Kennedys Tod.
2. Die Vorgeschichte: Wahrnehmung der Ereignisse von Juni bis August 1961: Dieses Kapitel analysiert die Vorgeschichte der Berlinkrise, beginnend mit Kennedys Rede vom 25. Juli 1961, die die "three essentials" für West-Berlin formulierte. Es beleuchtet die geheimen Denkschriften von Acheson und Kohler, die die Notwendigkeit einer Stärkung der US-Glaubwürdigkeit und die Notwendigkeit von Verhandlungen betonten, zugleich aber das Risiko eines Krieges wegen der deutschen Teilung vermieden werden sollte. Die Reaktion der Süddeutschen Zeitung auf Kennedys Rede wird analysiert, wobei die Betonung der Verhandlungsbereitschaft, der Rüstungsmaßnahmen und der fehlenden Kritik an Kennedys Kurs trotz Adenauers Skepsis hervorgehoben werden. Der Artikel unterstreicht die Beschränkung der amerikanischen Forderungen auf Westberlin und die öffentliche Akzeptanz dieser Garantie.
Schlüsselwörter
Berlinkrise, John F. Kennedy, Süddeutsche Zeitung, Zeitgenössische Berichterstattung, Willy Brandt, Mauerbau, Kalter Krieg, US-Außenpolitik, Deutsche Wiedervereinigung, Öffentliche Meinung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Süddeutschen Zeitung Berichterstattung über die Berlinkrise 1961
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung über die Berlinkrise im August 1961 und die nachträgliche Bewertung von John F. Kennedy. Der Fokus liegt auf der öffentlichen Wahrnehmung der Ereignisse und der Einschätzung Kennedys sowohl während als auch nach der Krise, inklusive der Widersprüche in der öffentlichen Meinung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Süddeutsche Zeitung Berichterstattung zur Berlinkrise, die öffentliche Wahrnehmung John F. Kennedys während und nach der Krise, die Rolle der USA und die deutsche Reaktion, einen Vergleich der damaligen öffentlichen Meinung mit der heutigen Bewertung und die Widersprüche in der Bewertung von Kennedys Vorgehensweise.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquelle ist die zeitgenössische Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung über die Berlinkrise im August 1961. Zusätzlich wird auf geheime Denkschriften von Acheson und Kohler und Willy Brandts „Begegnungen mit Kennedy“ Bezug genommen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Vorgeschichte (Juni-August 1961), ein Kapitel zur Berichterstattung in der Woche vom 14. bis 22. August 1961, ein Kapitel zur Einschätzung Kennedys nach dessen Tod und in Willy Brandts Erinnerungen und ein Resümee. Die Einleitung beleuchtet den scheinbar widersprüchlichen Umgang mit der Glorifizierung Kennedys trotz seiner umstrittenen Politik.
Was ist das zentrale Ergebnis des Kapitels zur Vorgeschichte?
Das Kapitel analysiert die Vorgeschichte der Krise, beginnend mit Kennedys Rede vom 25. Juli 1961. Es untersucht die Reaktionen auf diese Rede in der Süddeutschen Zeitung, die Betonung der Verhandlungsbereitschaft und die Akzeptanz der amerikanischen Garantie auf West-Berlin, trotz Adenauers Skepsis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Berlinkrise, John F. Kennedy, Süddeutsche Zeitung, Zeitgenössische Berichterstattung, Willy Brandt, Mauerbau, Kalter Krieg, US-Außenpolitik, Deutsche Wiedervereinigung, Öffentliche Meinung.
Welche Vergleichsperspektive wird verwendet?
Die Einleitung stellt einen Vergleich zwischen der Reaktion auf den Tod von Papst Johannes Paul II. und John F. Kennedy dar, um die scheinbar widersprüchliche Glorifizierung Kennedys zu beleuchten.
Welchen Zeitraum umfasst die Analyse?
Die Analyse umfasst den Zeitraum von Juni bis August 1961 und betrachtet die Langzeitwirkung der Berlinkrise auf die Bewertung Kennedys.
- Quote paper
- Jacqueline Emmerich (Author), 2006, John F. Kennedy und die Berlinkrise in der zeitgenössischen Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung (13.- 22. August 1961 und nach dem Attentat 1963), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56237