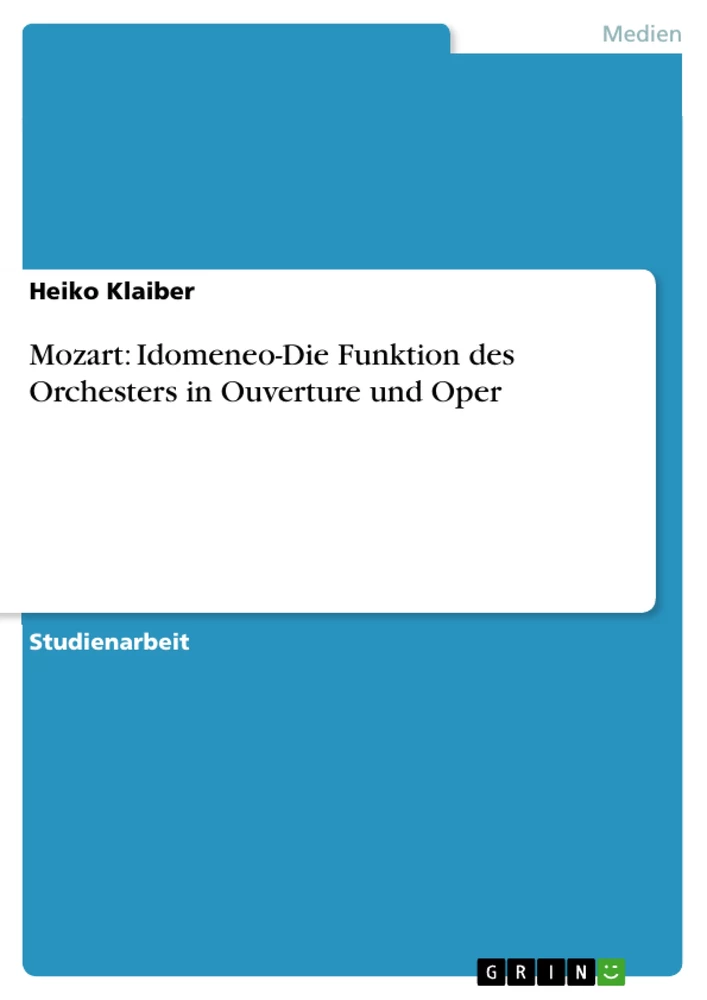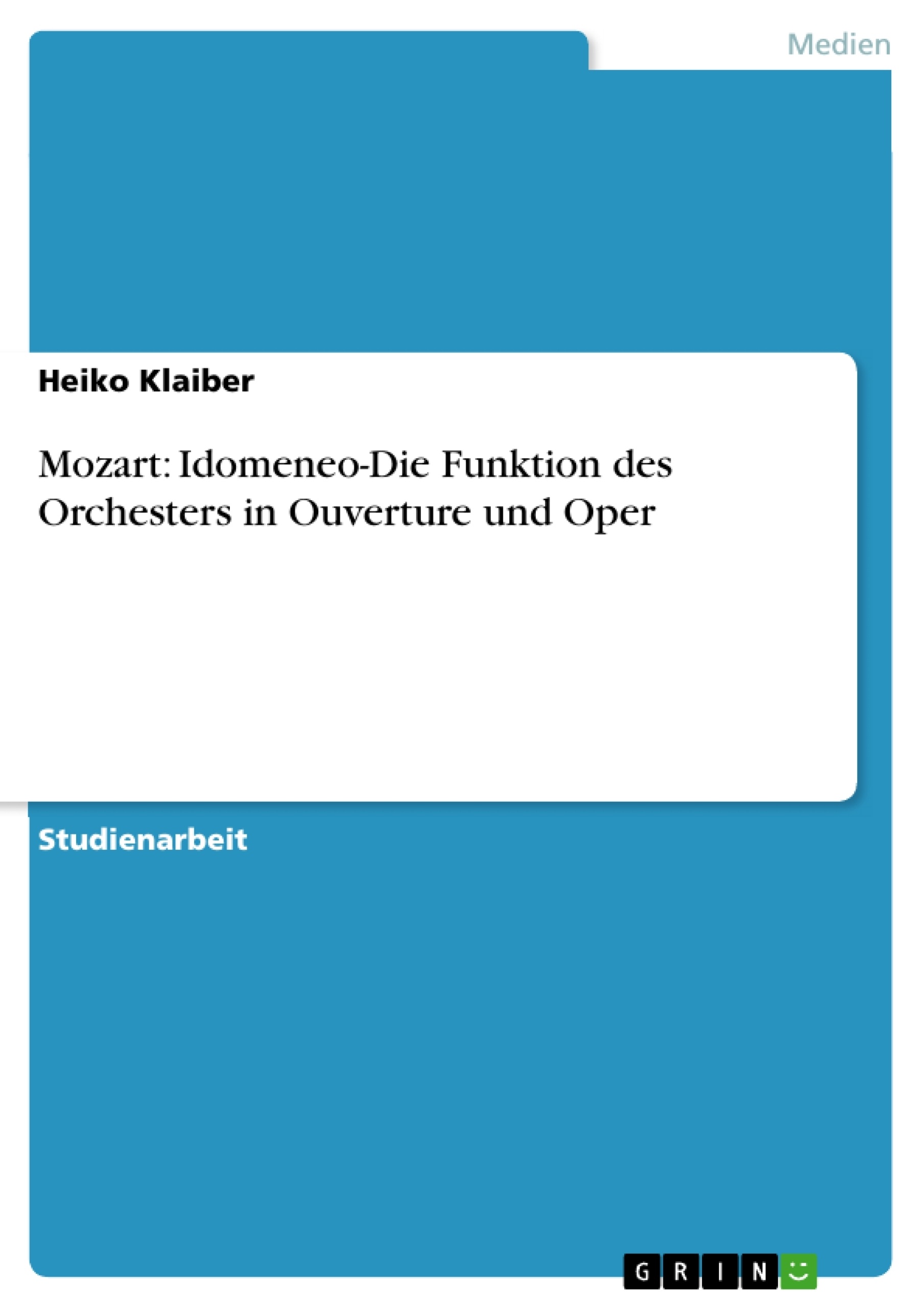Nirgendwo anders konnte Wolfgang Amadeus Mozart, die ihn bedrückende Dichte seiner musikalischen Empfindungen so nach außen projizieren, wie in der Gattung der Oper.
Im Sommer 1780 erhielt Mozart den sehnlichst erwarteten Auftrag für München eine Opera seria zu komponieren. Die Oper „Idomeneo“ wurde schließlich am 29. Januar des folgenden Jahres 1781 uraufgeführt. Das Drama handelt von Idomeneo, König von Kreta, den Neptun vor einem Schiffbruch bewahrt und ihm Idomeneo dafür gelobt, die erste Person zu opfern, die ihm bei seiner Landung begegnet. Wie es das Schicksal will, trifft er bei seiner Ankunft auf seinen Sohn Idamantes.
Die Oper „Idomeneo“, welche für Johannes Brahms ein Wunderwerk darstellte, ist reich und voll von „Mozartschen Ideen“ und stellt die würdige Nachbarin zu der „Entführung aus dem Serail“ dar, von der sie nur anderthalb Jahre trennen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Das Münchner „Idomeneo“-Orchester von 1781
- Die Besetzung des Münchner „Idomeneo“-Orchesters
- Die Ouverturen bis zum Idomeneo
- Die Ouverture des Idomeneo und die Funktion des Orchesters
- Die Heroische Fanfare
- Das Streicher- und Bläsermotiv
- Das Klagemotiv
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktion des Orchesters in Mozarts Oper „Idomeneo“, insbesondere in der Ouvertüre. Ziel ist es, die Rolle des Orchesters im Kontext der Opera seria der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu beleuchten und die Besonderheiten der Münchner Aufführung von 1781 herauszuarbeiten.
- Das Münchner „Idomeneo“-Orchester von 1781 und seine Zusammensetzung
- Der Vergleich der Idomeneo-Ouvertüre mit vorhergehenden Ouvertüren Mozarts
- Die musikalischen Motive der Ouvertüre und ihre Bedeutung für die Oper
- Die erweiterte Rolle des Orchesters in der Opera seria
- Mozarts Zusammenarbeit mit dem Orchester und dessen Einfluss auf die Komposition
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einleitung beschreibt Mozarts besondere Verbindung zur Oper und den Auftrag für die Komposition von „Idomeneo“ in München. Sie stellt die Oper kurz vor, erwähnt ihre Bedeutung für Brahms und ihre Nähe zur „Entführung aus dem Serail“. Die Einführung legt den Fokus auf die einzigartige Rolle des Orchesters in „Idomeneo“ und kündigt die anschließende Analyse an.
Das Münchner „Idomeneo“-Orchester von 1781: Dieses Kapitel beleuchtet die Zusammensetzung des Orchesters für die Uraufführung in München. Es beschreibt die Fusion des Mannheimer und Münchner Orchesters im Kontext der Übersiedlung des Kurfürsten Karl Theodor. Der hohe Standard des Orchesters und Mozarts Begeisterung darüber werden hervorgehoben, inklusive detaillierter Einblicke aus Mozarts Briefen an seinen Vater. Die bestehende Freundschaft zwischen Mozart und einigen Musikern des Mannheimer Orchesters wird als wichtiger Faktor für den Entstehungsprozess der Oper hervorgehoben.
Die Besetzung des Münchner „Idomeneo“-Orchesters: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Besetzung des Orchesters für „Idomeneo“: zwei Flöten, eine Piccoloflöte, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte, vier Hörner, zwei Trompeten, Pauken, Streicher (zwölf Geigen, drei Bratschen, drei Celli, zwei Kontrabässe) und Cembalo. Es wird die Größe und die Qualität des Orchesters betont, sowie die hohen Anforderungen, die Mozart an die Musiker stellte, was durch Zitate aus Briefen von Leopold Mozart belegt wird. Die harmonische Zusammenarbeit zwischen Mozart und dem Orchester während der Proben wird ebenfalls erwähnt.
Schlüsselwörter
W. A. Mozart, Idomeneo, Opera seria, Orchester, München, 1781, Ouvertüre, Mannheimer Orchester, Mozarts Briefe, Instrumentalbesetzung, musikalische Motive.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des Orchesters in Mozarts Idomeneo
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Rolle des Orchesters in Mozarts Oper "Idomeneo", insbesondere in der Ouvertüre, im Kontext der Opera seria des späten 18. Jahrhunderts und konzentriert sich auf die Münchner Aufführung von 1781.
Welche Aspekte des Idomeneo-Orchesters werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Zusammensetzung des Münchner Orchesters von 1781, einen Vergleich der Idomeneo-Ouvertüre mit früheren Werken Mozarts, die musikalischen Motive der Ouvertüre und deren Bedeutung, die erweiterte Rolle des Orchesters in der Opera seria und Mozarts Zusammenarbeit mit dem Orchester.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einführung, Kapitel über das Münchner "Idomeneo"-Orchester von 1781, dessen Besetzung, die Ouvertüren vor Idomeneo, eine detaillierte Analyse der Idomeneo-Ouvertüre (inklusive der Heroischen Fanfare, des Streicher- und Bläsermotivs und des Klagemotivs) und eine Schlussbetrachtung. Zusätzlich werden Zielsetzung, Themenschwerpunkte, und Kapitelzusammenfassungen bereitgestellt.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Analyse stützt sich auf Informationen über die Zusammensetzung des Orchesters, detaillierte Besetzungslisten, Mozarts Briefe an seinen Vater und einen Vergleich mit vorhergehenden Ouvertüren Mozarts.
Welche Rolle spielte das Mannheimer Orchester?
Das Kapitel über das Münchner "Idomeneo"-Orchester von 1781 hebt die Fusion des Mannheimer und Münchner Orchesters im Kontext der Übersiedlung des Kurfürsten Karl Theodor hervor. Die bestehende Freundschaft zwischen Mozart und einigen Musikern des Mannheimer Orchesters wird als wichtiger Faktor für den Entstehungsprozess der Oper betont.
Welche musikalischen Motive werden in der Ouvertüre analysiert?
Die Analyse der Idomeneo-Ouvertüre beinhaltet eine detaillierte Betrachtung der Heroischen Fanfare, des Streicher- und Bläsermotivs sowie des Klagemotivs.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: W. A. Mozart, Idomeneo, Opera seria, Orchester, München, 1781, Ouvertüre, Mannheimer Orchester, Mozarts Briefe, Instrumentalbesetzung, musikalische Motive.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke konzipiert und dient der Analyse von Themen in einer strukturierten und professionellen Art und Weise.
- Quote paper
- Heiko Klaiber (Author), 2004, Mozart: Idomeneo-Die Funktion des Orchesters in Ouverture und Oper, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56210