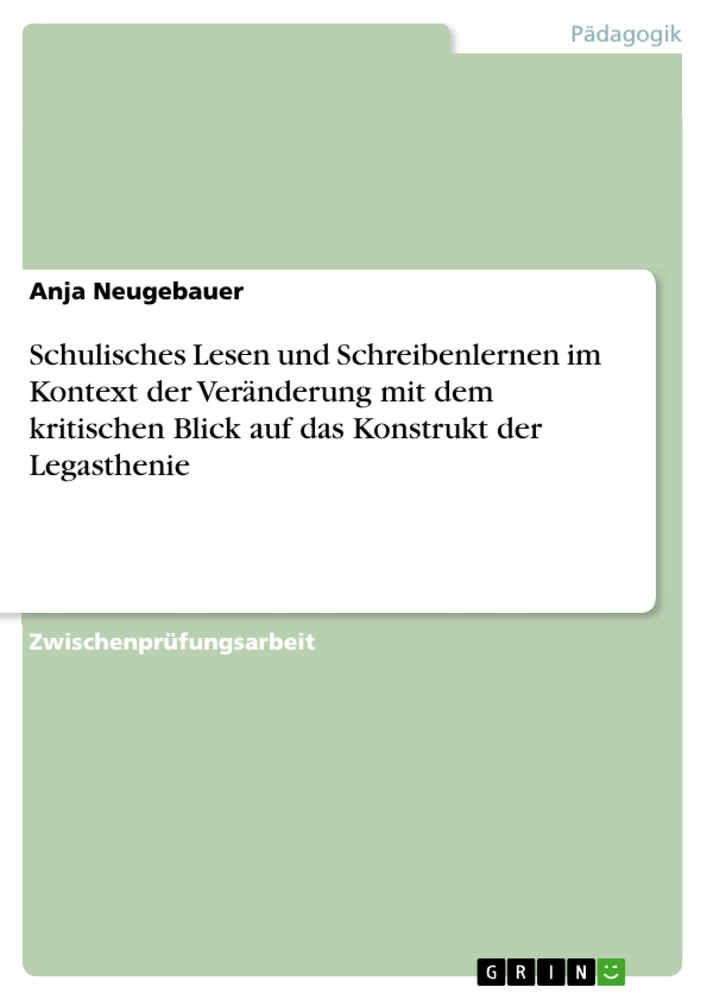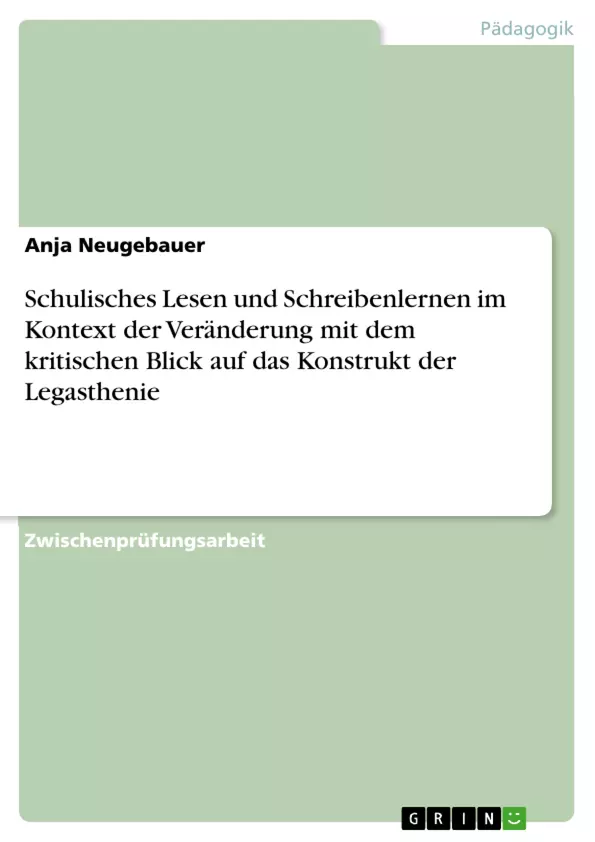Schriftsprache begegnet uns immer und überall. Wer Lesen und Schreiben gelernt hat, kann sich kaum noch vorstellen, es nicht zu können. Der Mensch neigt dazu, Schriftzeichen entziffern zu wollen und sei es noch so uninteressant. Jeder kennt diesen Drang, wenn man in der U-Bahn sitzt und eine Reklametafel direkt neben sich leuchten sieht. Man muss einfach wissen, welche Botschaft diese uns vermitteln möchte und beginnt zu lesen.
Kinder bekommen dieses Verhalten schon sehr früh mit. Allerdings ist die Schriftsprache eines von vielen Rätseln dieser Welt, die sie ergründen wollen. Einige schaffen dies ansatzweise schon vor dem Schuleintritt, während andere in den ersten Schuljahren und auch noch länger erhebliche Probleme haben, jenes zu lernen, was doch so einfach und selbstverständlich erscheint. Da jedoch dem Lesen und Schreiben in unserer heutigen Gesellschaft eine große Bedeutung beigemessen wird, haben Kinder mit Lese- und Rechtschreiblernproblemen eine sehr ungünstige Ausgangssituation, denn in der Schule wird das Wissen hauptsächlich über die Schriftsprache vermittelt. Dadurch ist ein Abrutschen schon in den ersten Klassenstufen regelrecht vorprogrammiert. Dies kann sich in eine Spirale verwandeln und eine Gefährdung der schulischen, beruflichen sowie sozialen Integration bedeuten, denn die Fähigkeiten des Lesens und Schreibens werden als selbstverständlich vorausgesetzt. Werden nicht frühzeitig Fördermaßnahmen veranlasst, so führt dies schnell zu Enttäuschung und beeinträchtigt häufig das Selbstbewusstsein vieler Schüler.
In dieser Arbeit möchte ich das Problem des Lesens und teilweise auch des Schreibens aufgreifen. Welche Ausgangsituationen beeinflussen das Lesenlernen? Wie muss der Unterricht gestaltet sein und wie muss sich der Unterricht verändern, damit ein Kind unter den günstigsten Bedingungen lernt? Wie kann man Lese- und Schreibschwierigkeiten vorbeugen? Welche Bedeutung hat der Legastheniebegriff auf die Entwicklung eines Kindes und ist dieser überhaupt gerechtfertigt?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- Teil I: Lesen und Schreiben im schulischen Alltag
- 2. Definitionen
- 2.1. Definition Lesen
- 2.2. Definition Schreiben
- 3. Geschichte des Lesens
- 4. Bedeutung des Lesens
- 5. Voraussetzungen für das Lesen- und Schreibenlernen
- 6. Fähigkeiten beim Lesen und Schreiben
- 7. Verschiedene Methoden des Lesenlernens
- 7.1. Überblick über die Leselehrmethoden
- 7.2. Die synthetischen Verfahren
- 7.2.1. Die Buchstabiermethode
- 7.2.2. Die Lautiermethode
- 7.2.3. Kritische Zusammenfassung
- 7.3. Das analytische Verfahren
- 7.3.1. Die Ganzheitsmethode
- 7.3.2. Kritische Zusammenfassung
- 7.4. Methodenintegration
- 8. Gründe für das Auftreten von Lese- und Schreibschwierigkeiten
- 8.1. Probleme durch allgemeine Faktoren
- 8.2. Probleme aufgrund sozialer Herkunft
- 9. Leseunterricht gestalten
- 10. Unterricht verändern
- 11. Lernen aus Fehlern
- 12. Prävention
- Teil II: Legasthenie und seine Kritik
- 13. Legasthenie
- 14. Definition von Legasthenie
- 15. Der schwankende und inkonsistente Legastheniebegriff (Position von Jörg Schlee)
- 16. Standpunkt von Hans Brügelmann
- 16.1. Erlass zu Förderung von Schülern mit besonderen Schwierigkeiten beim Lernen des Lesens und Rechtschreibens
- 16.1.1. Klassifizierung von Lernschwierigkeiten
- 16.1.2. Legastheniekonzept aus psychologischer Sicht
- 16.1.3. Legasthenie als Krankheit
- 16.1.4. Zusammenfassung
- 16.2. Allgemeiner Blick auf Legasthenie
- 17. Position von Renate Valtin
- 18. Kritische Bemerkung zum Umgang mit Legasthenikern
- 19. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen des Lese- und Schreiblernens im schulischen Kontext und setzt sich kritisch mit dem Konstrukt der Legasthenie auseinander. Sie beleuchtet die Bedeutung des Lesens in unserer Gesellschaft, verschiedene Leselehrmethoden und die Ursachen von Lese- und Schreibschwierigkeiten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Gestaltung effektiven Leseunterrichts und präventiven Maßnahmen.
- Definition und Entwicklung des Lesens und Schreibens
- Methoden des Leseunterrichts und deren kritische Bewertung
- Ursachen von Lese- und Schreibschwierigkeiten
- Der Legastheniebegriff: Definition und Kritik
- Förderung und Prävention von Lese- und Schreibschwierigkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Bedeutung des Lesens und Schreibens in unserer Gesellschaft. Sie hebt die Schwierigkeiten von Kindern beim Erlernen dieser Fähigkeiten hervor und benennt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit, welcher in zwei Teile gegliedert ist: Teil I konzentriert sich auf Lesen und Schreiben im schulischen Alltag, Teil II auf die Legasthenie und deren Kritik. Die Autorin kündigt an, verschiedene Leselehrmethoden zu analysieren und die Ursachen von Lese- und Schreibschwierigkeiten zu untersuchen, sowie präventive Maßnahmen zu beleuchten und den Legastheniebegriff kritisch zu hinterfragen. Der Bezug zu eigenen Erfahrungen mit Grundschulkindern wird erwähnt.
Teil I: Lesen und Schreiben im schulischen Alltag: Dieser Teil beleuchtet umfassend den Prozess des Lesen- und Schreibenlernens im Kontext der Schule. Er definiert die Begriffe "Lesen" und "Schreiben", betrachtet die historische Entwicklung des Lesens, betont seine gesellschaftliche Bedeutung und analysiert die notwendigen Voraussetzungen und Fähigkeiten. Verschiedene Leselehrmethoden, sowohl synthetische (Buchstabiermethode, Lautiermethode) als auch analytische (Ganzheitsmethode), werden vorgestellt und kritisch bewertet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Ursachen von Lese- und Schreibschwierigkeiten, die sowohl allgemeine als auch sozial bedingte Faktoren berücksichtigen. Der Teil schließt mit Überlegungen zur Gestaltung effektiven Leseunterrichts, zur Bedeutung des Lernens aus Fehlern und zu präventiven Maßnahmen.
Teil II: Legasthenie und seine Kritik: Dieser Teil befasst sich kritisch mit dem Konstrukt der Legasthenie. Nach einer Definition des Begriffs wird die Kritik von Jörg Schlee an der schwankenden und inkonsistenten Verwendung des Begriffs dargelegt. Der Standpunkt von Hans Brügelmann wird vorgestellt, der den "Erlass zur Förderung von Schülern mit besonderen Schwierigkeiten beim Lernen des Lesens und Rechtschreibens" unter Berücksichtigung verschiedener Perspektiven (Klassifizierung von Lernschwierigkeiten, psychologische Sicht, medizinischer Aspekt) bewertet. Die Position von Renate Valtin wird erläutert. Der Teil endet mit kritischen Bemerkungen zum Umgang mit Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten.
Schlüsselwörter
Lesen, Schreiben, Leselehrmethoden, Lese- und Schreibschwierigkeiten, Legasthenie, Leseunterricht, Prävention, Förderung, Schule, Sozialer Kontext.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Lesen und Schreiben lernen - Legasthenie und ihre Kritik
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Lesen und Schreiben lernen, inklusive der Schwierigkeiten und Herausforderungen im schulischen Kontext. Es beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Legasthenie und beleuchtet verschiedene Aspekte des Lese- und Schreiblernprozesses, von der Definition und Geschichte des Lesens über verschiedene Lehrmethoden bis hin zu Präventionsmaßnahmen und der Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten.
Welche Themen werden im ersten Teil des Dokuments behandelt?
Teil I konzentriert sich auf Lesen und Schreiben im schulischen Alltag. Hier werden Lesen und Schreiben definiert, die Geschichte des Lesens betrachtet und die Bedeutung des Lesens hervorgehoben. Voraussetzungen und Fähigkeiten für das Lesen und Schreibenlernen werden analysiert, und verschiedene Leselehrmethoden (synthetische und analytische Verfahren) werden detailliert beschrieben und kritisch bewertet. Die Ursachen von Lese- und Schreibschwierigkeiten (allgemeine und sozial bedingte Faktoren) werden untersucht, und es werden Vorschläge zur Gestaltung effektiven Leseunterrichts, zum Lernen aus Fehlern und zu Präventionsmaßnahmen gemacht.
Worum geht es im zweiten Teil des Dokuments?
Teil II befasst sich kritisch mit dem Konstrukt der Legasthenie. Der Begriff wird definiert, und die Kritik an der schwankenden und inkonsistenten Verwendung des Begriffs wird diskutiert. Die Standpunkte von verschiedenen Experten (z.B. Jörg Schlee, Hans Brügelmann, Renate Valtin) werden vorgestellt und verglichen. Der Umgang mit Kindern, die Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten haben, wird kritisch hinterfragt.
Welche Leselehrmethoden werden im Dokument beschrieben?
Das Dokument beschreibt sowohl synthetische als auch analytische Leselehrmethoden. Zu den synthetischen Methoden gehören die Buchstabiermethode und die Lautiermethode. Die analytische Methode wird durch die Ganzheitsmethode repräsentiert. Jede Methode wird detailliert erläutert und kritisch bewertet.
Welche Ursachen für Lese- und Schreibschwierigkeiten werden genannt?
Das Dokument unterscheidet zwischen allgemeinen Faktoren und sozial bedingten Faktoren, die zu Lese- und Schreibschwierigkeiten führen können. Allgemeine Faktoren können z.B. neurologische oder kognitive Einschränkungen sein, während soziale Faktoren den Einfluss von sozialer Herkunft und Umfeld umfassen.
Wie wird der Begriff "Legasthenie" im Dokument behandelt?
Der Begriff "Legasthenie" wird kritisch hinterfragt. Das Dokument präsentiert verschiedene Definitionen und Perspektiven auf Legasthenie und diskutiert die Inkonsistenzen in der Verwendung des Begriffs. Es werden die Standpunkte verschiedener Experten vorgestellt, die unterschiedliche Ansichten zur Definition, Diagnose und Behandlung von Legasthenie vertreten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Lesen, Schreiben, Leselehrmethoden, Lese- und Schreibschwierigkeiten, Legasthenie, Leseunterricht, Prävention, Förderung, Schule, Sozialer Kontext.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, das Dokument enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, inklusive Einleitung und der beiden Hauptteile (Lesen und Schreiben im schulischen Alltag und Legasthenie und ihre Kritik).
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument richtet sich an alle, die sich mit den Themen Lesen, Schreiben, Legasthenie und deren didaktische Umsetzung auseinandersetzen möchten. Es ist insbesondere für Lehrende, Studierende der Pädagogik und interessierte Eltern von Schulkindern relevant.
- Quote paper
- Anja Neugebauer (Author), 2006, Schulisches Lesen und Schreibenlernen im Kontext der Veränderung mit dem kritischen Blick auf das Konstrukt der Legasthenie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56097