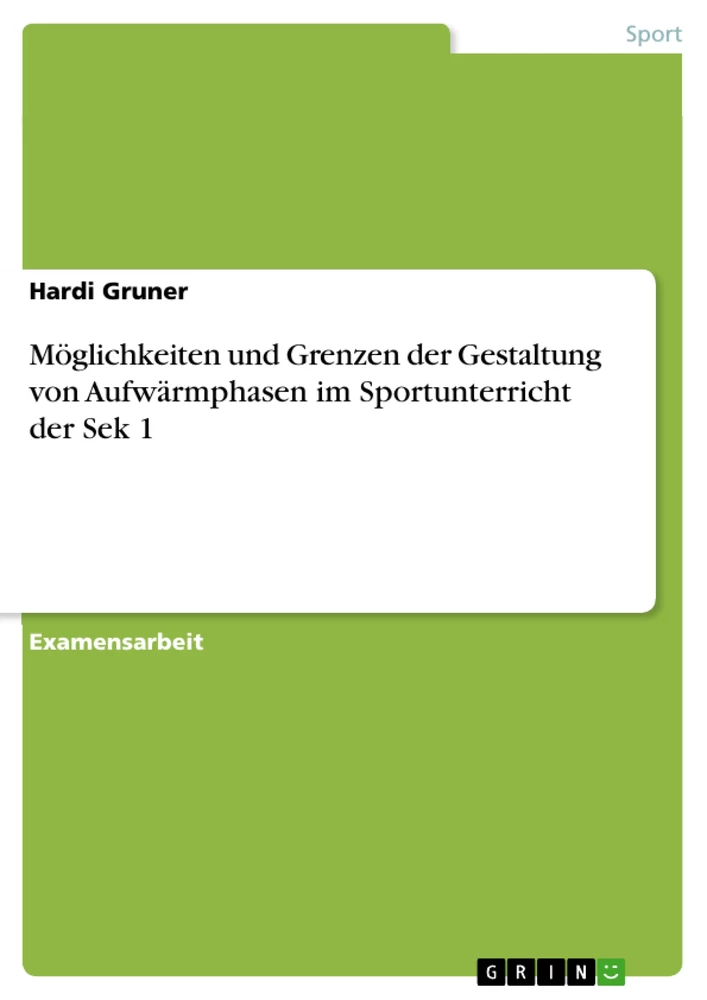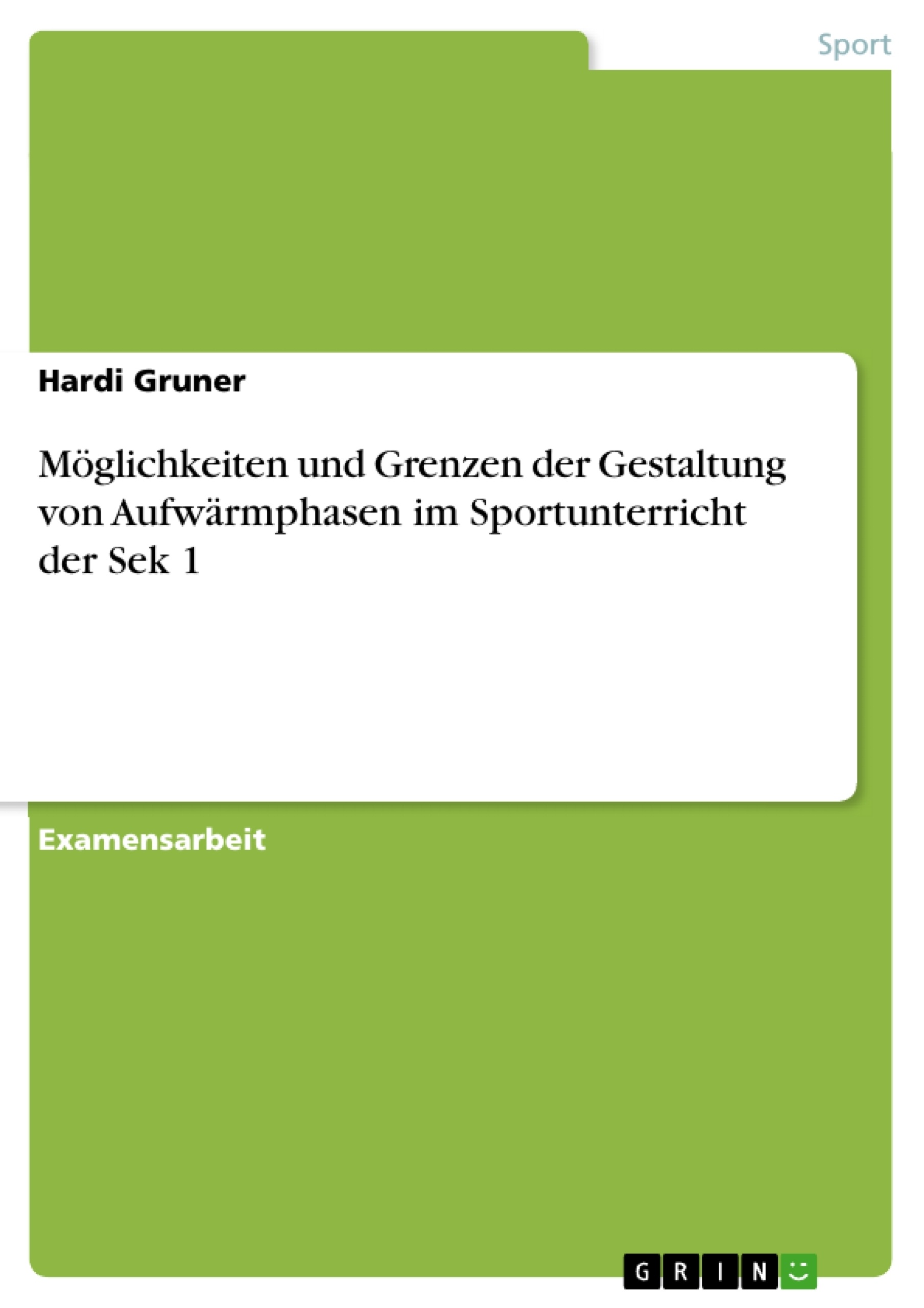Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit zwei Bereichen der Erwärmung im Sport: einem theoretischen Teil, der die Hintergründe und Meßmethoden des Aufwärmens beschreibt und auf biologische Prozesse im Körper eingeht und einem praktisch durchgeführten Teil, der mit empirischen Mitteln die Inhalte und Formen des Aufwärmens, unter Einbeziehung von Körperkerntemperatur- und Herzfrequenzmessungen, durchleuchtet. Die Entscheidung für diese Problemstellung läßt sich leicht erklären. Während meiner eigenen Schulzeit nahm ich auch aktiv am Vereinssport teil. Stellte man nun Vergleiche zwischen der Aufwärmarbeit in der Schule und der im Verein an, konnte man deutliche Unterschiede entdecken, die nicht nur im Bereich der praktischen Durchführung, sondern auch im Bereich der Motivation deutlich wurden. Nach Beendigung meiner Schulzeit besuchte ich einige Male meine Sportlehrer. Bei dieser Gelegenheit sprachen wir über meine Erfahrungen, worauf sie antworteten, daß es vielfältige Probleme im Bereich des Schulsports gäbe und somit ein effektives Aufwärmen kaum möglich sei. Hieraus entwickelte sich die Problemstellung für die nachfolgende Arbeit, in der es um eine Begutachtung der Aufwärmarbeit im Schulsport und den Versuch einer Optimierung geht.
Der oben bereits erwähnte erste Teil ist eine theoretische Abhandlung zum Bereich des Aufwärmens. Hier soll ein Einblick gegeben werden, was Aufwärmen überhaupt ist, was es bezweckt, welche Prozesse im Körper ablaufen, was zu beachten ist, auch hinsichtlich des schulischen Bereiches. Es wird in diesem Abschnitt auf die sportartspezifisch zu erwärmenden Muskelbereiche und Meßmethoden zur Überprüfung des Aufwärmgrades eingegangen. Die Angaben in diesem ersten Bereich der Arbeit beruhen größtenteils auf der Literatur der Sportmedizin und der Trainingslehre, aber auch auf diverse, schriftliche und persönliche Kontaktierungen verschiedener Ärzte und Trainer. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Observierung und Durchführung von Aufwärmphasen in sechs verschiedenen Klassen an zwei Dortmunder Schulen. Um eine Einschätzung der Schüler in Hinsicht auf die sportlichen Fähigkeiten vornehmen zu können, wird von jedem Schüler ein Fragebogen ausgefüllt, der seine außerschulischen Aktivitäten dokumentiert, und somit eine grobe Einschätzung ermöglichen soll. Die Aufwärmphasen werden durch ausführliche Verlaufsbeschreibungen vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Problemdarstellung. Begründung der Themenwahl
- Aufbau und Vorgehensweise
- Aufwärmen
- Sinn und Zweck des Aufwärmens
- Was passiert im Körper?
- Auswirkungen des Aufwärmens auf die Muskulatur
- Auswirkungen des Aufwärmens auf das Kapsel-, Band-, Sehnen- und Knorpelgewebe
- Auswirkungen des Aufwärmens auf die Körpertemperatur
- Auswirkungen des Aufwärmens auf das Herz-Kreislauf-System
- Auswirkungen des Aufwärmens auf die nervösen Systeme
- Auswirkungen des Aufwärmens auf die Psyche
- Was für Arten / Bestandteile des Aufwärmens gibt es?
- Aktives, funktionelles Aufwärmen
- Das allgemeine Aufwärmen
- Das spezielle Aufwärmen
- Das individuelle Aufwärmen
- Passives Aufwärmen
- Mentales Aufwärmen
- Aktives, funktionelles Aufwärmen
- Auf was ist beim Aufwärmen zu achten?
- Wichtige Grundsätze
- Dauer des Aufwärmens
- Aufwärmen in der Schule, mit Kindern und Jugendlichen
- Externe Faktoren / schulische Voraussetzungen
- Methoden zur Messung des Aufwärmgrades / der Effektivität des Aufwärmprogramms
- Vorüberlegungen zum empirischen Teil
- Schulwahl Klassenwahl
- Fragebögen
- Fragebogen 1: Übersicht über den Leistungsstand der Schüler
- Fragebogen 2: Fragen zur Beurteilung des jeweils durchgeführten Aufwärmprogramms an den Schüler.
- Fragebogen 3: Fragen zur Beurteilung des jeweils durchgeführten Aufwärmprogramms an den Lehrer
- Meßmethoden
- Angewandte vorbereitende Dehnübungen – eine bildliche Auswahl
- Klassenvorstellung und durchgeführte Aufwärmprogramme
- Die Klasse 7d der Wilhelm-Röntgen-Realschule
- Bedingungsanalyse der Klasse 7d WRR
- Vom Lehrer durchgeführte Aufwärmphase
- Darstellung und Analyse der eigenständig durchgeführten Aufwärmprogramme
- Aufwärmprogramm vom 17.03.99
- Aufwärmprogramm vom 24.03.99
- Aufwärmprogramm vom 14.04.99
- Die Klasse 8b des Bert-Brecht-Gymnasiums
- Bedingungsanalyse der Klasse 8b BBG
- Vom Lehrer durchgeführte Aufwärmprogramme
- Darstellung und Analyse der eigenständig durchgeführten Aufwärmprogramme
- Aufwärmprogramm vom 19.02.99
- Aufwärmprogramm vom 26.02.99
- Aufwärmprogramm vom 05.03.99
- Aufwärmprogramm vom 12.03.99
- Aufwärmprogramm vom 19.03.99
- Aufwärmprogramm vom 26.03.99
- Die Klassen 8c/d der Wilhelm-Röntgen-Realschule
- Bedingungsanalyse der Klassen 8c/d WRR
- Vom Lehrer durchgeführte Aufwärmprogramme
- Darstellung und Analyse der eigenständig durchgeführten Aufwärmprogramme
- Aufwärmprogramm vom 23.04.99
- Die Klasse 9d des Bert-Brecht-Gymnasiums
- Bedingungsanalyse der Klasse 9d BBG
- Vom Lehrer durchgeführte Aufwärmprogramme
- Darstellung und Analyse der eigenständig durchgeführten Aufwärmprogramme
- Aufwärmprogramm vom 18.02.99
- Aufwärmprogramm vom 25.02.99
- Aufwärmprogramm vom 04.03.99
- Aufwärmprogramm vom 11.03.99
- Aufwärmprogramm vom 18.03.99
- Die Klassen 10b/c der Wilhelm-Röntgen-Realschule
- Bedingungsanalysen der Klassen 10b/c WRR
- Vom Lehrer durchgeführte Aufwärmprogramme
- Darstellung und Analyse der eigenständig durchgeführten Aufwärmprogramme
- Aufwärmprogramm vom 12.04.99
- Die Klasse 10d des Bert-Brecht-Gymnasiums
- Bedingungsanalyse der Klasse 10d BBG
- Vom Lehrer durchführte Aufwärmprogramme
- Darstellung und Analyse der eigenständig durchgeführten Aufwärmprogramme
- Aufwärmprogramm vom 05.03.99
- Aufwärmprogramm vom 12.03.99
- Aufwärmprogramm vom 19.03.99
- Aufwärmprogramm vom 26.03.99
- Die Klasse 7d der Wilhelm-Röntgen-Realschule
- Diskussion der Ergebnisse
- Kritische Wertung der Ergebnisse und Methoden
- Bezug von Zielen und Hypothesen zum Ergebnis
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Möglichkeiten und Grenzen der Gestaltung von Aufwärmphasen im Sportunterricht der Sekundarstufe I. Ziel ist es, praktische Empfehlungen für die Gestaltung effektiver Aufwärmprogramme zu entwickeln und deren Umsetzung im Schulalltag zu beleuchten.
- Physiologische Auswirkungen des Aufwärmens
- Methoden des aktiven und passiven Aufwärmens
- Didaktische Gestaltung von Aufwärmprogrammen im Schulsport
- Empirische Untersuchung der Effektivität verschiedener Aufwärmprogramme
- Berücksichtigung individueller und schulischer Bedingungen
Zusammenfassung der Kapitel
Problemdarstellung. Begründung der Themenwahl: Dieses einleitende Kapitel beschreibt die Relevanz des Themas Aufwärmen im Schulsport und begründet die Wahl des Themas. Es skizziert die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit.
Aufwärmen: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über das Aufwärmen im Sport. Es beleuchtet den Sinn und Zweck, die physiologischen Auswirkungen auf Muskulatur, Kapsel-Band-Sehnen-Gewebe, Körpertemperatur, Herz-Kreislauf-System und Psyche. Verschiedene Arten des Aufwärmens (aktiv, passiv, mental) werden detailliert dargestellt und wichtige Grundsätze sowie die Dauer des Aufwärmens werden diskutiert. Besondere Berücksichtigung findet das Aufwärmen im Kontext der Schule mit Kindern und Jugendlichen, inklusive externer Faktoren und Methoden zur Messung der Effektivität.
Vorüberlegungen zum empirischen Teil: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es erläutert die Auswahl der Schulen und Klassen, die verwendeten Fragebögen (zur Erfassung des Leistungsstands der Schüler und zur Beurteilung der Aufwärmprogramme aus Schüler- und Lehrerperspektive) und die angewandten Messmethoden. Die Auswahl vorbereitender Dehnübungen wird bildlich dargestellt.
Schlüsselwörter
Aufwärmen, Schulsport, Sekundarstufe I, Physiologie, Didaktik, Empirie, Aufwärmprogramme, Schüler, Lehrer, Effektivität, Methoden, Bewegung, Körpertemperatur, Herz-Kreislauf-System, Muskulatur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Gestaltung von Aufwärmphasen im Sportunterricht der Sekundarstufe I
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Gestaltung von Aufwärmphasen im Sportunterricht der Sekundarstufe I. Sie untersucht Möglichkeiten und Grenzen effektiver Aufwärmprogramme und deren Umsetzung im Schulalltag.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die Entwicklung praktischer Empfehlungen für die Gestaltung effektiver Aufwärmprogramme und die Beleuchtung deren Umsetzung im Schulalltag. Die Arbeit analysiert die physiologischen Auswirkungen des Aufwärmens und die didaktische Gestaltung von Aufwärmprogrammen im Schulsport unter Berücksichtigung individueller und schulischer Bedingungen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die physiologischen Auswirkungen des Aufwärmens, Methoden des aktiven und passiven Aufwärmens, die didaktische Gestaltung von Aufwärmprogrammen im Schulsport, eine empirische Untersuchung der Effektivität verschiedener Aufwärmprogramme und die Berücksichtigung individueller und schulischer Bedingungen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in verschiedene Kapitel: Problemdarstellung und Begründung der Themenwahl, ein umfassendes Kapitel zum Aufwärmen (Sinn, Zweck, physiologische Auswirkungen, Arten des Aufwärmens), Vorüberlegungen zum empirischen Teil (Methoden, Fragebögen, Schul- und Klassenwahl), die Vorstellung der untersuchten Klassen und der durchgeführten Aufwärmprogramme, die Diskussion der Ergebnisse und eine Zusammenfassung mit Ausblick.
Welche Methoden wurden im empirischen Teil angewendet?
Im empirischen Teil wurden verschiedene Schulen und Klassen ausgewählt. Es wurden Fragebögen eingesetzt, um den Leistungsstand der Schüler zu erfassen und die Aufwärmprogramme aus Schüler- und Lehrerperspektive zu beurteilen. Zusätzlich wurden Messmethoden angewendet und vorbereitende Dehnübungen bildlich dargestellt.
Welche Klassen wurden in die empirische Untersuchung einbezogen?
Die Untersuchung umfasste mehrere Klassen der Sekundarstufe I von verschiedenen Schulen (Wilhelm-Röntgen-Realschule und Bert-Brecht-Gymnasium), darunter die Klassen 7d, 8b, 8c/d, 9d und 10b/c/d. Für jede Klasse wird eine Bedingungsanalyse, die vom Lehrer durchgeführten Aufwärmprogramme und die eigenständig durchgeführten Aufwärmprogramme der Schüler dargestellt und analysiert.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung der Effektivität verschiedener Aufwärmprogramme in den verschiedenen Klassen. Eine detaillierte Diskussion der Ergebnisse und eine kritische Wertung der Ergebnisse und Methoden sind ebenfalls enthalten.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen aus den empirischen Ergebnissen und bietet praktische Empfehlungen für die Gestaltung effektiver Aufwärmprogramme im Schulsport. Ein Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen rundet die Arbeit ab.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Aufwärmen, Schulsport, Sekundarstufe I, Physiologie, Didaktik, Empirie, Aufwärmprogramme, Schüler, Lehrer, Effektivität, Methoden, Bewegung, Körpertemperatur, Herz-Kreislauf-System, Muskulatur.
- Quote paper
- Hardi Gruner (Author), 1999, Möglichkeiten und Grenzen der Gestaltung von Aufwärmphasen im Sportunterricht der Sek 1, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56094