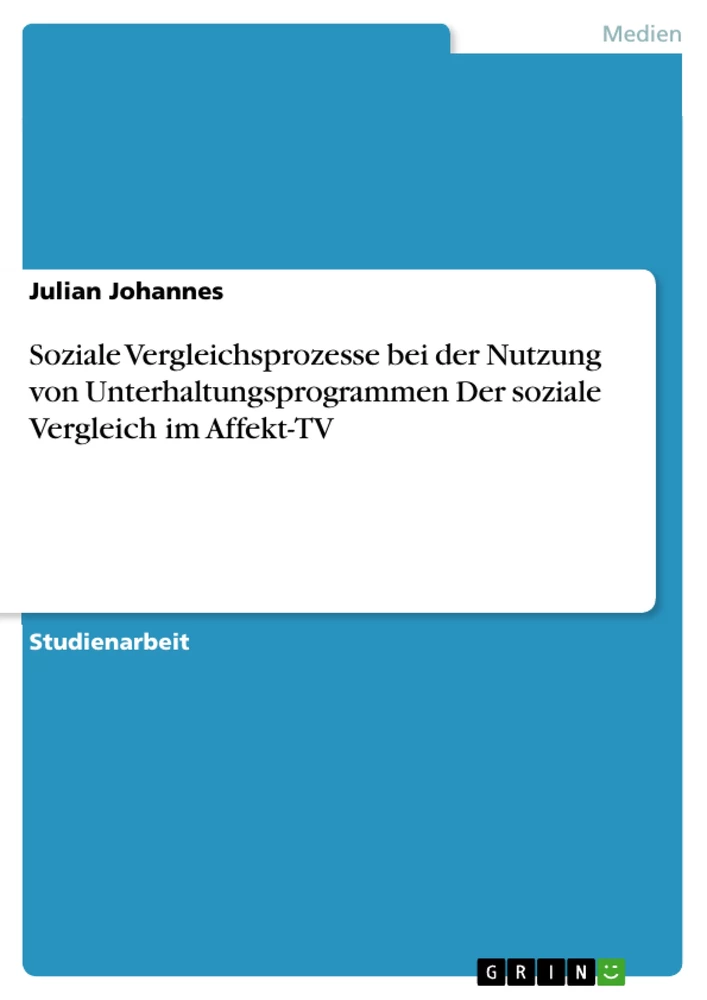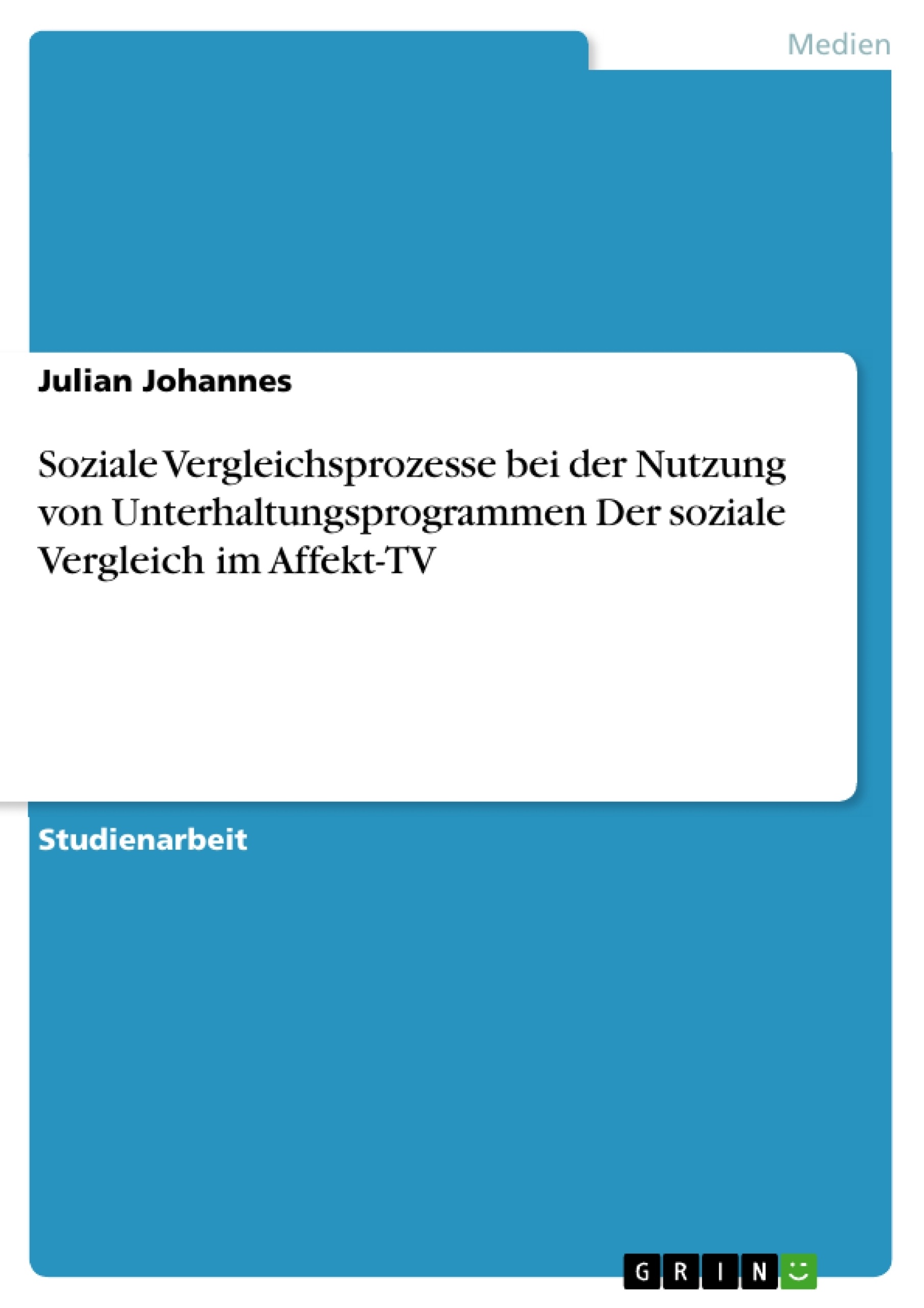Wenngleich dem Genre „Affektfernsehen“ gemeinhin attestiert wird, den Höhepunkt seiner Popularität bereits überschritten zu haben, drängen stets neue Sendungen diesen Programmtyps auf den Sendemarkt. So stellt sich die Frage, ob die guten Einschaltquoten dieses Genres einzig durch den großen Unterhaltungswert seiner Formate erklärt werden können. Ist die Rezeption von Unterhaltungsprogrammen allein dem Motiv „ Unterhalten zu werden“ geschuldet? Studien zu der Theorie sozialer Vergleichsprozesse im Affekt-TV lassen anderes vermuten. Sie lassen den Schluss zu, dass auch die Suche nach bestimmten Vergleichsinformationen als wichtiger Faktor für die Rezeption dieses Genres gewertet werden kann. In dieser Arbeit soll vorerst ein Überblick über wesentliche Charakteristika und Wirkungsweisen des Affekt-TVs erbracht werden. Daran anschließend wird die Theorie sozialer Vergleichsprozesse von Festinger mitsamt entscheidender Erweiterungen ausführlich aufgeführt. Auf dieser Grundlage sollen sodann die verschiedenen Vergleichsmotive für das Unterhaltungsfernsehen, hierbei speziell für das Affekt-TV, erhellt werden. Mit Hilfe von kommunikationswissenschaftlichen und sozialpsychologischen Studien werden ferner spezielle Bedingungen und Besonderheiten der jeweiligen Vergleichsrichtung herausgearbeitet. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass eine empirische Prüfung der sozialen Vergleiche als Mediennutzungsmotiv noch aussteht. Die Übertragung auf die Rezeption von Affekt-TV erfolgt daher einzig aufgrund von Plausibilitätsaspekten. In dem letzten Kapitel wird in einem Ausblick die Anwendungsmöglichkeit der „sozialen Vergleiche“ auf die Nutzung von Berichterstattung diskutiert. Forschungsfragen, deren Beantwortung durch die Wissenschaft einen großen Mehrwert bedeuten würde, bilden den Abschluss der Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Charakteristika von „Affekt-Fernsehen“
- 2. Die Theorie sozialer Vergleichsprozesse – Ein Überblick sozialpsychologischer Erkenntnisse
- 2.1 Sozialpsychologische Elementarbefunde
- 2.2. Der soziale Vergleich
- 2.3. Rahmenbedingungen für einen adäquaten Vergleich
- 2.4. Die emotionale Ebene der Vergleichsprozesse
- 2.5. Verschiedene Vergleichsrichtungen und ihre Motive
- 2.5.1. Das Motiv der Selbstbewertung
- 2.5.2. Das Motiv der Selbstverbesserung
- 2.5.3. Das Motiv der Selbstwertdienlichkeit
- 2.5.4. Zwischenfazit
- III. Ausblick Sozialer Vergleich in der Berichterstattung
- IV. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob das Genre „Affekt-Fernsehen“ neben seinem Unterhaltungswert auch durch die Suche nach Vergleichsinformationen bei Rezipienten beliebt ist. Zuerst werden die Charakteristika des Affekt-TVs beleuchtet, anschließend wird die Theorie sozialer Vergleichsprozesse von Festinger und deren Erweiterungen vorgestellt. Schließlich werden die Vergleichsmotive im Kontext des Affekt-TVs anhand von kommunikationswissenschaftlichen und sozialpsychologischen Studien erörtert.
- Charakteristika von „Affekt-Fernsehen“
- Theorie sozialer Vergleichsprozesse
- Vergleichsmotive im Affekt-TV
- Anwendbarkeit der Theorie auf Berichterstattung
- Forschungsfragen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung thematisiert die anhaltende Popularität von „Affekt-Fernsehen“ und stellt die Frage nach den zugrundeliegenden Nutzungsmotiven. Dabei wird die Relevanz sozialer Vergleichsprozesse für die Rezeption von Unterhaltungsprogrammen hervorgehoben.
Der Hauptteil beginnt mit einer Analyse der Charakteristika des Affekt-TVs, wobei die Fokussierung auf nicht-prominente Einzelpersonen, den hohen Realitätsgrad und die emotionale Inszenierung von Geschichten im Vordergrund stehen. Die Theorie sozialer Vergleichsprozesse von Festinger wird vorgestellt, die davon ausgeht, dass Menschen sich mit anderen vergleichen, um ein angemessenes Verhalten in ihrem sozialen Kontext zu finden.
Der Fokus liegt darauf, wie diese Theorie auf die Rezeption von Affekt-TV anwendbar ist und welche Vergleichsmotive (Selbstbewertung, Selbstverbesserung, Selbstwertdienlichkeit) durch das Affekt-TV angesprochen werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen „Affekt-Fernsehen“, „Soziale Vergleichsprozesse“, „Rezeptionsmotive“, „Selbstbewertung“, „Selbstverbesserung“, „Selbstwertdienlichkeit“ und „Mediennutzung“. Die Fokus liegt auf der Anwendung sozialpsychologischer Erkenntnisse auf die Rezeption von Unterhaltungsprogrammen im Kontext des Affekt-TVs.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Genre „Affekt-Fernsehen“?
Dieses Genre (oft Reality-TV oder Talkshows) fokussiert auf nicht-prominente Personen und inszeniert deren emotionale Geschichten mit einem hohen Realitätsgrad.
Warum nutzen Zuschauer Affekt-TV laut der Theorie sozialer Vergleichsprozesse?
Zuschauer suchen oft nach Vergleichsinformationen, um das eigene Verhalten zu bewerten, sich selbst zu verbessern oder den eigenen Selbstwert zu steigern.
Was besagt Festingers Theorie der sozialen Vergleichsprozesse?
Menschen haben ein Bedürfnis, ihre eigenen Meinungen und Fähigkeiten zu bewerten, und nutzen dafür den Vergleich mit anderen, wenn objektive Maßstäbe fehlen.
Was ist das Motiv der „Selbstwertdienlichkeit“ beim Fernsehen?
Zuschauer vergleichen sich oft mit Personen, denen es schlechter geht (Abwärtsvergleich), um sich über die eigene Situation besser zu fühlen.
Gibt es einen Unterschied zwischen Selbstbewertung und Selbstverbesserung?
Ja, bei der Selbstbewertung geht es um eine realistische Einschätzung der eigenen Lage, während die Selbstverbesserung durch den Vergleich mit Vorbildern (Aufwärtsvergleich) motiviert ist.
Kann die Theorie auch auf Nachrichtensendungen angewendet werden?
Die Arbeit diskutiert im Ausblick die Anwendungsmöglichkeit der sozialen Vergleiche auf die Nutzung von Berichterstattung und journalistischen Inhalten.
- Quote paper
- Julian Johannes (Author), 2006, Soziale Vergleichsprozesse bei der Nutzung von Unterhaltungsprogrammen Der soziale Vergleich im Affekt-TV, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55811