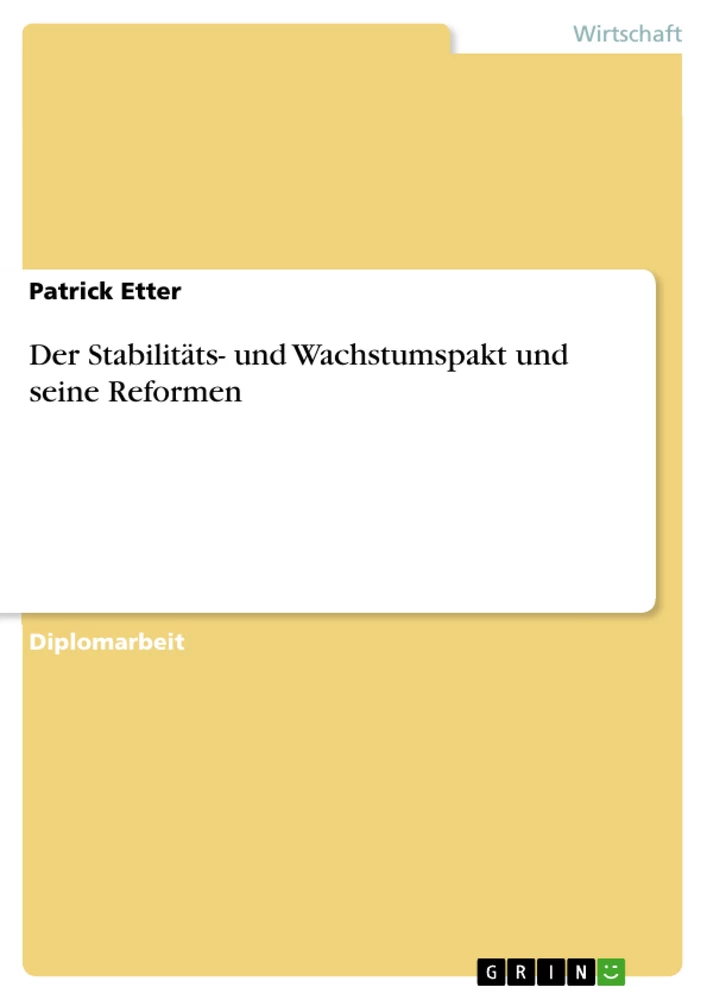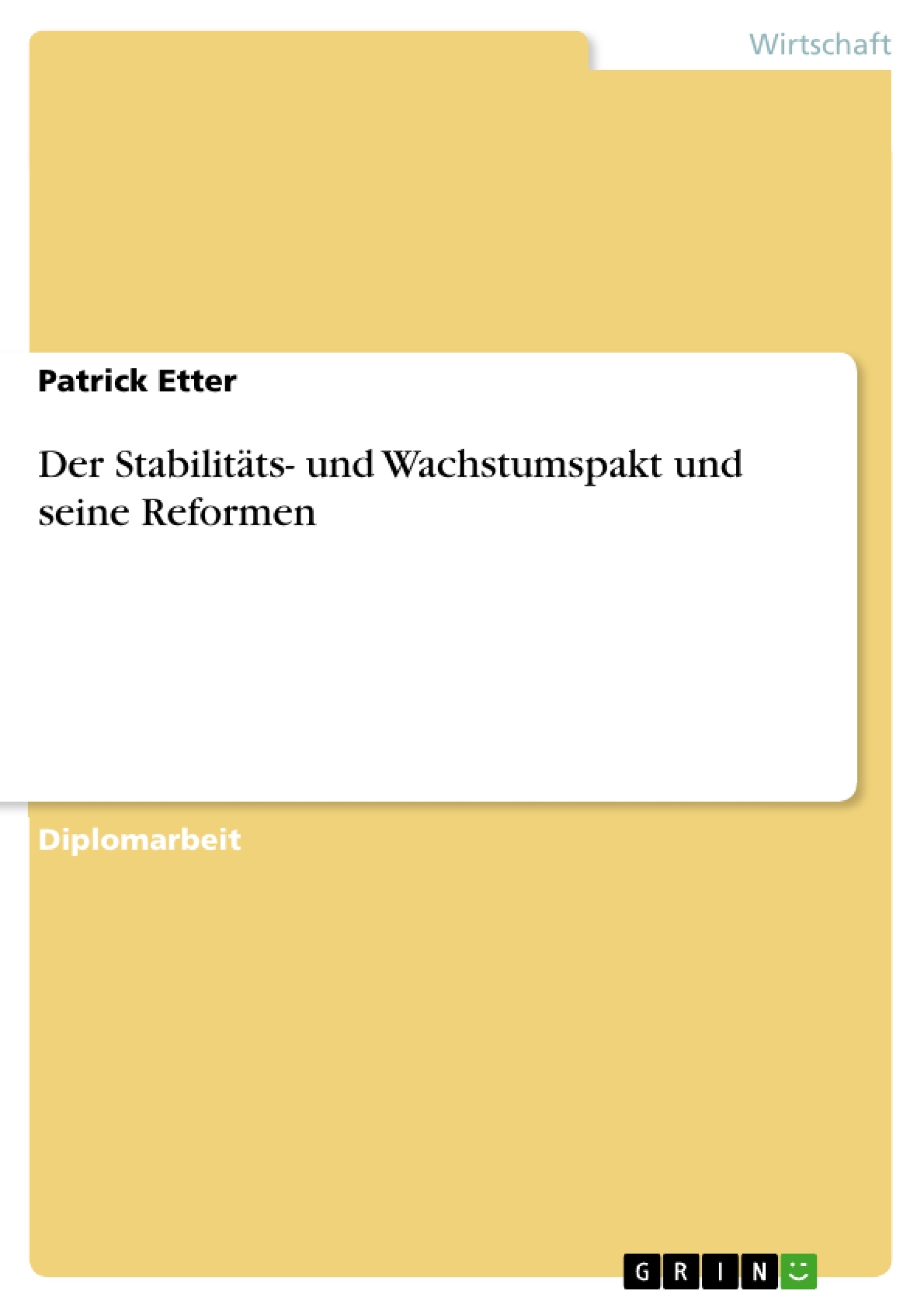Die Diskussion um den SWP, die Änderungen des Regelwerks und die möglichen Auswirkungen der Reform sollen in dieser Diplomarbeit aufgegriffen und ökonomisch weitsichtig aufgearbeitet werden. Das heißt, es wird versucht, einen breiten Überblick über viele relevante Aspekte der Problematik zu geben. Um die Vorgehensweise in die Diskussion über den SWP einordnen und die dort vorgebrachten Argumente beurteilen zu können, ist es notwendig, sich zuerst mit den institutionellen und ökonomischen Grundlagen des SWP auseinanderzusetzen.
Kapitel 2 beschreibt die Umstände, die zur Entstehung des SWP führten. Des Weiteren werden die Ziele des SWP erläutert sowie die institutionelle Ausgestaltung dargestellt. In Kapitel 3 wird mittels eines einfach gehaltenen formalen Modells die Existenz des SWP begründet. Kapitel 4 gibt einen Überblick über die Entwicklung der öffentlichen Finanzen in der EU und die bisher eingeleiteten Defizitverfahren. Hier werden insbe-
Einleitung 9
sondere die Verfahren gegen die beiden größten WWU-Mitgliedsländer, Deutschland und Frankreich, beschrieben. Der Hauptteil der Arbeit beginnt in Kapitel 5. Ansatzpunkte der Kritik am ursprünglichen SWP und Änderungsvorschläge im Vorfeld der Reform werden dargestellt und bewertet. Die Darstellung bildet somit eine Basis für eine spätere Beurteilung der Reform. Kapitel 6 stellt die Reformvorschläge der EU-Kommission und die Ausgangslage der Mitgliedstaaten zu Beginn der Verhandlungen um die Reform des SWP vor. Anschließend werden die beschlossenen Änderungen am SWP vorgestellt und bewertet. Eine Erweiterung des formalen Modells aus Kapitel 3 soll dabei die Auswirkungen einer Flexibilisierung des SWP untersuchen. Die Diplom- arbeit endet mit einer Ausblick gebenden Schlussbetrachtung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Stabilitäts- und Wachstumspakt
- Entstehung
- Ziele
- Ausgestaltung
- Anwendung
- Multilaterale Überwachung und präventiver Frühwarnmechanismus
- Verfahren bei übermäßigem Defizit
- Theoretische Modellansätze zur Begründung des Stabilitäts- und Wachstumspakts
- Überblick über wichtige theoretische Modellansätze
- Das Modell von Beetsma und Uhlig (1997)
- Grundlagen
- Das Modell ohne Stabilitäts- und Wachstumspakt
- Das Modell mit Stabilitäts- und Wachstumspakt
- Schlussfolgerung und Beurteilung
- Der Stabilitäts- und Wachstumspakt: Entwicklung und Anwendung in der WWU
- Öffentliche Haushaltslage in Europa
- Defizitverfahren in der WWU
- Der Stabilitäts- und Wachstumspakt in der Diskussion: Kritik und Reformvorschläge
- Mangelnde Flexibilität
- Asymmetrische Ausgestaltung
- Fehlender Automatismus
- Ausgabenziele statt Defizitbeschränkung
- Differenzierung von öffentlichen Ausgaben
- Budgetdefizit-Kriterium vs. Schuldenstand-Kriterium
- Finanzpolitikkomitees
- Die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts
- Vorschläge der EU-Kommission
- Akteurspositionen
- Änderungen am Stabilitäts- und Wachstumspakt
- Änderung der präventiven Komponente
- Änderung der korrektiven Komponente
- Bewertung der Reform
- Theoretischer Modellansatz zur Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts von Beetsma und Jensen (2003)
- Grundlagen
- "Moral Hazard" und "Fiscal Effort"
- Schlussfolgerung
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert den Stabilitäts- und Wachstumspakt der Europäischen Union (SWP), seine Reformen und die aktuelle Diskussion um seine zukünftige Ausgestaltung. Sie untersucht die Entstehung des Pakts, seine Ziele, seine Ausgestaltung und seine praktische Anwendung in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU). Darüber hinaus werden wichtige theoretische Modellansätze zur Begründung des SWP vorgestellt und diskutiert. Die Arbeit beleuchtet die Kritik am SWP sowie die vorgeschlagenen Reformen.
- Entstehung und Ziele des Stabilitäts- und Wachstumspakts
- Theoretische Modellansätze zur Begründung des Pakts
- Kritik am Stabilitäts- und Wachstumspakt
- Reformen des Stabilitäts- und Wachstumspakts
- Aktuelle Diskussion um die Zukunft des Pakts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz des Stabilitäts- und Wachstumspakts für die Stabilität der Eurozone. Kapitel 2 stellt den SWP in seiner Entstehung, seinen Zielen, seiner Ausgestaltung und seiner Anwendung dar. Es werden die Mechanismen zur multilateralen Überwachung und die Verfahren bei übermäßigem Defizit erläutert. Kapitel 3 analysiert verschiedene theoretische Modellansätze zur Begründung des SWP, unter anderem das Modell von Beetsma und Uhlig (1997), und untersucht deren Stärken und Schwächen. Kapitel 4 beleuchtet die Entwicklung und Anwendung des SWP in der WWU und betrachtet die öffentliche Haushaltslage in Europa sowie die Defizitverfahren, die in der WWU eingesetzt werden. Kapitel 5 geht auf die Kritik am SWP ein, einschließlich der Themen mangelnde Flexibilität, asymmetrische Ausgestaltung, fehlender Automatismus, Ausgabenziele statt Defizitbeschränkung, Differenzierung von öffentlichen Ausgaben, Budgetdefizit-Kriterium vs. Schuldenstand-Kriterium und die Rolle von Finanzpolitikkomitees. Kapitel 6 analysiert die Reform des SWP, die Vorschläge der EU-Kommission, die Positionen verschiedener Akteure und die konkreten Änderungen am Pakt. Es werden die Änderungen der präventiven und korrektiven Komponente des SWP untersucht und eine Bewertung der Reform durchgeführt. Darüber hinaus wird ein theoretischer Modellansatz zur Reform des SWP von Beetsma und Jensen (2003) vorgestellt, der den Zusammenhang zwischen "Moral Hazard" und "Fiscal Effort" untersucht. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf die Zukunft des SWP.
Schlüsselwörter
Stabilitäts- und Wachstumspakt, Europäische Union, Eurozone, Wirtschafts- und Währungsunion, Haushaltspolitik, Defizit, Schuldenstand, Maastricht-Kriterien, konvergenzkriterien, theoretische Modellansätze, Spieltheorie, Kritik, Reformen, Flexibilität, Asymmetrie, Automatismus, Ausgabenziele, Finanzpolitikkomitees.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP)?
Der SWP ist ein Regelwerk der EU zur Sicherstellung solider öffentlicher Finanzen in der Eurozone, insbesondere durch die Begrenzung von Haushaltsdefiziten und Schuldenstand.
Warum wurde der Stabilitäts- und Wachstumspakt reformiert?
Die Reformen zielten darauf ab, die mangelnde Flexibilität des ursprünglichen Pakts zu beheben und länderspezifische wirtschaftliche Gegebenheiten besser zu berücksichtigen.
Was sind die Maastricht-Kriterien im Kontext des SWP?
Dazu gehören vor allem die Obergrenzen für das jährliche Haushaltsdefizit (3 % des BIP) und den öffentlichen Gesamtschuldenstand (60 % des BIP).
Wie funktioniert das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit?
Überschreitet ein Land die Defizitgrenze, leitet die EU-Kommission ein korrektives Verfahren ein, das Empfehlungen und im Extremfall Sanktionen vorsieht.
Welche Kritikpunkte wurden am ursprünglichen Pakt geäußert?
Kritisiert wurden die asymmetrische Ausgestaltung, der fehlende Automatismus bei Sanktionen und die unzureichende Berücksichtigung von Investitionsausgaben.
- Quote paper
- Patrick Etter (Author), 2006, Der Stabilitäts- und Wachstumspakt und seine Reformen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55720