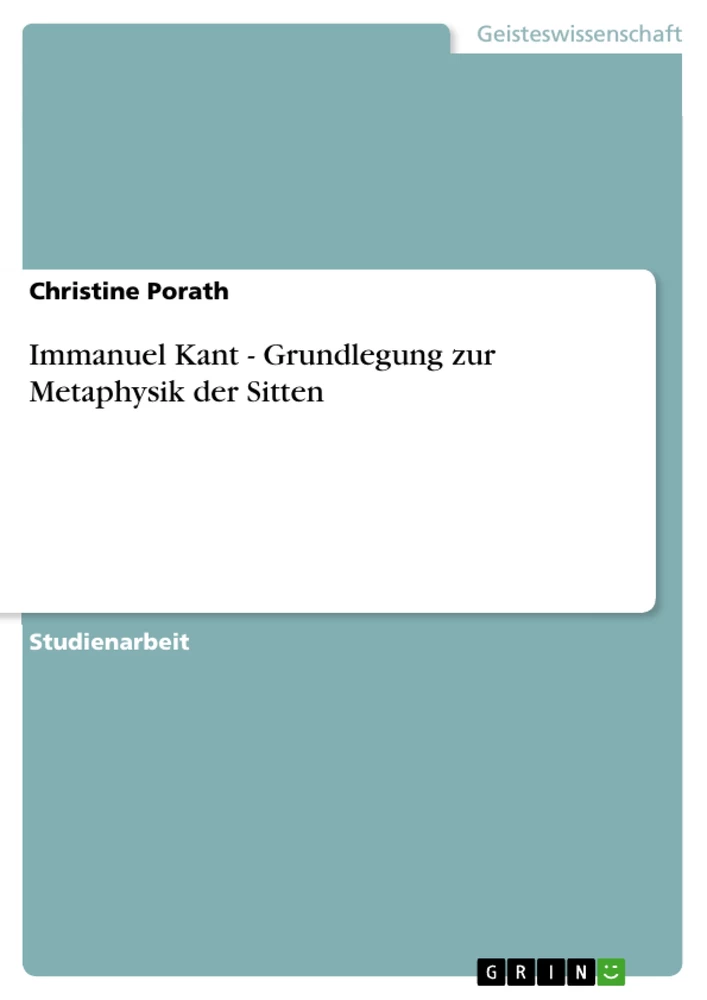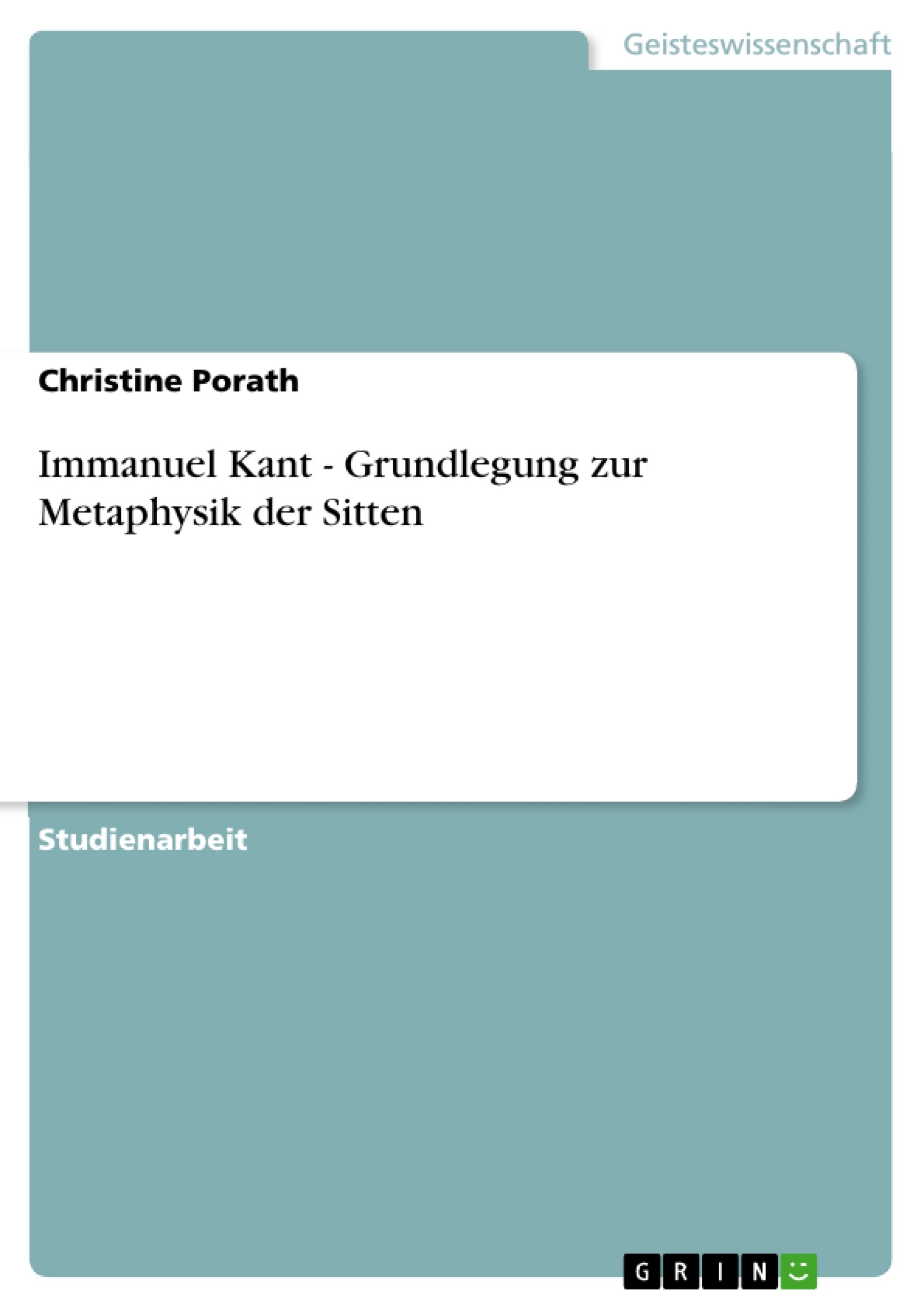Bevor Kant mit der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten die Sittlichkeit und die moralische Beurteilungsfähigkeit des Menschen in der reinen Vernunft ansiedelte, wurde schon von vielen Philosophen vor ihm versucht den Ursprung dieser Sittlichkeit zu bestimmen. Sie wurde z.B. in der Ordnung der Natur oder der Gemeinschaft, aber auch in dem Streben nach Glück, im Willen Gottes oder einfach in einem moralischen Gefühl gesucht.
Doch Kant ging davon aus, dass auf diese Weise keine objektive Gültigkeit und Begründung der Sittlichkeit denkbar sein konnte. Er nahm ebenfalls an, dass moralisches Handeln und Urteilen nicht einem persönlichen Gefühl, einer willkürlichen Entscheidung, der gesellschaftlichen Herkunft oder irgendwelchen Konventionen entspringen, sondern allein eine Tätigkeit der reinen Vernunft ist.
Der Argumentationsgang und somit die Gründung der Moral in der Vernunft wird in dieser Abhandlung nachskizziert und am Ende kritisch betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Herleitung der Sittlichkeit in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
- 2.1. Bewertung und moralischer Wert einer Handlung
- 2.2. Der gute Wille vernünftiger Wesen
- 2.3. Die Ableitung des Prinzips der Sittlichkeit
- 2.4. Sittlichkeit als Prinzip der Autonomie des Willens
- 2.5. Die Freiheit als nicht empirischer Begriff.
- 3. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten befasst sich mit der Frage nach dem Ursprung und der Begründung von Sittlichkeit. Kant argumentiert, dass moralische Handlung und Urteilsfähigkeit nicht auf empirischen Faktoren, wie der Natur, der Gesellschaft oder dem Glück, beruhen, sondern allein eine Tätigkeit der reinen Vernunft sind.
- Der gute Wille als einziges uneingeschränkt Gutes
- Die Rolle der Pflicht im moralischen Handeln
- Die Autonomie des Willens als Grundprinzip der Sittlichkeit
- Die Unterscheidung zwischen pflichtgemäßen und moralisch wertvollen Handlungen
- Die Kritik an der empirischen Begründung von Moral
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Kant führt in die Problematik der Sittlichkeitsbegründung ein und kritisiert die vorherrschenden Ansätze, die Sittlichkeit in der Natur, der Gesellschaft oder dem Glück zu verorten. Er argumentiert, dass eine objektive Gültigkeit der Moral nur durch die reine Vernunft möglich ist.
2. Herleitung der Sittlichkeit in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
2.1. Bewertung und moralischer Wert einer Handlung
Kant stellt fest, dass nur der gute Wille uneingeschränkt gut ist und dass andere Eigenschaften, wie Talente, Temperamentsmerkmale oder Glücksgaben, nur im Kontext des Willens bewertet werden können. Er führt den Begriff der Pflicht ein und unterscheidet zwischen pflichtgemäßen und moralisch wertvollen Handlungen.
2.2. Der gute Wille vernünftiger Wesen
Kant beschreibt den guten Willen als ein Prinzip, das unabhängig von Neigungen und Interessen die Pflicht erfüllt. Er argumentiert, dass der gute Wille in jedem vernünftigen Wesen vorhanden ist.
2.3. Die Ableitung des Prinzips der Sittlichkeit
Kant erläutert, wie das Prinzip der Sittlichkeit aus der reinen Vernunft abgeleitet werden kann. Er zeigt auf, dass die Vernunft die Fähigkeit besitzt, allgemeine moralische Gesetze zu erkennen und zu befolgen.
2.4. Sittlichkeit als Prinzip der Autonomie des Willens
Kant stellt fest, dass Sittlichkeit auf der Autonomie des Willens beruht, d.h. auf der Fähigkeit, sich selbst Gesetze zu geben und diese zu befolgen.
2.5. Die Freiheit als nicht empirischer Begriff
Kant betont, dass die Freiheit, die Voraussetzung für die Sittlichkeit ist, kein empirischer Begriff ist, sondern ein apriorisches Konzept der Vernunft.
Schlüsselwörter
Sittlichkeit, Moral, Vernunft, guter Wille, Pflicht, Autonomie des Willens, Freiheit, empirische Begründung, reine Vernunft, praktische Vernunft, moralischer Wert, pflichtgemäße Handlungen, Neigungen.
- Quote paper
- Christine Porath (Author), 2006, Immanuel Kant - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55696