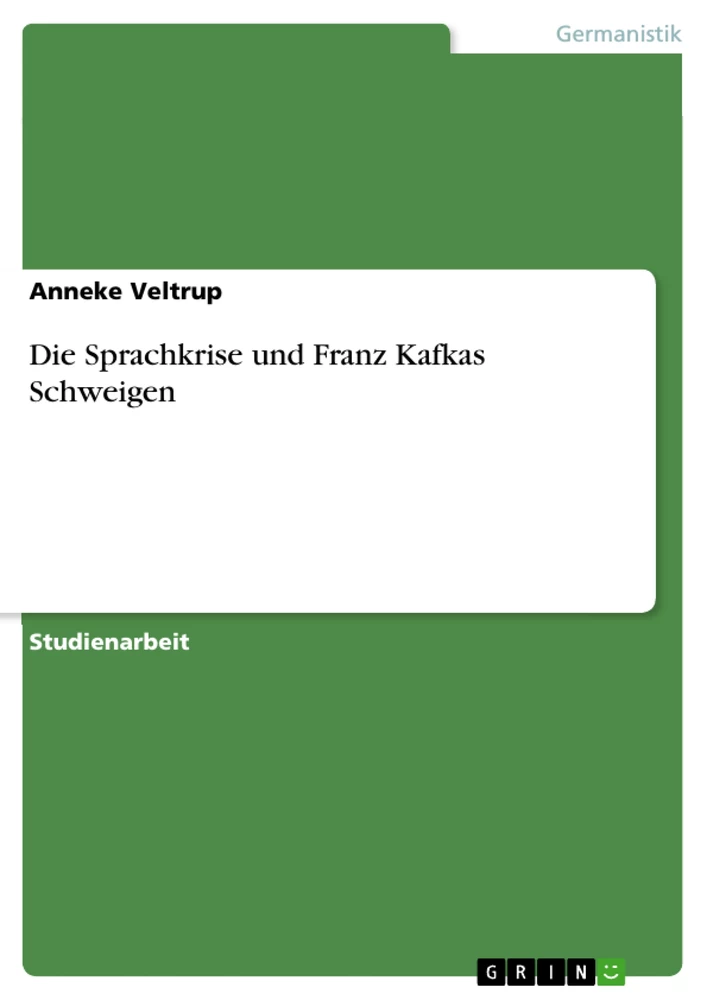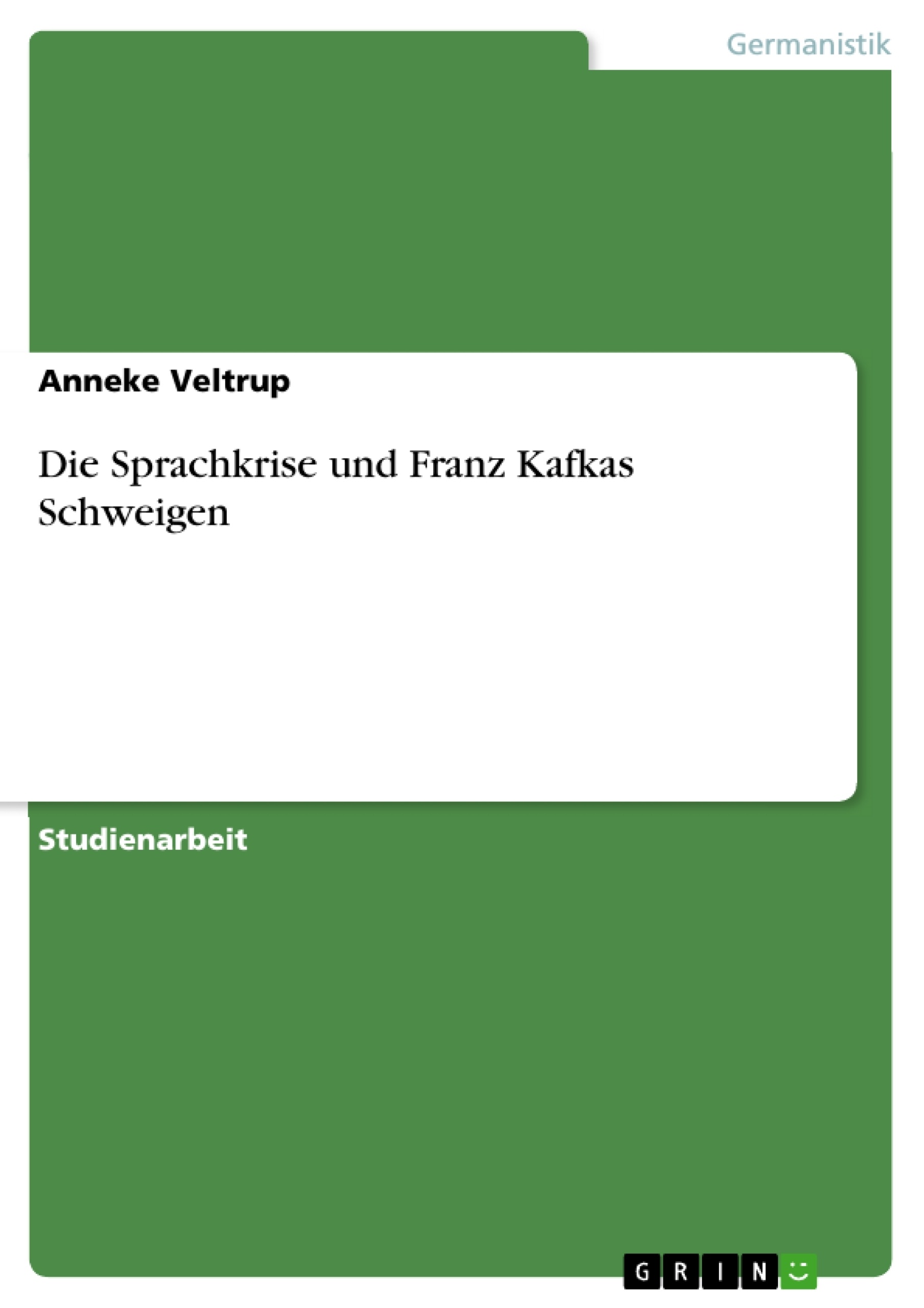Die vorliegende Seminararbeit soll im Wesentlichen Kafkas Verhältnis zur Sprachkrise herausstellen. Kafkas Schweigen als direkte Reaktion auf die um die Jahrhundertwende virulent gewordene Sprachskepsis zu interpretieren ist durchaus problematisch, denn er zählt nicht zu den Propagandisten, die die Unzulänglichkeit sprachlichen Ausdrucks in theoretischen Abhandlungen darlegen.
Gegenstand dieser Arbeit wird es in einem ersten Schritt sein, die Sprachkrise als ein Phänomen um 1900 mit ihren Auswirkungen für das Individuum herauszustellen und so der Frage nachzugehen, ob die Sprachkrise als Teil einer größeren Sinnkrise zu verstehen ist. Auf diese Grundlage aufbauend gilt es dann die Aussagen der Hauptvertreter Friedrich Nietzsche, Fritz Mauthner und Hugo von Hofmannsthal in ihren unterschiedlichen Nuancierungen zu fokussieren, um abschließend die F rage nach Konsequenzen aus den zuvor aufgezeigten Postulaten, aber auch Überwindungsversuche aufzuzeigen, die exemplarisch durch Hugo Ball als Vater des Dadaismus am prägnantesten herausgestellt werden können.
Auch wenn Kafka nicht eindeutig als Vertreter der Sprachkrise bezeichnet werden kann, finden sich bei ihm durchaus sprachkritische Äußerungen. Aus dieser Widersprüchlichkeit ergibt sich dann auch die Fragestellung des zweiten Hauptteils, nämlich wie sich Kafkas Beziehung zur Sprachkrise beurteilen lässt. In diesem Zusammenhang gilt es zunächst Prag als seinen Lebensmittelpunkt und die ihn am stärksten prägende Stadt zu berücksichtigen. Entscheidender aber sind der für Kafkas Schreibstil charakteristische Prozesscharakter, sowie seine stets erneut auftretenden Schreibblockaden, um abschließend die ambivalente Bedeutung der Sprachzweifel auch im Hinblick auf Konstruktivität oder Destruktivität abzuwägen.
In der Schlussbetrachtung werden die vorangegangenen Überlegungen noch einmal im Hinblick auf die Moderne beleuchtet, um abschließend die Frage zu stellen, wie dauerhaft die Angst vor dem Sprachverlust ist, ob die Sprachkrise als Phänomen auch der neueren Moderne einzustufen ist. In diesem Zusammenhang finden unter anderem exemplarisch Peter Handke und Botho Strauss nähere Berücksichtigung, denn sie greifen durchaus sprachkritische Impulse auf.
Inhaltsverzeichnis
- Gegenstand und Zielsetzung dieser Arbeit
- Die Sprachkrise als Phänomen um 1900
- Friedrich Nietzsche
- Fritz Mauthner
- Hugo von Hofmannsthal
- Konsequenzen und Überwindungsversuche
- Franz Kafkas Schweigen: seine Beziehung zur Sprachkrise
- Kafka und Prag
- Der Prozesscharakter in Kafkas Schreibstil
- Die ambivalente Bedeutung der Sprachkrise für Kafka
- Schlussbetrachtung: Die Sprachkrise als Phänomen der Moderne?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit Franz Kafkas Verhältnis zur Sprachkrise um die Jahrhundertwende. Sie untersucht die Sprachkrise als Phänomen und beleuchtet die zentralen Vertreter der Sprachskepsis, darunter Friedrich Nietzsche, Fritz Mauthner und Hugo von Hofmannsthal. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen der Sprachkrise auf das Individuum und die Suche nach Überwindungsversuchen. Die Arbeit analysiert anschließend Kafkas Beziehung zur Sprachkrise, wobei insbesondere sein Schreibstil, seine Schreibblockaden und die ambivalente Bedeutung der Sprachzweifel in den Vordergrund gestellt werden. Abschließend wird die Frage diskutiert, ob die Sprachkrise als Phänomen der Moderne auch in der neueren Zeit relevant ist.
- Die Sprachkrise als Phänomen um 1900
- Die zentralen Vertreter der Sprachskepsis (Nietzsche, Mauthner, Hofmannsthal)
- Die Auswirkungen der Sprachkrise auf das Individuum
- Überwindungsversuche der Sprachkrise
- Franz Kafkas Beziehung zur Sprachkrise
Zusammenfassung der Kapitel
Gegenstand und Zielsetzung dieser Arbeit
Diese Arbeit untersucht Kafkas Verhältnis zur Sprachkrise um 1900. Sie beleuchtet die Sprachkrise als Phänomen und untersucht die zentralen Vertreter der Sprachskepsis, darunter Nietzsche, Mauthner und Hofmannsthal.
Die Sprachkrise als Phänomen um 1900
Das Kapitel beleuchtet die Sprachskepsis um 1900, die sich durch eine selbstreflexive Wende in der Literatur manifestiert. Die Arbeit analysiert die Bedenken am Objektivitätsanspruch der Sprache und die daraus resultierenden Zweifel an der Adäquationstheorie. Sie untersucht die Folgen dieser Zweifel für das Individuum und stellt die Verschränkung von Sprach- und Erkenntniskritik heraus. Die Arbeit zeigt auf, wie die Problematisierung von Wahrnehmen und Bewusstsein zu einer Ich-Krise führt.
Franz Kafkas Schweigen: seine Beziehung zur Sprachkrise
Dieses Kapitel untersucht Kafkas Beziehung zur Sprachkrise. Es beleuchtet Prag als Kafkas Lebensmittelpunkt und die prägende Stadt für seine Werke. Die Arbeit fokussiert auf den Prozesscharakter in Kafkas Schreibstil und seine Schreibblockaden. Sie analysiert die ambivalente Bedeutung der Sprachzweifel in Kafkas Werken hinsichtlich ihrer Konstruktivität oder Destruktivität.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind Sprachkrise, Sprachskepsis, Friedrich Nietzsche, Fritz Mauthner, Hugo von Hofmannsthal, Franz Kafka, Schreibstil, Prozesscharakter, Schreibblockaden, Ambivalenz, Moderne, Identitätskrise, Erkenntniskritik, Adäquationstheorie.
- Quote paper
- Anneke Veltrup (Author), 2006, Die Sprachkrise und Franz Kafkas Schweigen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55585