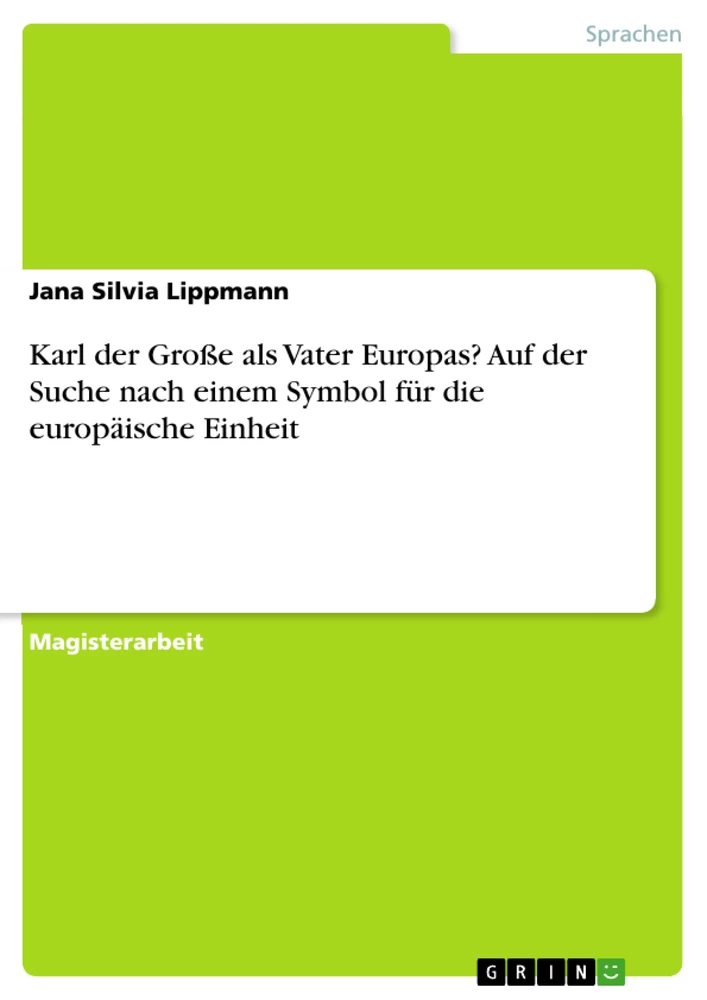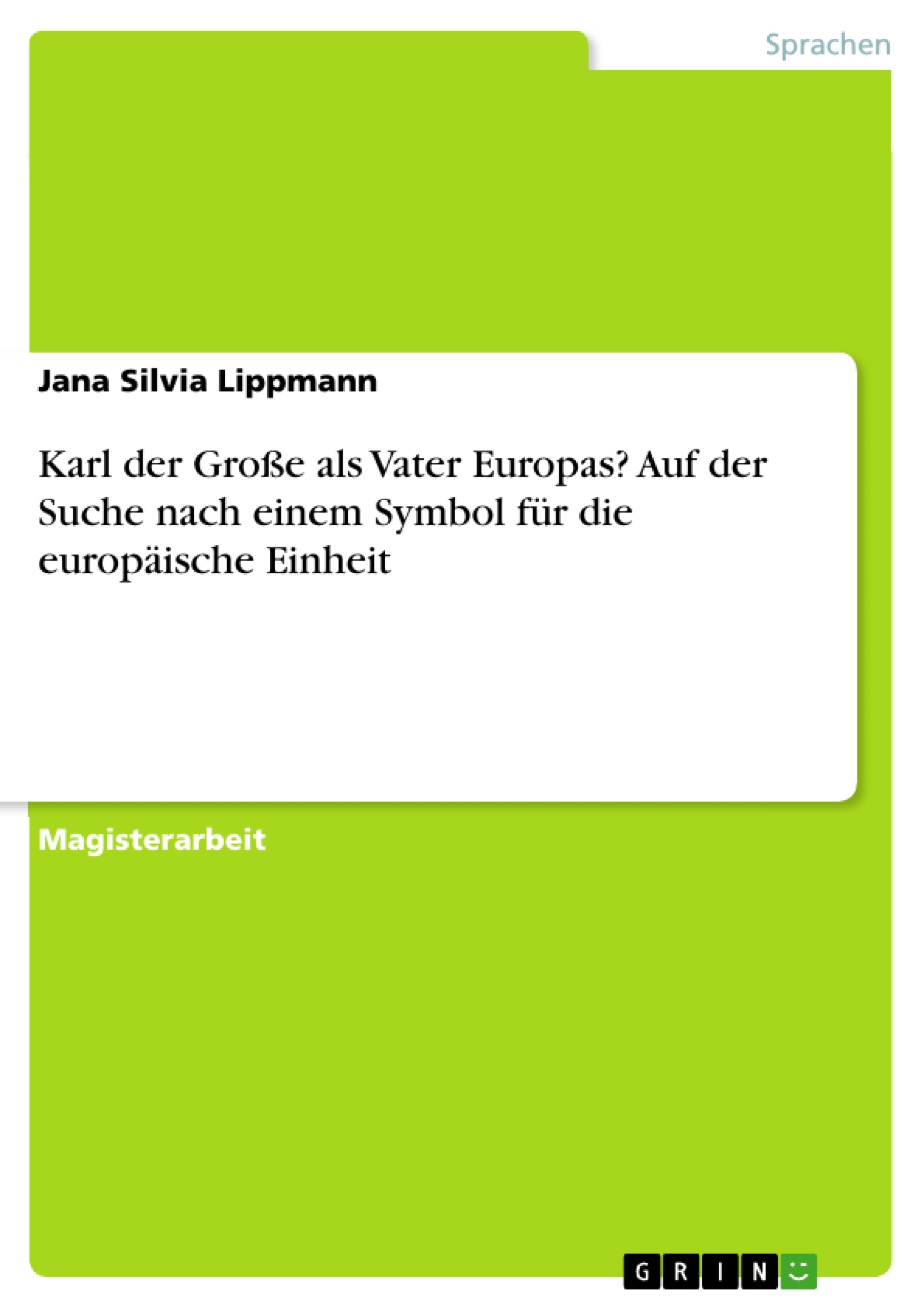Die europäische Integration ist heute ein wichtiges politisches Thema. Bei der Suche nach einer Identifikations- und Gründungsfigur stößt man auf Karl den Großen. In zeitgenössischen Lobgedichten zu Beginn des 9. Jahrhunderts wird der Begriff „Europa” häufig gebraucht und mit dem karolingischen Reich gleich gesetzt. Sein Herrscher Karl der Große wird mit dem Titel Pater Europae - Vater Europas – geschmückt. Dieses Bild eines fürsorglichen Vaters, der sich um die Belange ganz Europas kümmert, hat sich in der Geschichtsbetrachtung erhalten und bietet sich als Symbol für die europäische Einheit an. Doch kann man den Anfang Europas, den Beginn eines europäischen Gedankens und eines Gemeinschaftsgefühls tatsächlich in ein so fernes Jahrhundert legen?
Der Begriff Europa ist alt, seine Bedeutung wandelte sich mehrfach, passte sich den jeweiligen Erfordernissen an. Ebenso hat sich auch das Bild, das sich die Menschen von Karl dem Großen machen und gemacht haben, innerhalb von mehr als tausend Jahren verändert. Der karolingische Kaiser ging in die Literatur ein, regte die Fantasie der Menschen an und wurde zu einem Mythos, der bei Bedarf für die eigenen Ziele verwendet werden konnte. Immer wieder diente Karl der Große als Vorbild und Legitimation für nachfolgende Herrscher.
Obwohl das Karlsbild inzwischen soweit verblasst ist, dass sich heute kein Politiker mehr in seinem Alltagsgeschäft auf das Vorbild Karls des Großen beruft, wandelt sich die Einstellung zum Kaiser des christlichen Abendlandes, sobald es um große europäische Veranstaltungen geht. Bei Festreden, zum Beispiel bei der jährlichen Verleihung des Karlspreises, nutzt man Karl den Großen als Identifikationsfigur und preist sein mittelalterliches Europa, das man kurzerhand mit dem heutigen Europa gleichsetzt. Dann erinnert man sich wieder an Karl den Großen, den Vater Europas.
Doch was macht einen Vater Europas aus? Welche Leistungen berechtigen zu einem solchen Titel? Oder handelt es sich damals wie heute nur um eine wohl klingende Metapher, um ein übertriebene Herrscherlob, dem der Bezug zur Realität fehlt?
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1 Das Konzept „Europa”
- 1.1 Das mythologische Europa
- 1.2 Das geographische Europa
- 1.3 Das kulturelle Europa
- 1.4 Das politische Europa
- 1.5 Fazit
- 2 Das Frankenreich vor Karl dem Großen
- 2.1 Die historische Entwicklung vom 4. bis zum 8. Jahrhundert
- 2.2 Die Rolle des Christentums und des Papstes
- 2.3 Das kulturelle Leben
- 2.4 Recht und Gesetz
- 2.5 Zusammenfassung
- 3 Das Frankenreich unter Karl dem Großen
- 3.1 Militärische Eroberungen
- 3.1.1 Das Reich der Langobarden
- 3.1.2 Sachsen
- 3.1.3 Die iberische Halbinsel
- 3.2 Der Erwerb der Kaiserkrone
- 3.3 Karl der Große als geistlicher Herrscher
- 3.4 Reformen
- 3.4.1 Das Bildungswesen
- 3.4.2 Die Kirchenreform
- 3.4.3 Die Verwaltung
- 3.4.4 Das Recht
- 3.4.5 Das Münzwesen
- 3.4.6 Architektur, Kunst und Literatur
- 3.5 Europa am Königshof
- 3.6 Zusammenfassende Betrachtung
- 3.1 Militärische Eroberungen
- 4 Das Frankenreich und die Nachfolgestaaten nach Karl dem Großen
- 4.1 Die historische Entwicklung im 9. und 10. Jahrhundert
- 4.2 Der Karlsmythos
- 4.2.1 Karl der Große als Legitimationsfigur
- 4.2.1.1 Legitimation der mittelalterlichen Herrscher
- 4.2.1.2 Napoleon Bonaparte
- 4.2.1.3 Die NS-Propaganda
- 4.2.1.4 Europapolitik und Visionen nach dem Zweiten Weltkrieg
- 4.2.2 Karl als Heiliger und Märtyrer
- 4.2.3 Karl als literarische Figur
- 4.2.4 Karl als Gründungsfigur
- 4.2.1 Karl der Große als Legitimationsfigur
- 4.3 Zusammenfassung
- 5 Karl der Große als Vater Europas
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Frage, inwiefern Karl der Große als "Vater Europas" bezeichnet werden kann. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Begriffs "Europa" und setzt ihn in Beziehung zu den Leistungen und dem Wirken Karls des Großen. Die historische Entwicklung des Frankenreichs wird dabei ebenso betrachtet wie die spätere Rezeption und Mythisierung des Herrschers.
- Entwicklung des Europa-Konzepts im Mittelalter
- Das Frankenreich unter Karl dem Großen: Eroberungen und Reformen
- Die Rolle des Christentums und des Papstes
- Die Nachwirkungen des karolingischen Reiches und der Karlsmythos
- Karl der Große als Legitimationsfigur in verschiedenen Epochen
Zusammenfassung der Kapitel
0 Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Berechtigung des Titels "Vater Europas" für Karl den Großen und führt in die Thematik ein, indem sie auf die zeitgenössische Verwendung des Begriffs "Europa" im Zusammenhang mit dem karolingischen Reich und die widersprüchliche Rezeption Karls des Großen im Laufe der Geschichte hinweist.
1 Das Konzept „Europa”: Dieses Kapitel analysiert den Begriff „Europa“ in seinen verschiedenen Dimensionen: mythologisch, geographisch, kulturell und politisch. Es untersucht die Wandelbarkeit des Begriffs im Laufe der Zeit und legt die Grundlage für das Verständnis der mittelalterlichen Vorstellungen von „Europa“ im Kontext der karolingischen Epoche.
2 Das Frankenreich vor Karl dem Großen: Das Kapitel beschreibt die historische Entwicklung des Frankenreichs vor der Herrschaft Karls des Großen. Es beleuchtet die politische, religiöse und kulturelle Situation des Reiches im 4. bis 8. Jahrhundert, die als Grundlage für das Wirken Karls des Großen dienen. Der Einfluss des Christentums und des Papstes sowie die Rechts- und Gesetzeslage werden ausführlich diskutiert.
3 Das Frankenreich unter Karl dem Großen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Herrschaft Karls des Großen und seine bedeutenden Leistungen. Es beschreibt seine militärischen Eroberungen, den Erwerb der Kaiserkrone, seine Rolle als geistlicher Herrscher und seine umfassenden Reformen in den Bereichen Bildung, Kirche, Verwaltung, Recht, Münzwesen und Kunst. Die Bedeutung des Königshofs als Zentrum des europäischen Lebens wird ebenfalls behandelt.
4 Das Frankenreich und die Nachfolgestaaten nach Karl dem Großen: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Entwicklung des Frankenreichs nach dem Tod Karls des Großen. Es analysiert die historische Entwicklung des 9. und 10. Jahrhunderts und die Entstehung des Karlsmythos. Die Verwendung Karls des Großen als Legitimationsfigur von mittelalterlichen Herrschern bis hin zur NS-Propaganda und der europäischen Politik nach dem Zweiten Weltkrieg wird umfassend untersucht.
Schlüsselwörter
Karl der Große, Frankenreich, Europa, Karolinger, Kaiserkrone, Christentum, Papst, Reformen, Karlsmythos, Legitimation, mittelalterliche Geschichte, europäische Identität, Integration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Karl der Große – Vater Europas?
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Frage, inwieweit Karl der Große als "Vater Europas" bezeichnet werden kann. Sie analysiert die Entwicklung des Begriffs "Europa" und setzt ihn in Beziehung zu den Leistungen und dem Wirken Karls des Großen. Die historische Entwicklung des Frankenreichs und die spätere Rezeption und Mythisierung des Herrschers werden dabei umfassend betrachtet.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Entwicklung des Europa-Konzepts im Mittelalter, das Frankenreich unter Karl dem Großen (Eroberungen und Reformen), die Rolle des Christentums und des Papstes, die Nachwirkungen des karolingischen Reiches und der Karlsmythos, sowie Karl der Große als Legitimationsfigur in verschiedenen Epochen (vom Mittelalter bis zur NS-Propaganda und der Nachkriegszeit).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, ein Kapitel zum Europa-Konzept, ein Kapitel zum Frankenreich vor Karl dem Großen, ein Kapitel zum Frankenreich unter Karl dem Großen und ein Kapitel zum Frankenreich und seinen Nachfolgestaaten nach Karl dem Großen. Das letzte Kapitel widmet sich explizit der Frage nach Karl dem Großen als "Vater Europas". Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung.
Was wird im Kapitel "Das Konzept Europa" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert den Begriff "Europa" in seinen verschiedenen Dimensionen: mythologisch, geographisch, kulturell und politisch. Es untersucht die Wandelbarkeit des Begriffs im Laufe der Zeit und legt die Grundlage für das Verständnis der mittelalterlichen Vorstellungen von "Europa" im Kontext der karolingischen Epoche.
Was wird im Kapitel zum Frankenreich vor Karl dem Großen behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung des Frankenreichs vor der Herrschaft Karls des Großen. Es beleuchtet die politische, religiöse und kulturelle Situation des Reiches im 4. bis 8. Jahrhundert und analysiert den Einfluss des Christentums und des Papstes sowie die Rechts- und Gesetzeslage.
Was wird im Kapitel zum Frankenreich unter Karl dem Großen behandelt?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Herrschaft Karls des Großen und seine Leistungen: militärische Eroberungen, Erwerb der Kaiserkrone, Rolle als geistlicher Herrscher und umfassende Reformen in Bildung, Kirche, Verwaltung, Recht, Münzwesen und Kunst. Die Bedeutung des Königshofs wird ebenfalls thematisiert.
Was wird im Kapitel zum Frankenreich nach Karl dem Großen behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des Frankenreichs nach dem Tod Karls des Großen (9. und 10. Jahrhundert) und die Entstehung des Karlsmythos. Es untersucht die Verwendung Karls des Großen als Legitimationsfigur in verschiedenen Epochen, von mittelalterlichen Herrschern bis zur NS-Propaganda und der europäischen Politik nach dem Zweiten Weltkrieg.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Karl der Große, Frankenreich, Europa, Karolinger, Kaiserkrone, Christentum, Papst, Reformen, Karlsmythos, Legitimation, mittelalterliche Geschichte, europäische Identität, Integration.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwieweit kann Karl der Große als "Vater Europas" bezeichnet werden?
- Quote paper
- Jana Silvia Lippmann (Author), 2005, Karl der Große als Vater Europas? Auf der Suche nach einem Symbol für die europäische Einheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55578