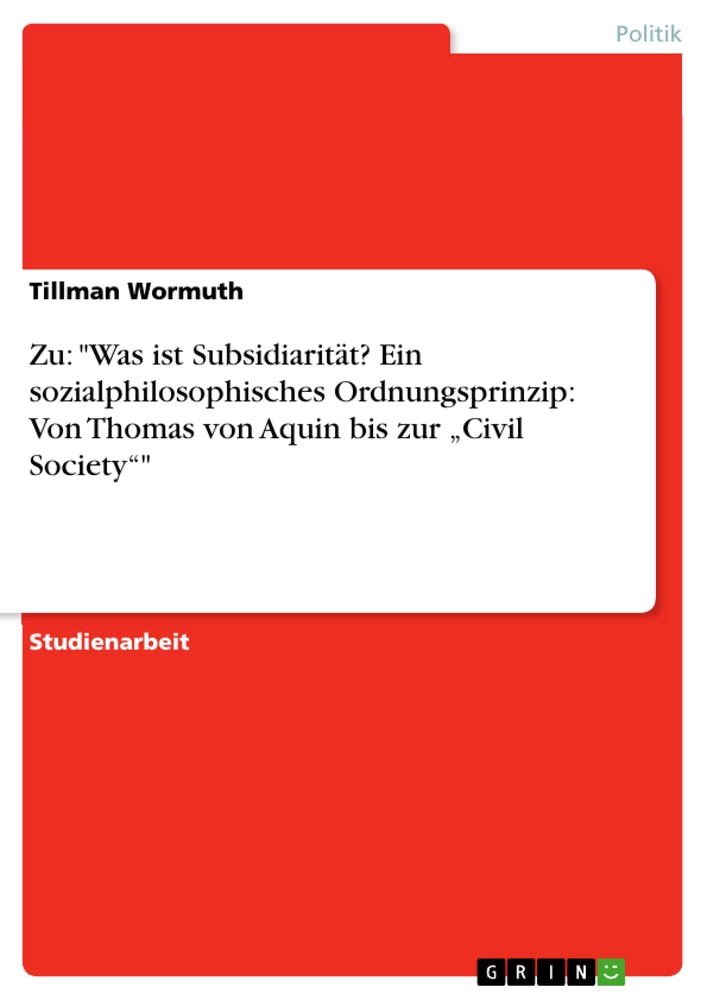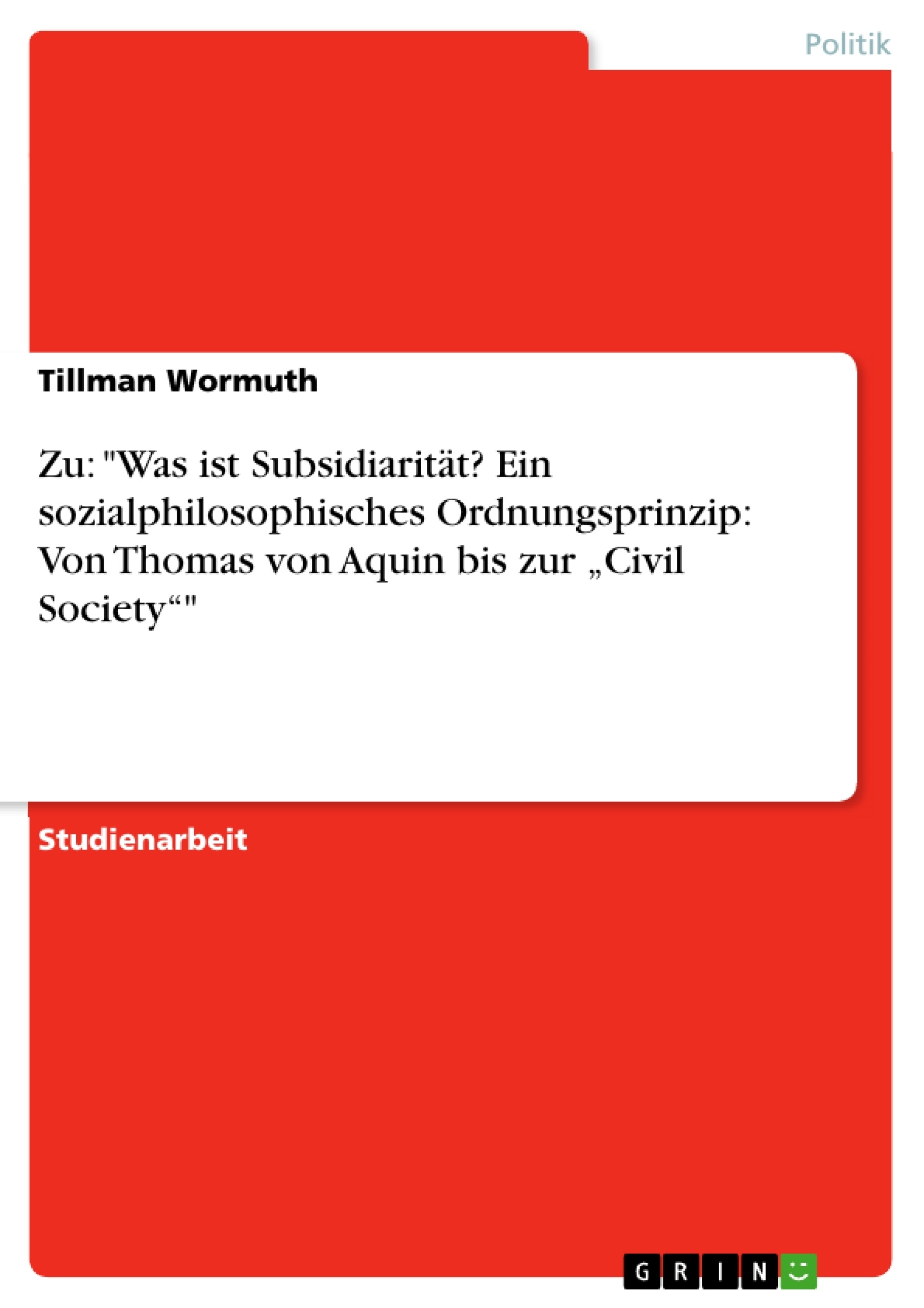„Das Subsidiaritätsprinzip ist ein gesellschaftspolitisches Prinzip, nach dem übergeordnete gesellschaftliche Einheiten (bes. Staat) nur solche Aufgaben an sich ziehen dürfen, zu deren Wahrnehmung untergeordnete Einheiten (bes. Familie) nicht in der Lage sind.“1 Das heißt, in erster Linie sollten kleinere soziale Gefüge, wie Familie oder Nachbarschaft, Notlagen einzelner Individuen auffangen. Erst wenn sie dazu nicht mehr in der Lage wären, sollten größere Einheiten, wie beispielsweise die Gemeinde, Hilfe leisten. Es geht weniger darum, die vollständige Verantwortung für ein Individuum zu übernehmen, sondern vielmehr darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Im Rahmen der katholischen Sozialethik ist der Hilfebedürftige also auch in die Pflicht genommen, Verantwortung für sich selbst zu tragen. Die staatlichen Organe sollten nicht unnötig in das Leben von Menschen oder die Tätigkeiten kleinerer öffentlicher Gefüge eingreifen. Diese Thematik ist gerade auch in Anbetracht der aktuellen Föderalismusdebatte von Belang. Welche Kompetenzen bleiben den Ländern vorbehalten? Wie wird beispielsweise die Zahlung von ALG II auf Kommunen, Länder und Bund verteilt? Wird das Föderalismusprinzip durch zunehmende Zentralisierungstendenzen untergraben?
Inwieweit ist das Subsidiaritätsprinzip in der Lage der heutigen Gesellschaft einen Beitrag zur Lösung sozialer Probleme zu leisten? Sind subsidiäre Elemente in der Politik erkennbar? Im ersten Teil der Darstellung werde ich anhand der von Arno Waschkuhn ausgewählten Beispiele ein ideengeschichtliches Grundgerüst der katholischen Soziallehre nachzeichnen. Die Entwicklungslinie geht vom hochmittelalterlichen Scholastiker Thomas von Aquin, in dessen Weltbild Gott die zentrale Rolle gespielt hat zum, frühneuzeitlichen Rechtsphilosophen Johannes Althusius über, dessen Staatskonzept auf der säkularisierten Naturrechtstheorie basierte. Abschließend stellt er Oswald von Nell – Breuning als zeitgenössischen Vertreter der Soziallehre vor, der maßgeblich an der Abfassung der „Quadragesimo anno“ beteiligt war und das Subsidiaritätsprinzip in seinen Schriften näher erläutert hat. [...]
--
1 Die Zeit. Das Lexikon. Band 19. Hamburg 2005. S. 226
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Subsidiarität als Grundkategorie in der Ideengeschichte und katholischen Soziallehre
- Thomas von Aquin
- Johannes Althusius
- Soziale Enzyklika „Quadragesimo anno“
- Oswald von Nell-Breuning
- Die Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips und seiner Relationen für die Gesamtgesellschaft
- Subsidiarität und Sozialpolitik
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, das Subsidiaritätsprinzip im Kontext der katholischen Soziallehre und seiner Relevanz für die heutige Gesellschaft zu untersuchen. Es wird die ideengeschichtliche Entwicklung des Prinzips nachgezeichnet und dessen Bedeutung für die Sozialpolitik beleuchtet.
- Ideengeschichtliche Entwicklung des Subsidiaritätsprinzips
- Das Subsidiaritätsprinzip in der katholischen Soziallehre
- Bedeutung des Prinzips für die Sozialpolitik
- Relevanz des Prinzips für die heutige Gesellschaft
- Subsidiarität und Föderalismus
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung definiert das Subsidiaritätsprinzip als gesellschaftspolitisches Prinzip, wonach höhere Einheiten nur dann eingreifen sollen, wenn niedrigere Einheiten nicht mehr handlungsfähig sind. Es wird die Frage nach der heutigen Relevanz des Prinzips im Kontext von Sozialpolitik und Föderalismus gestellt und der methodische Ansatz der Arbeit skizziert, der sich auf die Analyse ausgewählter Beispiele aus der ideengeschichtlichen Entwicklung der katholischen Soziallehre konzentriert. Die Arbeit untersucht die Anwendung des Prinzips in der Bundesrepublik Deutschland und berührt kurz die Debatte um die Verteilung von Aufgaben und Kompetenzen zwischen Bund, Ländern und Kommunen, insbesondere im Zusammenhang mit dem ALG II.
Subsidiarität als Grundkategorie in der Ideengeschichte und katholischen Soziallehre: Dieses Kapitel zeichnet die ideengeschichtliche Entwicklung des Subsidiaritätsprinzips nach, beginnend mit Thomas von Aquin. Es wird Aquins Verständnis von der göttlichen Ordnung und dem hierarchischen Aufbau der Gesellschaft erläutert, in dem das Gemeinwohl Vorrang vor Einzelinteressen hat und der Mensch als ergänzungsbedürftiges Wesen dargestellt wird. Das Kapitel beleuchtet anschließend die Weiterentwicklung des Prinzips bei Johannes Althusius, dessen säkularisiertes Naturrechtkonzept den Fokus auf das Zusammenleben in einer hierarchisch gegliederten Gesellschaft lenkt. Die Bedeutung der Sozialenzyklika „Quadragesimo anno“ und die Beiträge von Oswald von Nell-Breuning zur Ausarbeitung und Erklärung des Subsidiaritätsprinzips werden ebenfalls diskutiert, um die Entwicklung dieses Prinzips von seinen mittelalterlichen Wurzeln bis in die Gegenwart zu veranschaulichen.
Die Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips und seiner Relationen für die Gesamtgesellschaft: Dieser Abschnitt untersucht die Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips für die Gesamtgesellschaft, wobei ein besonderer Fokus auf die Interaktion mit der Sozialpolitik gelegt wird. Während die einzelnen Unterkapitel nicht im Detail zusammengefasst werden, wird der allgemeine Tenor des Kapitels beleuchtet, der wahrscheinlich die praktische Anwendung des Prinzips in der modernen Gesellschaft und seine Herausforderungen analysiert. Die Diskussion um die optimale Balance zwischen staatlicher Intervention und selbstverantwortlichem Handeln wird wahrscheinlich im Mittelpunkt stehen, mit einer kritischen Auseinandersetzung mit den Grenzen und Möglichkeiten subsidiärer Ansätze in der Sozialpolitik.
Schlüsselwörter
Subsidiarität, Katholische Soziallehre, Thomas von Aquin, Sozialpolitik, Föderalismus, Gemeinwohl, Selbsthilfe, ALG II, Zentralisierung, Dezentralisierung, Quadragesimo anno, Oswald von Nell-Breuning.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Subsidiaritätsprinzip in der katholischen Soziallehre und seiner Relevanz für die heutige Gesellschaft
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Subsidiaritätsprinzip im Kontext der katholischen Soziallehre und seiner Bedeutung für die heutige Gesellschaft. Sie verfolgt die ideengeschichtliche Entwicklung des Prinzips und beleuchtet dessen Relevanz für die Sozialpolitik, insbesondere in Bezug auf die Verteilung von Aufgaben und Kompetenzen zwischen Bund, Ländern und Kommunen in der Bundesrepublik Deutschland.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die ideengeschichtliche Entwicklung des Subsidiaritätsprinzips, beginnend bei Thomas von Aquin und Johannes Althusius bis hin zur Sozialenzyklika „Quadragesimo anno“ und Oswald von Nell-Breuning. Sie analysiert die Bedeutung des Prinzips für die Sozialpolitik, den Föderalismus und die Herausforderungen seiner Anwendung in der modernen Gesellschaft. Ein besonderer Fokus liegt auf der Balance zwischen staatlicher Intervention und selbstverantwortlichem Handeln.
Welche Autoren und Texte werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Beiträge von Thomas von Aquin, Johannes Althusius, die Soziale Enzyklika „Quadragesimo anno“ und Oswald von Nell-Breuning zur Entwicklung und Auslegung des Subsidiaritätsprinzips. Sie analysiert deren Verständnis von der göttlichen Ordnung, dem hierarchischen Aufbau der Gesellschaft und dem Verhältnis von Gemeinwohl und Einzelinteressen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in folgende Kapitel gegliedert: Einleitung, Subsidiarität als Grundkategorie in der Ideengeschichte und katholischen Soziallehre, Die Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips und seiner Relationen für die Gesamtgesellschaft, und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel untersucht einen Aspekt des Subsidiaritätsprinzips, von seinen historischen Wurzeln bis hin zu seiner Anwendung in der heutigen Gesellschaft.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Subsidiaritätsprinzip umfassend zu analysieren und seine Bedeutung für die heutige Gesellschaft zu erörtern. Sie möchte die ideengeschichtliche Entwicklung nachzeichnen und die Relevanz des Prinzips für die Sozialpolitik beleuchten, insbesondere im Hinblick auf die Aufgabenverteilung zwischen verschiedenen staatlichen Ebenen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Subsidiarität, Katholische Soziallehre, Thomas von Aquin, Sozialpolitik, Föderalismus, Gemeinwohl, Selbsthilfe, ALG II, Zentralisierung, Dezentralisierung, Quadragesimo anno, Oswald von Nell-Breuning.
Welche konkreten Beispiele werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet als Beispiel die Debatte um die Verteilung von Aufgaben und Kompetenzen zwischen Bund, Ländern und Kommunen in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere im Zusammenhang mit dem ALG II, um die praktische Anwendung des Subsidiaritätsprinzips zu illustrieren.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
(Die Schlussfolgerung ist nicht explizit im gegebenen Textzusammenfassung enthalten und müsste aus dem vollständigen Text entnommen werden.)
- Quote paper
- Tillman Wormuth (Author), 2005, Zu: "Was ist Subsidiarität? Ein sozialphilosophisches Ordnungsprinzip: Von Thomas von Aquin bis zur „Civil Society“" , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55474